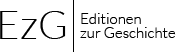Gespräche über den Krieg – „Er hat sich sehr schwer getan.“
Nachdem sie einige Male darin geblättert und einige von ihnen passagenweise gelesen hatte, verschwanden die Briefe ihres Vaters bei Dorothee Schmitz-Köster zunächst in den Tiefen der Regale und Schränke ihres Arbeitszimmers. Einerseits warteten andere Projekte auf ihre Bearbeitung, andererseits gelang es ihr zunächst aber auch nicht, sich hinreichend auf das Material einzulassen. „Ich fand es zum Teil eben auch unerfreulich und widerlich.“ In ihrem Buch formulierte sie es so: „Was mir an NS-Ideologie in den Blick kam, erschreckte mich und vertrieb meine Neugier weiterzulesen.“
Hinzu kam die schier erschlagende Masse von nahezu 1.100 Briefen, die zum Teil schwer lesbar und bei Weitem nicht in all ihren Inhalten „spannend“ sind. „Tante Finchen hat das gesagt, und Oma hat das gesagt. Also, da muss man sich durchfräsen“, was jedoch eine kontinuierliche Beschäftigung mit den Quellen erfordert habe. Daher wanderten sie zunächst „in die Ecke“, bis sich langsam der „Plan“ herauskristallisiert habe, etwas mit den Briefen „zu machen“ und das Ergebnis zu veröffentlichen. Das wiederum war der Startschuss für eine systematische Lektüre. „Das war mühsam und wurde dann aber auch spannend.“
Als dann einige Jahre später ihre Mutter erkrankte und sie ihren Vater über einen längeren Zeitraum besuchte, um ihm etwas zur Hand zu gehen, ergriff Dorothee Schmitz-Köster die Gelegenheit. Durch ihr bereits zuvor begonnenes detailliertes Studium der Briefe war sie in die Lage versetzt, die einzige Zeit, die sie jemals ausschließlich mit ihrem Vater verbrachte, dazu zu nutzen, mit ihm das intensive Gespräch zu suchen und über die Vergangenheit zu diskutieren.
Als Rudolf Schmitz bemerkte, dass seine Tochter seine Briefe sehr genau rezipierte, las er ihr bereitwillig jene für sie nur schwer zu entziffernden Exemplare vor, die er in Sütterlin-Schrift verfasst hatte. Gleichzeitig, so Dorothee Schmitz-Köster, habe er sie gefragt: „Wieso liest Du das denn? Was machst Du damit?“ Etwas scheinheilig habe sie daraufhin geantwortet, dass sie der Inhalt interessiere und er ihr die Schriftstücke ja gerade deshalb auch übergeben habe. Außerdem sei es ja interessant und wichtig, dass ja nur er dazu in der Lage sei, ihr dazu wichtige Hintergrundinformationen zu vermitteln, was ihr Vater dann auch getan habe.
Über ihr Vorhaben, die familiäre Feldpost zum Mittelpunkt eines Publikations-Projekts zu machen, verliert die Journalistin jedoch kein Wort. Dabei hat sie zu diesem Zeitpunkt längst im Berliner Document Center eine Anfrage zu einer etwaigen NSDAP-Mitgliedschaft von Rudolf Schmitz gestellt und im damaligen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf dessen Entnazifizierungsakte eingesehen. Dadurch hatte sie die Gewissheit, dass die Angaben ihres Vaters, weder der NSDAP noch einer anderen NS-Organisation angehört zu haben, zutrafen.
In den sich nun anschließenden Gesprächen konfrontierte sie ihn dann mit den „klassischen“ Fragen der „Zweiten Generation“: Wie konntet ihr das glauben? Wie konntest Du schreiben, dass Gott den ‚Führer‘ schützt? Hast Du das wirklich geglaubt?“ Bei dieser Gelegenheit, so erzählt Dorothee Schmitz-Köster durchaus auch erleichtert, habe ihr Vater nicht nur bis dahin weitgehend Verdrängtes ausgesprochen, sondern sich erstmals auch gegenüber seinem damaligen Denken und Handeln distanziert und deutlich bekundet, dass er seinen „Glauben“ rückblickend auch nicht mehr verstehen könne. „Er ist ein deutliches Stück weggerückt davon.“
Man habe jedoch keineswegs nur über Politik gesprochen, sondern etwa auch über das Verhältnis zu den norwegischen Frauen. Bei der Erörterung solcher oft recht intimen Fragen habe er sich „sehr schwer getan“ und sie nie wirklich beantwortet.
Insbesondere konfrontierte die Tochter den Vater mit dessen Äußerung, dass der Krieg „die schönste Zeit seines Lebens“ gewesen sei. Sie könne das insbesondere mit Blick auf seine – nicht in Form von Briefen dokumentierte – Zeit an der Ostfront nicht nachvollziehen, woraus naturgemäß die Frage resultierte: „Was war da eigentlich?“ Erst dann, konkret angesprochen auf Angst und Tod, habe ihr Vater – allerdings immer noch sehr wenig – „von diesen grausamen Dingen erzählt“, etwa wie jemanden direkt neben ihm von einem Geschoss „der Kopf abgerissen wird“. Diese knappen Erzählungen von „Angst und Schrecken“, so beurteilt Dorothee Schmitz-Köster die Gesprächssituation, seien ihrem Vater sehr schwer gefallen.