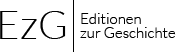Authentizität und Quellenwert
Über solche eher persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse hinaus stellt sich natürlich auch die Frage nach dem allgemeineren Quellenwert solcher Briefe. Was konnte, was durfte man schreiben? Was versuchte man den Adressaten eher zu verschweigen. „Ich konnte ihr doch nicht schildern, wie wir im Schützenloch liegen und der Kamerad neben mir ist getroffen“, habe ihr Vater mit Blick auf seine in Köln auf Post wartende Mutter seine damalige Zwickmühle umrissen.
Hier suchte und fand wohl jeder eigene Wege, um die jeweiligen Korrespondenzpartner zu informieren, ohne bei ihnen zu große Ängste auszulösen. „Wissen Sie, wie er das löst? Er schreibt: ‚Wir hatten schwere Tage.‘“ Es sei immer die überstandene Gefahr gewesen, die mit eher harmlosen Ausdrücken abgetan worden sei. Der Grad der Offenheit orientierte sich dabei zumeist an der subjektiven Einordnung der psychischen Belastbarkeit des Adressaten.
In einem aber ist sich Dorothee Schmitz-Köster jenseits aller notwendigen Quellenkritik aufgrund ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Nachlass ihres Vaters sicher: „Die Briefe eröffnen Möglichkeiten, die ein Gedächtnis, zumal ein verschlossenes, weit übertreffen.“ Bei allem Verschweigen oder Beschönigen sind sie immer noch weitaus authentischer als es eine Erinnerung Jahrzehnte später sein kann. Im Idealfall können sich dann Selbstzeugnisse und die rückblickenden Schilderungen von deren Verfassern ergänzen.
Aber auch die Fotos ihres Vaters aus der damaligen Zeit, so ergänzt Dorothee Schmitz-Köster, seien ihr hinsichtlich des Verständnisses der Briefinhalte eine große Hilfe gewesen. Daraus hätten sich Impressionen zu Personen und Landschaften entwickelt. Das sei ihr so wichtig gewesen, dass sie während der Abschlussarbeiten am Buch „Der Krieg meines Vaters“ nochmals nach Norwegen gefahren sei, um sich dort mit einem Lokalhistoriker zu treffen. Mit dem fuhr sie dann jene Orte ab, an denen die Fotos ihres Vaters aufgenommen worden waren. Ein anderer Bekannter habe ihr aktuelle Fotos von anderen Orten geschickt, an denen sich Rudolf Schmitz während seiner Zeit in Norwegen habe ablichten lassen. Die Fotos seien für sie als Visulisierung von großer Bedeutung gewesen. „Sie waren wie eine Verankerung oder Vergewisserung.“
Außerdem habe sie ihren Vater ja gar nicht als so jungen Menschen gekannt. Erst mittels der Bilder habe sie sich dessen damalige Jugendlichkeit vor Augen führen können. „Und so ist er ja in den Krieg gezogen!“ Mit Hilfe der Fotos habe sie es vielleicht auch ein Stück weit geschafft, seine damalige Begeisterung ansatzweise verstehen zu können.