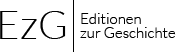Umgang mit den Briefen – „Ich bin total versunken in Omas Briefen.“
Ihre Mutter, so erzählt Stefanie Endemann, habe dann aber nach dem recht frühen Tod Ihres Mannes bereits Ende der 1970er-Jahre aus eigener Initiative damit begonnen, ihre eigenen Briefe mit fünf Durchschlägen abzutippen und in zwei Bänden binden zu lassen, von denen sie dann jedem ihrer Kinder ein Exemplar überreicht habe. Es sei für sie, so ergänzt Heidi Diehl, „eine große Überraschung“ gewesen, als ihr eines Tages die Brief-Bände mit der Bemerkung übergeben worden seien: „Das sind die Briefe, die ich Vater geschrieben habe“. Die Mutter, so mutmaßt sie, habe das für ihre Kinder getan, „weil es unsere Kindheit ist, weil es einfach wie ein Tagebuch ist“.
Ihre Schwester Stefanie ergänzt, dass ihre Mutter durch die Beschäftigung mit ihren Briefen nochmals tief in ihre eigene Vergangenheit eingetaucht sei. Zugleich sei ihr aber wohl auch bewusst gewesen, dass es sich dabei zudem „um ein schönes Stück Privatliteratur“ handele. Sie habe beim langwierigen Abtippen der Briefe „diese Zeit“ bestimmt noch einmal durchlebt.
Das Rezeptionsinteresse ihrer Kinder erfuhr allerdings dadurch einen erheblichen und nachhaltigen Dämpfer, dass die Durchschläge kaum leserlich sind. Das führte mit einem Abstand von vielen Jahren, ja Jahrzehnten im Endemann’schen Geschwisterrat schließlich zu dem Entschluss, diese Briefe der Mutter noch einmal neu und nunmehr gut lesbar aufzulegen.
Die dadurch intensivierte Beschäftigung mit dem Briefnachlass der Mutter führte jedoch auch zu einer für die Beteiligten unerwarteten Erkenntnis: Beim Abgleich der Abschrift der Mutter mit den Originalen entdeckten sie überraschende Abweichungen und Auslassungen. Weil das Projekt aber bereits kurz vor dem terminlich festgelegten Abschluss stand, reichte es nur noch zu einer Art „Schnelldurchgang“, in dem jene Passagen dem Original angepasst wurden, die direkt ins Auge fielen. Der Inhalt der übrigen Briefe von Charlotte Endemann wird dann im Zuge des hier präsentierten Editionsprojektes den ja ebenfalls einsehbaren Originalen weitgehend angeglichen.
Während die Feldpost-Briefe der Mutter so bereits recht früh Teil der innerfamiliären Wahrnehmung wurden, blieben jene des 1968 verstorbenen Vaters zunächst weiterhin unerwähnt und waren damit praktisch nicht existent. Sie habe sie wohl irgendwann in ihrer Jugend einmal gesehen, erinnert sich Stefanie Endemann vage, „aber dann nie mehr“. Man habe daher angenommen, dass diese Schriftstücke „unter die Räder gekommen“ seien. Erst nach der Fertigstellung der Edition der „Mutter-Briefe“ habe Bruder Jürgen das verloren geglaubte Material eher zufällig wiederentdeckt.
Die Geschwister Endemann können die Frage, warum ihre Mutter sich allein auf ihre eigenen Briefe konzentrierte und jene ihres Mannes Harald unberücksichtigt ließ, nicht schlüssig beantworten. Wahrscheinlich seien ihr die ca. 500 selbstverfassten Exemplare Arbeit genug gewesen, lautet eine der Mutmaßungen. Vielleicht habe sie die Briefe vom Fliegerhorst mit dem dortigen „Klein-Klein“ auch als nicht so interessant empfunden. Aber immerhin habe sie ja auch die „Vater-Briefe“ gesammelt und aufgehoben – und zwar zusammengerollt „als feste Walze mit allen möglichen anderen Briefen“.
Die Briefe von Harald Endemann, daran lässt Tochter Stefanie keinen Zweifel, wären ohne die Initiative des NS-Dokumentationszentrums „wahrscheinlich sang- und klanglos untergegangen“. Die Arbeiten an den Briefen der Mutter wären schon weitaus umfangreicher ausgefallen als zuvor geplant, sodass die Barriere für eine weitere Ausweitung des Vorhabens recht hoch gewesen sei. Hinzu kam, dass die Briefe des Vaters anders als jene von Charlotte Endemann großenteils handschriftlich verfasst und entsprechend schwer lesbar sind. „Das wollte ich mir und meinen Augen nicht antun.“
Als weiteren Grund für die zunächst doch recht ausgeprägte Zurückhaltung hinsichtlich einer intensiveren Beschäftigung mit dessen Briefen, gibt Stefanie Endemann an, dass ihr Vater nicht eben ein „großer Stilist“ gewesen sei. Außerdem seien die Inhalte im Vergleich mit den Schreiben der Mutter eben auch tatsächlich nicht so interessant gewesen. Im voll besetzten Hause Endemann in Godesberg sei damals eben immer etwas los gewesen, während die Erzählungen vom Fliegerhorst – so ergänzt Schwester Heidi – in erster Linie um Fragen gekreist wären, wer mit wem dort liiert sei. Auch die verschiedenen Klagen über Willkürhandlungen von Vorgesetzten und Gemeinheiten von Kameraden mögen ihr für die Kinder wenig relevant erschienen sein.
Die innerfamiliären Rückmeldungen der dritten, sprich der Enkelgeneration auf die Neuauflage der Feldpost-Briefe der Oma fielen laut Bericht von Stefanie Endemann sehr unterschiedlich aus. „Es gab Tränen der Rührung, es gab Rückmeldungen wie ‚Ich bin total versunken in Omas Briefen‘, und es gab auch welche von den zwölf Enkeln, die ‚Naja‘ gesagt und es weggestellt haben.“