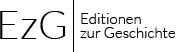Einflüsse
Sein Vater, so erinnerte sich Ernst Loewy später, habe sich stets als „guter Deutscher“ gefühlt und sei stolz darauf gewesen, am Ersten Weltkrieg teilgenommen zu haben, in dem er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war. Jede Form von „Hurrapatriotismus“ sei ihm allerdings fremd gewesen, und er habe immer wieder erklärt, „daß er sich glücklich fühle, nie einen Menschen getötet zu haben“. Das habe stets in gewissem Widerspruch dazu gestanden, dass sein Vater ihm gegenüber die soldatischen Tugenden gerne pries. Dennoch ließ er offenbar zugleich erkennen, das der Militarismus nicht seinem eigentlichen Weltbild entsprach, was auf ihn selbst, so Ernst Loewy, durchaus beruhigend gewirkt habe. Später habe er in nachgelassenen Papieren seines Vaters dann tatsächlich erfahren, dass der kein ausgeprägter Anhänger soldatischer Tugenden gewesen sei.
Politisch scheint Richard Loewy zur Sozialdemokratie tendiert zu haben. Jedenfalls erinnerte sich sein Sohn später, sein Vater habe, jedenfalls so viel er wisse, immer SPD gewählt. Eine eher sozialdemokratische Einstellung leitete er auch daraus ab, dass in der Wohnung am Nordwall 117 stets eine Sammelbüchse des zionistisch orientierten Jüdischen Nationalfonds gestanden habe, „die mehrmals im Jahre geleert wurde und deren Inhalt dem Aufbau Palästinas zugutekommen sollte“.[9] Eine „politische Dimension“ im engeren Sinne spielte im Familienleben der Loewys jedoch augenscheinlich keine Rolle. „Anständigkeit“ gegenüber den Mitmenschen habe als Maxime gegolten, Lügen seien verpönt gewesen. „Sich im Streit zu schlagen oder sich zu betrinken, galt als roh. Die Tiefen oder die Untiefen des eigenen Daseins blieben unausgesprochen.“
Jüdisches Leben im engeren Sinne fand im Hause Loewy offensichtlich eher in „säkularisierter Form“ statt, so dass es hier - von der Art der Religionsausübung abgesehen - ähnlich zugegangen sei, wie in nichtjüdischen Familien. Die „jüdischen Bräuche“ seien daher in dem kleinbürgerlichen Umfeld seiner Kindheit „nur noch locker gehandhabt“ praktiziert worden. „Die Einhaltung der Speisegesetze beschränkte sich darauf, Schweinefleisch zu meiden, es mit dem Schinken jedoch weniger genau zu nehmen. Samstägliche Synagogenbesuche gab es gelegentlich. An Feiertagen, insbesondere den hohen, waren sie die Regel. Mein Vater trug dann einen schwarzen Zylinder. Hebräisch lernte ich soweit, daß ich die Buchstaben entziffern und die Wörter lesen konnte. Verstehen mußte ich sie nicht. Der gut gefüllte Bücherschrank im sogenannten Herrenzimmer gab kaum einen Hinweis darauf, daß er einer jüdischen Familie gehörte."
Ernst Loewy erlebte seinen Vater als streng und bestimmend. Er, der sich als „reisender Kaufmann“ immer nur an den Wochenenden bei der Familie in Krefeld aufhielt, habe etwas „Herrisches“ an sich gehabt und - weder von ihm als Sohn noch von Seiten seiner Mutter - Widerspruch geduldet. Zugleich folgte er einem zeitgemäßen Erziehungsideal: „‚Schneid‘ zeichnete seines Erachtens den Mann aus und gehörte gewiß auch zu dem Bild des Deutschen, das er sich machte.“ Daher sei es eine „bittere Enttäuschung“ für ihn gewesen, als Ernst sich nicht anschickte in dieser Hinsicht seinen Vorstellungen zu folgen, sondern sich „vielmehr eher an meinem Großvater orientierte, der — klein, aber durch seinen Bart martialisch wirkend — sein Leben lang überzeugter Zivilist gewesen war und als ‚Stubenhocker‘ von meinem Vater verachtet wurde.“ Bei allen Kontroversen und damit verknüpfter Kritik hielt Ernst Loewy seinem Vater aber zeitlebens zugute, „daß er auch in den schwersten Zeiten unseres Lebens nie den Mut verlor“ und selbst unter schwierigsten Umständen stets getan habe, „was er für seine Pflicht gehalten hat, nämlich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften unsere Existenz zu sichern“.
Das „einfühlende Verhalten“ seines Großvaters stand ebenso wie das „unaufdringliche und doch prägende Laissez-faire“ seiner Mutter im Empfinden von Ernst Loewy stets „in starkem Kontrast zu den väterlichen Zwängen“. „Den Widerspruch auszuhalten zwischen dem von Mutter und Großeltern bestimmten Familienalltag und den vom Vater ‚pädagogisch‘ genutzten Wochenenden war freilich schwer und bot dem Heranwachsenden reichlichen und ihn nachhaltig prägenden Konfliktstoff.“
Hinzu gesellte sich noch der Einfluss vom heiß verehrten, in Berlin lebenden Onkel Errell, dem Bruder der Mutter, der für den in der niederrheinischen Provinzstadt aufwachsenden Ernst das Gegenbild der „großen Welt“ verkörperte.[10] Am 7. Februar 1899 als Richard Levy in Krefeld geboren, hatte es den jungen Mann nach einer von 1915 bis 1918 in Düsseldorf absolvierten Ausbildung zum Dekorateur nach Zwischenstationen in Saarbrücken (1921-23) und Köln (1923-25) für kurze Zeit nach Paris verschlagen. Nach seiner Hochzeit mit der Schriftstellerin und Fotografin Lotte Rosenberg 1926 übersiedelte das Paar noch im gleichen Jahr nach Berlin, wo Richard Levy, der seit 1927 seinen Künstlernamen „Errell“ als offiziellen Namen tragen durfte, zunächst als Werbeleiter der Textilfirma Fischer, Maas & Kappauf arbeitete. Er entwickelte sich zu einem Pionier der modernen Werbegrafik, die er um das Stilmittel der Fotomontage bereicherte. Außerdem nahm er als freier Fotograf an den großen Ausstellungen der Zeit teil. 1933 emigrierte Errell nach Prag und ließ sich 1937 in Tel Aviv nieder. Seit 1960 lebte er in der Schweiz, wo er 1992 in Locarno starb.[11]
[9] Loewy, Jude, S. 20ff. Dort auch das Folgende.
[10] Vgl. Loewy, Jude, S. 23.
[11] Vgl. https://www.hohenemsgenealogie.at/gen/getperson.php?personID=I9652&tree=Hohenems