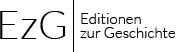Kommentar Ernst Loewy
Für die 1997 von Brita Eckert besorgte Teiledition seiner Briefe der Jahre 1936 bis 1938 setzte sich Ernst Loewy selbst nochmals schriftlich intensiv mit der bewegten Geschichte seiner Jugend auseinander.[1] Dieser Text ist hier - bis auf Anpassungen an die neue Rechtschreibung - textidentische wiedergegeben.
I.
Der Autor der vorliegenden Briefe hatte sich lange Zeit verweigert, den Zeugnissen seiner Jugend überhaupt noch einmal zu begegnen.[1] Er empfand, erwachsen geworden, diese als ihm selbst kaum noch zugehörig. Ja, nur wenige Jahre, nachdem sie geschrieben worden waren, schienen sie ihm wie durch eine Sintflut von seiner Person getrennt. Trotz zahlreicher Umzüge in seinem Leben, nicht zuletzt seiner Remigration von Israel nach Deutschland im Jahre 1956, bei denen er des öfteren das umfangreiche Konvolut des Briefwechsels, welchen er'zwischen 1936 und 1938 aus Palästina mit seinen noch in Deutschland verbliebenen Eltern geführt hatte, in den Händen hielt, hatte ihn dieser nicht weiter interessiert. Vor einem Dutzendjahren erinnerte er sich der Briefe aus Anlaß der Vorbereitungen für die Ausstellung über die „Vertreibung der Juden aus Deutschland“, welche das Exilarchiv der Deutschen Bibliothek in Angriff genommen hatte. Brita Eckert, die für die Ausstellung verantwortlich war, suchte noch nach geeigneten Objekten für Ausstellung und Katalog. Sie war es schließlich, die ihn unter Hinweis auf den angeblich dokumentarischen Charakter der Briefe animierte, sie auch für diesen Band zur Verfügung zu stellen. Der Briefeschreiber war damit einverstanden, blieb jedoch seinem Vorsatz insoweit treu, als er sich persönlich hier nicht engagieren mochte, sich tatsächlich auch an der Auswahl der Briefe nicht beteiligte. Es blieb dabei, solange noch kein maschinenschriftliches Manuskript erstellt war, welches dann allerdings gebieterisch danach verlangte, vom Schreiber zur Kenntnis genommen zu werden. Im übrigen war es auch an der Zeit, allfällige Fragen der Herausgeberin zu beantworten, soweit sie sich auf Details und Personen bezogen, und Hebraismen ins Deutsche zu übersetzen. Auf diese Weise nahm er die Briefe erst fast sechzig Jahre nach ihrem Entstehen auch inhaltlich zur Kenntnis. Sie stellten ihn vor eine Vielzahl selbstkritischer Fragen. Ja, in vieler Hinsicht erschreckten sie ihn.
Daß es sich hier um Jugendbriefe handelte, war ihm natürlich immer bewußt, und auch, daß es die Jahre der Pubertät waren, die er in der Rückschau nun nicht mehr ganz so ernst zu nehmen brauchte. Doch waren es auch Lebenszeugnisse eines jungen Menschen, der eben seine Heimat verlassen hatte, und sehr bald des jungen Mannes, der sich als Zeitgenosse einer Katastrophe der menschlichen Zivilisation zu definieren gelernt hatte. Gleichzeitig mußte er diese Jahre als einen Bruch in seiner Persönlichkeitsentwicklung empfunden haben, gemindert allein dadurch, daß das Schlimmste erst noch bevorstand und, als es eintrat, es sich auch nicht vor seinen Augen abspielte. Es traf ihn, vor allem aber Rega, seine spätere Frau, so wie es viele unserer Zeit- und Schicksalsgenossen traf, unversehens doch kaum unerwartet, aus der Ferne. Jeder Brief, der Unsereinen damals erreichte, konnte die böse, doch nicht mehr aufzuhaltende Botschaft enthalten. Am Ende war es dann die schlimmstmögliche: Regas Vater, den ich nie meinen Schwiegervater habe nennen können, war durch Einsatzkommandos in der Nähe von Lemberg ermordet worden. Es war gegen Ende 1941.
Die Konfrontation mit dem Schrecken, sie war allgegenwärtig, wir brauchten sie nicht zu suchen. Das harmlose „Wegstecken“ der Briefe, ihres Autors Scheu vor ihnen, mochte daraus resultieren, daß sich ihre Naivität vor der Macht des realen Geschehens bald als unangemessen erwies. Doch gehörte auch dieses Phänomen zur Geschichte! Wiewohl der Autor vom „Holocaust“ - ein Begriff, der übrigens erst wesentlich später zum geläufigen Terminus für den millionenfachen Massenmord an den Juden Europas wurde - nicht unmittelbar erfuhr, hatte er diesen Vorgang für sich schon längst als „Sintflut“ bezeichnet, welche sein Leben in zwei Stücke zerriß und alles damit Zusammenhängende affektiv besetzt hielt.
Damit hatte sich bei ihm, ähnlich wie bei vielen anderen, ein Verdrängungsmechanismus durchgesetzt, wie er bereits seit Jahren in der Sozialpsychologie, bekannt als „Überlebensschuld“, diskutiert worden ist. Der Autor, der - im Widerspruch zu seinem Vorhaben - sich die Briefe vor der Fertigstellung des Buchmanuskriptes nun schließlich doch ansah, befand sich plötzlich wie auf vermintem Gelände. Mit einem Mal sah er sich deutlich Schuldgefühlen ausgesetzt, die ihn zeit seines Lebens stumm begleiteten. Er sah sich wieder in der Situation jenes schmächtigen jungen Mannes, der im Juli 1942 als Freiwilliger vor dem britischen Rekrutierungsoffizier im Militärlager Sara-fand im Mandatsland Palästina mit einiger Erleichterung vernahm, daß man ihn für die kämpfende Truppe als nicht geeignet empfand. In der Tat eher der Typ des Antisoldaten, wurde er ohne weitere Untersuchung ausgemustert.
Er atmete auf, konnte mit dieser Tatsache aber auch nicht wirklich froh werden und trug sie wie einen Makel, wenn auch sprachlos, für Jahrzehnte mit sich herum. Daß er als Zivilangestellter bei der britischen Armee in der Nähe bzw. in Tel Aviv gearbeitet hatte, hat seinem Gewissen nur unwesentliche Erleichterung gebracht. Die Tätigkeit selbst unterschied sich nur wenig von der eines Großteils der Soldaten in einer modernen Armee: sie wird in der Etappe geleistet. Vor allem aber konnte ich zu Hause wohnen, brauchte meine Frau nicht zu verlassen. Vom Krieg im engeren Sinne wurden wir verschont: Das deutsche Afrika-Korps unter Rommel wurde in der Wüste zum Stehen gebracht. Hätten die Deutschen den Suez-Kanal überqueren können, so hätte dies vermutlich auch uns das Leben gekostet. So waren wir nur einmal Zeugen eines deutschen Luftangriffes auf Tel Aviv. Er hatte vielen Menschen, darunter auch Bekannten, den Tod gebracht.
II.
Als Autor der Briefe wußte ich, daß hier kein Heldenleben zu dokumentieren sein würde. Ich war allem Militärischen von Grund aus abhold, wenn man so will: der geborene Zivilist. Einziger Sohn eines autoritären Vaters und einer sanften Mutter, fand ich mich unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt, die nicht nur meine Kindheit bestimmten. Im Widerspruch zu vielen hier abgedruckten Briefstellen war mein Verhältnis zum Vater im Grunde ein eher gespanntes, wenn auch gemildert durch die Entfernung: eine Unterwerfung des Jungen unter die in der Familie tonangebende Person. Geschwister hatte ich nicht, mit denen ich mich hätte verbünden oder an denen ich mich hätte abarbeiten können. Die Mutter führte ihr gütiges Regiment ungestört in jenen regelmäßigen, doch kurzen Zeiten einer durch Außendienst bedingten väterlichen Abwesenheit. Die neue Umgebung, in der ich mich wiederfand, war völlig anders. Die Rede ist von dem Kibbuz, der mich aufgenommen hatte, und zwar für zwei Jahre, in eine Art von Internat - zusammen mit etwa 30 gleichaltrigen Jugendlichen aus Deutschland, darunter weniger als einem Drittel Mädchen. Die wenigsten waren als Einzelkinder aufgewachsen. Sich zu behaupten war für den „geborenen“ Einzelgänger schwer. Es dauerte etwa ein Jahr, bis ich mich „freigeschwommen“, mir eigene Meinungen zu eigen gemacht, mich dabei auch von zu Hause abgenabelt hatte.
Unabhängig von der Entwicklung, die ich genommen hatte bzw. hatte nehmen müssen, trat mir die den Eltern in Deutschland drohende Existenzvernichtung immer mehr vor Augen, drängten die väterlichen Briefe mich immer häufiger, den Eltern zu einer Einreisemöglichkeit nach Palästina zu verhelfen, was objektiv nicht machbar war. Sie hätten legal als „Kapitalisten“, was sie jedoch nicht waren, oder auf ein Arbeiter-Zertifikat einreisen können, auf welches sie keinen Anspruch hatten, oder Eltern von finanziell abgesicherten Kindern sein müssen. Letzteres war insoweit ein Wunschtraum, als ich noch nicht einmal auf eigenen Füßen stand, sondern mein Dasein im Kibbuz rechtlich als Ausbildung angesehen wurde, welche von den Eltern auf zwei Jahre alimentiert wurde. Mir waren die Hände gebunden. Dies den Eltern auf dem Korrespondenzweg klarzumachen, kostete mich von Monat zu Monat größere Mühe. Auch ein Besuch des Vaters Mitte 1937 konnte die Lage nicht ändern. Mit der Verschärfung der Situation in Deutschland wurde seine Sprache immer flehentlicher. Von eigenen Problemen geplagt, ohne Mittel und ohne Beziehungen, konnte ich nichts als ein paar billige Ratschläge geben und ansonsten die Härte der Tatsachen zum Ausdruck bringen. Die Briefe, die ich damals nach Hause geschrieben hatte, müssen mir schwergefallen und nicht ganz ohne Schuldgefühle abgefaßt worden sein. Später fragte ich mich, ob ich anders hätte handeln können, wenn ich gewußt hätte, was meine Eltern in Deutschland erwartete.
Unvorstellbar allerdings, daß all dies nicht auch so seine Narben hinterlassen hat. Meinen Eltern ist es buchstäblich am Ende, unmittelbar nach der „Kristallnacht“, gelungen, aus Deutschland zu entkommen, ohne mein Zutun, mit einem Touristenvisum für Palästina. Anscheinend wußten nur wenige von dieser Möglichkeit. Sie setzte voraus, daß man sein Hab und Gut zurückließ, nur 20 Reichsmark und Handgepäck bei sich hatte und beim Konsul der britischen Majestät 1 000 Mark pro Kopf hinterlegte. Diese Bedingungen waren erfüllt: Die Passage war bereits bezahlt, so konnten die Eltern einreisen, und zwar legal. Nach Ablauf des Visums war allerdings ihr legaler Status zu Ende, aber danach fragte im seinerzeitigen Palästina keiner mehr. Nachzutragen wäre hier, daß allein auf diese Weise mein Vater von der Pogromnacht verschont blieb: Paß und Ausreisevisum lagen nämlich bereits bei der Krefelder Polizei zum Abholen bereit, als am 10. November 1938 die jüdischen Männer Krefelds verhaftet und nach Dachau verbracht wurden. Da mein Vater sich danach nicht mehr aus dem Haus wagte, holte meine Mutter die Pässe bei der Polizei ab. Die Eltern verließen Krefeld unbehelligt wenige Tage früher, als sie es ohnehin zu tun beabsichtigt hatten.
Stand dieses Thema auch im Mittelpunkt der späteren Briefe, so ging es in ihnen notwendigerweise auch immer wieder um meine eigene Zukunft und um die Zukunft der Gruppe. War diese doch angetreten unter dem Gedanken, sich nach Ablauf von zwei Jahren gemeinsam als „Kern“ eines neuen Kibbuz zu etablieren oder sich mit anderen Gruppen dieser Art zum gleichen Zweck zusammenzutun. Ich persönlich hatte eigene Vorstellungen, wenn auch nur sehr vage, von meiner Zukunft, die ich mit Zähigkeit durchzusetzen versuchte. Vergleichbares widerfuhr freilich auch anderen Mitgliedern der Gruppe, aus der als solcher sich nur auf schmaler Ebene ein kleiner Kern herauskristallisierte, der zusammenzubleiben beabsichtigte. Die meisten ihrer Mitglieder zerstreuten sich in alle Winde. Ist also im Sinne der Absichten, unter denen sie angetreten war, nur ein geringer Ertrag zu vermelden, so hat doch eine Reihe von Mitgliedern es verstanden, aus ihrem Leben etwas zu machen, wenn auch nicht das, was den ursprünglichen Zielen einer dauerhaften Lebensgemeinschaft, die auf gemeinsamer Arbeit und gemeinsamem Eigentum beruhte, entsprach.
Wir alle haben sicher zu diesem oder jenem der „Chawerim“ von damals Kontakt gehalten. Auch wurden einige „Klassentreffen“ organisiert, deren Zulauf durch die zum Teil weiten Entfernungen sich im Lauf der Jahre vermindert hatte. Zum 50. Jahrestag fand sich eine Mehrzahl der alten Genossen noch einmal ein. Es waren schöne Begegnungen an diesem Tage darunter, doch auch farblose. Freilich: Geschichte zerfloß hier zu Geschichten. Man kann Geschichte eben nicht wieder zum Leben erwecken. Echte Freundschaften werden durch dergleichen allerdings kaum tangiert, sie bestehen, wenn es denn welche sind, ohnehin weiter fort.
Auf dem Hintergrund einer historischen Entwicklung, die ich einmal von der sog. Kristallnacht an datieren möchte, bewegten wir uns - jeder für sich und alle zusammen -auf einem immer stärker erodierenden Gelände. Die in der Folge des Novemberpogroms an den Küsten Palästinas (und nicht nur dort) Gestrandeten zeigten deutlich das Kommen einer Zeit an, die mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs dann mit der äußersten Gewalt hereinbrach, auch wenn wir uns nicht im Epizentrum des Geschehens bewegten: Betroffen waren wir alle davon, wieviel oder wie wenig wir uns persönlich davon Rechenschaft gaben. Es war nicht unser Verdienst, die wir nur an seinem Rande lebten, daß wir nicht - wie Millionen andere - von ihm zermalmt wurden. Denn gemeint waren auch wir. Es gehörte zu den eigentümlichsten Paradoxien unserer Zeit, daß das Leben auch im Angesicht dieses Grauens überhaupt weiterlief und daß ich wie viele von uns erst Jahrzehnte später der Fragwürdigkeit von „Normalität“ im Zeitalter oder im Schatten des Holocaust gewahr wurde.
III.
Festzuhalten bleibt freilich, daß das Gefühl von Schuld, welches die am Leben Gebliebenen gegenüber den Toten, in dieser oder jener Weise, unbewußt oder bewußt, ja gelegentlich auf selbstzerstörerische Weise bewahrten, nicht aufhörte, sich einen Ausdruck zu suchen. Vor allem waren es die Gegenbilder, wie etwa der Zionismus, Sozialismus, Kommunismus, zu denen man sich flüchtete, wenn man die zumeist nur vorgestellten bzw. aus zweiter Hand erfahrenen Schrecken der eben verflossenen Zeit nicht ertragen konnte. Es war allein der Glaube an eine andere, eine bessere Zukunft, die einem die Gegenwart ertragen half, zumal wenn die eigenen Auseinandersetzungen mit dieser an den Zwang zu einem noch darzubringenden Opfer gebunden waren, als Sühne gleichsam für das beizeiten nicht Geleistete. Rufe wie „Nie wieder Antisemitismus“, „Nie wieder Faschismus“, „Nie wieder Kapitalismus“, „Nie wieder Krieg“ waren ein Gelübde, das dem millionenfachen Sterben nachträglich noch eine Art Sinn unterlegen sollte, wo es doch an erster Stelle das eigene Gewissen zu beruhigen trachtete. Je größer diese Anstrengung war, desto häufiger lauerte dahinter die Gefahr des Scheiterns. Auschwitz ist mit nichts aufzurechnen, wenn auch keine Anstrengung zu groß sein kann, es in der Erinnerung zu bewahren. Es bleibt das Kainszeichen der Geschichte, welches, gerade wenn man für ihre „Vermenschlichung“ eintritt, nicht getilgt werden kann. Was einmal geschah, könnte auch ein weiteres Mal geschehen. Die Errungenschaften, der Besitz und die Fortentwicklung unserer demokratischen Institutionen werden nur im Bewußtsein ihrer Fragilität zu verteidigen sein. Es wäre unsere Stärke, wenn wir uns - vor allem angesichts der atemberaubenden technischen Triumphe der Zeit - dessen gewahr blieben und dementsprechend handelten.
Erinnerung, nicht zuletzt an die tausendfachen Unterlassungen, die das Geschick unseres Jahrhunderts bestimmt haben, prägt jemanden, der es bereits seit 75 Jahren begleitet und welcher ebenso von dessen Größe wie von dessen Erbärmlichkeit überzeugt ist. Er wird sich freilich hüten, von den Menschen mehr zu erwarten als von sich selbst. Aber auch nicht weniger, als sie zu geben vermögen. Hieße das nicht auch, immer wieder die Chancen zu erkunden, um für die gegenüber dem technischen Fortschritt so sehr ins Hintertreffen geratene Humanitas neuen Boden zu gewinnen? Und zwar nicht nur in der Gelehr-ten-Republik, sondern vor allem auch unter den profanen Umständen, die unser politisches und gesellschaftliches Leben beherrschen. Ohne dem verlöre menschliches Leben auf Dauer nicht nur seinen Sinn, sondern auch seine Existenz. Doch bleibt dies wohl, frei nach Brecht, das Einfache, das so schwer zu machen ist.
[1] Dieser als „Nachwort“ bezeichnete Text ist abgedruckt in Loewy, Jugend, S. 220ff.