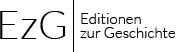Im Kibbuz
Noch am Tag der Ankunft in Haifa fuhren die Jugendlichen nach Kirjat Anavim weiter, einer kleinen, als „Kwuzah“ bezeichneten landwirtschaftlichen Gemeinschaftssiedlung mit rund 150 Bewohner*innen in der Nähe von Jerusalem im judäischen Gebirge. Kirjat Anavim war im Jahre 1920 von Einwanderern aus Kamenez Podolsk in der Ukraine gegründet worden. Zu den zunächst etwa 40 Jüdinnen und Juden waren bis 1934 etwa 35 Einwanderer aus Polen und 1935 unter anderem auch acht aus Deutschland hinzugekommen. In dieser für sie völlig ungewohnten, kargen und fremden Umgebung wurden die Jugendlichen für die folgenden zwei Jahre untergebracht, ausgebildet und unterrichtet. „Unsere Gruppe lebte dort — noch auf Kosten der Eltern — in einer Art von Internat, in dem wir vier Stunden am Tage zu arbeiten hatten und weitere vier Stunden mit Lernen verbrachten. Der Unterricht sollte uns mit der Sprache, der Geographie und der Geschichte des Landes vertraut machen.“
Politisch stand der Kibbuz im Übrigen voll auf dem rechten Flügel der herrschenden Sozialdemokratie (Mapai). Revolutionäre und internationalistische Vorstellungen, wie man etwa sie in den linksorientierten marxistischen Kibbuzim des Haschomer Hazair vorfand, waren hier völlig fremd.[15] Sozialistisch orientiert war er allerdings insofern, als dass sich hier — wie in den Kibbuzim aller Richtungen — eine neue gemeinschaftliche Lebensform etabliert hatte, die auf Solidarität und nicht auf persönlichem Gewinn basierte.
Diese neue Orientierung musste insbesondere die zumeist aus bürgerlichem Haus stammenden Neuankömmlinge tief beeindrucken. Die damit einhergehende „innere Verselbständigung“ und das damit eng verbundene „intellektuelle Erwachen“ setzten nach dem Empfinden von Ernst Loewy „sehr plötzlich und unvermittelt ein“, wobei erschwerend hinzugekommen sei, dass sich das alles in einer Umwelt abgespielt habe, „auf die ich kaum vorbereitet war“. Er war aber wohl nicht nur unvorbereitet, sondern die Lebensform „Kibbuz“ war ganz einfach nicht die seine, so dass er sich ihr so weit wie eben möglich entzog. „Wichtiger für meine Entwicklung war die Begegnung mit einigen in die gleiche Siedlung verschlagenen Intellektuellen.“
„Den Kibbuz als Lebensform voll zu würdigen und ihn trotz all seiner Krisen als bedeutsame Errungenschaft der Sozialgeschichte einzustufen“, gelang Ernst Loewy erst unter den Bedingungen, „denen mein Leben unterworfen war, nachdem ich den Kibbuz verlassen hatte“. Erst nach dem Novemberpogrom in Deutschland und dessen Folgen hätten sich die Verhältnisse in Palästina so entwickelt, dass ihm seine Jahre in Kirjat Anavim in der Rückschau „als ein Leben in paradiesischer Unschuld erscheinen“ würden. Der nun einsetzende Strom an legalen und immer zahlreicher werdenden illegalen Flüchtlingen habe Tausende von Menschen ohne jegliche Mittel ins Land geschwemmt. Im Zuge dieser Entwicklung griff die Not nun auch auf das Leben von Ernst Loewy über: „Die Zahlungen aus Deutschland waren eingestellt. Dafür hätte ich von meinem knappen Lehrgeld jetzt auch meine Eltern miternähren müssen, was völlig unmöglich war.“
Im Sommer besuchte Richard Loewy seinen Sohn in Palästina. Sein Hauptaugenmerk lag dabei, neben dem Wiedersehen, wohl auf einer Begutachtung der dortigen Lebensumstände. Den Loewys war zunehmend klarer geworden, dass es für sie keine Zukunft in Deutschland gab und der am einfachsten gangbare Weg auch sie nach Palästina führen würde. Daher nahm Richard Loewy im Rahmen des Besuches die Perspektiven in Augenschein, die seiner Frau Erna und ihm - beide nicht mehr jung an Jahren - das dortige Leben eröffnen würden. Danach kehrte er offenbar zufrieden zur weiteren Vorbereitung der Emigration zunächst nach Deutschland zurück.
[15] Vgl. Loewy, Jude, S. 24f. Dort, S. 24ff., auch das Folgende.