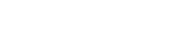Christentum und Drittes Reich
Diese Schallplatte mit dem Titel „Christentum und Drittes Reich“ wurde am 9. Juli 1935 im Raum VII der Studios der Deutschen Grammophon in der Lützowstr. 111 in Berlin aufgenommen. (Matrizennummer 288 und 299 - GO/DG). Veröffentlicht wurde sie auf dem Weißlabel der „Polydor“.
Sprecher ist Dr. Karl Megerle[1], Referent in der Auslandsabteilung des Reichspropagandaministeriums.
Man höre, so Megerle, aus dem Ausland vielfach Stimmen der Besorgnis über das Schicksal des Christentums im Dritten Reich. Hierzu sei festzustellen, dass der Nationalsozialismus bei der Machtübernahme nicht eben ein „blühendes Christentum“ angetroffen habe. Die großstädtischen Kirchen seien zumeist leer geblieben, und neben der „Gottlosigkeit des Marxismus“ habe eine „achselzuckende Gleichgültigkeit“ dominiert. Das Christentum in Deutschland und dessen Kirchen hätten seinerzeit kaum noch eine „gemeinschaftsbildende Kraft“ entwickelt. Die NS-Weltanschauung, deren „innerster Kern“ das „Erlebnis der Gemeinschaft“ sei, habe in dieser Hinsicht daher lediglich einen „nur teilweise bestellten Acker“ vorgefunden. Danach habe das NS-Regime der deutschen Bevölkerung dann aber vermittelt, wer der Nächste sei. Dass dies nicht ein „farbloser Irgendwer“ in einem „Land Irgendwo“, sondern der deutsche „Volksgenosse“ sei, sei die praktische Voraussetzung, aus der auch der Begriff des „Nächsten“ wieder „Blut und Leben“ finden könne. Zudem habe das NS-Regime ein Land vorgefunden, in dem während des Weltkrieges Millionen von „Kämpfern“ die christlichen Wahrheiten einer Prüfung unterzogen hätten. Schließlich sei den Deutschen 1918 dann im Namen der Christlichkeit ein Frieden aufgezwungen worden, der „jenseits der christlichen Verantwortlichkeit der Sieger „ gelegen habe.
Als „revolutionäre Bewegung“ habe der Nationalsozialismus auch das Christentum mit einer neuen Lage konfrontiert, was „im Wesen jeder echten Revolution“ liege. Anders als etwa die Französische Revolution habe sich jene des Jahres 1933 in Deutschland jedoch nie in die Substanz des christlichen Lebens eingemischt. Das Verhältnis des Dritten Reiches zum Christentum und seinen Kirchen erhalte seine zentrale Bedeutung aus seiner Aufgabe, die nationale und soziale Einheit zu schaffen. In anderen Ländern habe man mit dem Schwert um die Einheit des Glaubens gerungen, was nie ohne Gewalt, Blut und Grausamkeit abgelaufen sei.
Deutschland sei dreißig Jahre Schauplatz eines „Glaubenskrieges“ gewesen, in dessen Folge die politische Spaltung des Reiches für rund 250 Jahre zementiert worden sei. Solche Erfahrungen würden nunmehr „im Blut“ sitzen und misstrauisch machen. Gerade unter solchen Umständen käme der weltanschaulichen Geschlossenheit große Bedeutung zu. „Die Frage der inneren und äußeren Einheit der Nation ist für uns eine Frage von Leben und Tod, der wir jede andere Frage unterordnen.“ Und: „Wir sind als Christen dabei auch der Zuversicht, dass der Dienst an der Volksgemeinschaft ein Gottesdienst ist, der einst vor dem Höchsten bestehen kann.“
Die Aufnahme hat eine Dauer von 8:49 Minuten.
[1] Der 1894 geborene Megerle hatte Geschichte, Germanistik, Philosophie und Staatswissenschaften studiert und war im Februar 1922 zum Dr. phil. promoviert worden. Zunächst in der Schulaufsicht und als Journalist tätig, trat er zum 1. Mai 1933 der NSDAP bei und wurde im Oktober 1934 Referent der Auslandsabteilung im Reichspropagandaministerium, wo er zunächst Sonderaufträge zur Politik des NS-Regimes gegenüber Österreich erhielt. Ab 1938 war er auch für das Außenministerium tätig, wo er sich als Kriegspropagandist betätigte. Zudem war er von 1938 bis 1945 Mitglied des Reichstags.