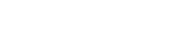Zum Muttertag
Das NS-Regime passte auch den „Muttertag“ in sein ideologisches Gerüst ein und erhob den bis dahin lediglich rovat begangenen Tag im Mai 1934 als "Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter" zum offiziellen Staatsfeiertag und integrierte ihn in den NS-Festtagskalender.
An diesen neuen Feiertag wurde nunmehr stets das völkische und rassenideologische Element von Mutterschaft betont und der Tag damit zum Bestandteil der NS-Bevölkerungspolitik. „Heilig soll uns sein jede Mutter deutschen Blutes“, lautete einer der dabei verbreiteten Propagandasprüche. Besonders kinderreiche Mütter wurden als Heldinnen gefeiert, die für das Fortbestehen der „Ahnenreihe des deutschen Blutes“ Sorge tragen würden. Das führte 1939 schließlich zur Einführung des in den Stufen Bronze, Silber und Gold verliehenen „Mutterkreuzes“.
Der Festtag wurde propagandistisch groß aufgezogen. Propagandaminister Joseph Goebbels ließ Musteransprachen, Gedichte und Reden zum Muttertag entwickeln und über die Sender des Reichsrundfunks wurden entsprechende Reden von NS-Größen übertragen, in denen immer wieder von der „Ehrfurcht des Führers vor der deutschen Mutter und Frau“ fabuliert wurde. Dabei war immer wieder die Rede von „biologischer Pflichterfüllung“ und der „Pflicht der deutschen Mutter“, möglichst viele gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Letztlich aber, auch das wurde nicht vergessen zu betonen, müssten Mütter auch stets bereit sein, das „Leben des geliebten Sohnes“ hinzugeben, wenn das Vaterland ihn zu den Waffen rufe. Hitler selbst erklärte die Mutterschaft zum „Schlachtfeld der Frau“.
Aus solchen Versatzstücken setzen sich auch auf die beiden hier präsentierten Ansprachen zusammen, die am 12. Mai 1938 aufgenommen und drei Tage später im Radio zu hören waren. Sie wurden zudem auf Schallplatten gepresst und unter dem Weißlabel der „Polydor“ verbreitet.
Die Rede „Zum Muttertag“ von Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink[1] (Matrizennummern 45735 und 45736) strotzte vor solchen Floskeln. „Aus der Liebe der Mütter steigt die Kraft im Kampf“, heißt es etwa. Weiter wird betont, dass „die mütterlichen Kräfte des Hegens und Pflegens“ den „Weg eines Volkes“ immer entscheidend mitgestalten würden. Das habe auch und besonders in den Jahren des Ersten Weltkriegs gegolten, als „die deutsche Mutter“ hinter der Front standen habe, wo sie ihre Angehörigen geopfert und zugleich die Männer ersetzet hätte. „Sie kämpften um die Existenz der Familie, während die Männer um die Existenz des Volkes kämpften.“ Gerade die Mütter jener Jahre, die bereit gewesen seien, ihr Leben für ihr Volk herzugeben. würden „den jungen Müttern stets Vorbild sein“.
Der Nationalsozialismus habe „zur göttlichen Urkraft, die uns alle erhält“ zurückgefunden. „Die Mutter ist ein heiliges Gleichnis, der sich ewig verjüngenden Volkskraft.“ Das deutsche Volk sei nach Kriegsende 14 Jahre lang „immer stiller und mutloser“ geworden, bis „unser Führer“ in ihm den „Lebenswillen wieder geweckt“ habe. „So wie wir über unsere Kinder wachen, wacht der Führer über unser Volk. Mutter sein, heißt in Sorgen glücklich sein.“
Die Aufnahme hat eine Gesamtdauer von 7:54 Minuten.
[1] Die spätere Gertrud Scholtz-Klink wurde am 2. Februar 1902 in Adelsheim/Baden geboren und auf den Namen Gertrud Emma Treusch evangelisch getauft. Sie verließ das Gymnasium in Moosbach mit der Mittleren Reife, heiratete mit 19 Jahren den Lehrer Eugen Klink und brachte vier Kinder zur Welt. Ihr Mann war Mitglied der SA und agitierte im Kreis Offenburg für die NSDAP. Gemeinsam trat das Ehepaar am 1. März 1930 in die Partei ein, doch wenige Tage später verstarb Eugen Klink bei einer Wahlkampfrede durch Herzversagen. Daraufhin engagierte sich seine Frau umso stärker politisch und ließ sich wenig später von NSDAP-Gauleiter in Baden, Robert Wagner, für den Aufbau der Frauenarbeit der Partei in Kehl und Offenburg anwerben und bald auch die Leitung des Deutschen Frauenordens im Badischen übertragen, der 1931 in der neu gegründeten NS-Frauenschaft (NSF) aufging. Ihre zweite Ehe mit dem Landarzt Günther Scholtz hielt nur von 1932 bis 1937. Im Jahr 1940 heiratete sie den SS- Obergruppenführer August Heißmeyer, der sechs Kinder mit in die Ehe brachte und mit ihr 1944 noch einen gemeinsamen Sohn bekam. Mit dann insgesamt elf Kindern wurde sie zum Vorbild für die arische Mutter stilisiert, aber auch insgeheim kritisiert, dass sie aufgrund ihrer Ämterhäufung gar keine Zeit sie hatte. Im Jahr 1934 erreichte die rasante Karriere von Gertrud Scholtz-Klink ihren Höhepunkt: nachdem sie Leiterin des weiblichen Arbeitsdienstes, des Deutschen Frauenwerkes, des Deutschen Roten Kreuzes und Reichsführerin der NSF geworden war, verlieh ihr Hitler im November 1934 den Titel „Reichsfrauenführerin“. Doch auch wenn sie formal nur ihm und seinem Stellvertreter Rudolf Heß unterstellt war und in Berlin einen Verwaltungsapparat mit Hunderten von Mitarbeiterinnen aufbaute, hatte sie doch kaum Machtbefugnisse, nicht einmal ein eigenes Budget. De facto unterstand sie innerhalb der NS-Männer-Hierarchie Erich Hilgenfeldt, dem Leiter der Nationalen Volkswohlfahrt (NSV) und war nur seine Stellvertreterin im Amt für Frauenfragen. Ihr geringer politischer Einfluss reduzierte sich trotz vieler weiterer Ämter spätestens ab 1936 zusehends auf die Rolle eines Aushängeschildes. Als solches verbreitete sie in zahlreichen Reden und Schriften das nationalsozialistische Weiblichkeitsideal, wobei sie entsprechend der NS-Lehre von Rasse und „Volksgesundheit“ Nicht-Arierinnen wie Jüdinnen, Sinti, Roma und Andersdenkende ausgrenzte. Rhetorisch wirksam propagierte sie die selbstlos dienende, pflichtbewusste und leidensfähige Mutter, verteidigte gegen „falsche Gleichmacherei“ das „ureigenste Selbst" der Frau. Dies zu entfalten gab es an 150 Schulen auch praktische Unterstützung in NSF Kursen über Hauswirtschaft, Kinderpflege, Erziehung Hygiene und "nationalsozialistische Kultur". In ihren 1978 erschienen Memoiren, die sie provokativ den „Opfern der Nürnberger Prozesse“ widmete, zeigte sie sich unbeirrt begeistert vom Nationalsozialismus und überzeugt von dessen Frauenbild. Gertrud Scholtz-Klink starb am 24. März 1999 in Tübingen-Bebenhausen.