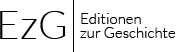Der Weg zur „Zentralstelle“
Martin war am 4. Juni 1934 ins Spiel gebracht worden. An diesem Tag fand in der Auslands-Abteilung des Lichtbild-Dienstes nämlich ein Gespräch statt, an dem neben dessen Leiter der Landesgruppenleiter der NSDAP in Brasilien, Willi Koenig, und Hildegard Pasch teilnahmen. Letztere war nach eigener Angabe bis dahin wie Martin ebenfalls bei der Reichsmusikkammer beschäftigt und stand nun unmittelbar vor ihrer Abreise nach Brasilien, wo sie unter anderem beabsichtigte, „deutsche Vorträge und Kurse abzuhalten“.
Koenig teilte dabei eingangs mit, dass die gerade von Rio de Janeiro nach Sao Paulo umgezogene NSDAP-Landesgruppenleitung „als Zentrale der Deutschtumsarbeit in Brasilien anzusehen“ sei, weshalb künftig das gesamte für deren Arbeit notwendige „Film- und Lichtbildmaterial“ bei der Landesgruppenleitung zentral zusammenzufassen sei. „Ferner bat Herr Koenig, etwa 300 Schallplatten für den dortigen Rundfunk zur Verfügung zu stellen und zwar: Reden des Führers, Dr. Goebbels, S.A.-Lieder, Volkslieder und klassische Musik.“[1] Letztlich wurden ihm vom Propagandaministerium sogar 1.000 RM für rund 500 Platten zugestanden.[2]
Auch Hildegard Pasch hatte offenbar Interesse daran, künftig auch in Südamerika auf solche deutschsprachigen Materialien zurückgreifen zu können. Was aber immer auch ihre konkreten Motive gewesen sein mögen, sicher ist, dass sie – wohl eher unbeabsichtigt - durch ihre Initiative den systematischen weltweiten Einsatz deutscher Schallplatten mit politischen Inhalten nachhaltig befeuerte und letztlich wahrscheinlich erheblich zur Einrichtung der „Zentralstelle für Deutsche Kultursendungen im Auslande“ beitrug. In der Reichsmusikkammer, so erzählte sie nämlich dem Verantwortlichen der Auslands-Abteilung des Lichtbild-Dienstes, befasse sich eine Abteilung ausdrücklich damit, „Schallplattenprogramme für die in den ausländischen Sendern angesetzten Stunden für deutsche Sendungen zusammenzustellen“. Bisher sei das vorwiegend für Brasilien, Argentinien und Uruguay geschehen, „es werden aber auch sämtliche anderen Länder berücksichtigt“. Verantwortlich für diese Arbeit, die der Abteilung G („Arbeitsgemeinschaften“) der RMK und hier wiederum dem „Fachverband Musik-Instrumenten-Gewerbe“ zugeordnet war, zeichne deren Vorsitzender Martin.[3]
Die Auslands-Abteilung des Lichtbild-Dienstes nutzte diese Informationen, um die ihr zugedachte, eigentlich ja fachfremde und daher wohl wenig geliebte Aufgabe des Schallplattenversands auf andere Schultern abzuwälzen. Unmittelbar nach dem Besuch der jungen Dame richtete sie an das RMVP nämlich die Frage, „ob es nicht evtl. angebracht wäre, sämtliche Schallplattenangelegenheiten durch diese Stelle zu erledigen und jedenfalls eine Zusammenarbeit herbeizuführen“.[4] Dem wurde umgehend stattgegeben und der Lichtbild-Dienstelle am 18. Juni 1934 mitgeteilt, „dass Herr Martin bei der Reichsmusikkammer mit der Zusammenstellung von Schallplattenprogrammen für die in den ausländischen Sendern angesetzten Stunden für deutsche Sendungen beauftragt worden ist“. Künftig waren über ihn und damit über die mit dieser Beauftragung offenbar neu ins Leben gerufenen „Zentralstelle für Deutsche Rundfunksendungen im Auslande“ sämtliche Beschaffungsmaßnahmen der für einen Auslandseinsatz gedachten Schallplatten abzuwickeln.[5]
[1] BArch Berlin, R 55/1189, Bl. 51. Koenig hielt „für eine restlose Auswertung der nach Brasilien kommenden Filme“ zudem für „unbedingt erforderlich, dass der Landesgruppenleitung ein Koffer-Ton-Apparat mit Leinwand zur Verfügung“ stehe. Am 8.6.1934 teilte der der NSDAP-AO in Hamburg mit, man habe ihm hinsichtlich seiner diversen Wünsche im Propagandaministerium „vollstes Verständnis entgegengebracht“ und sei bereit, den Kauf des Projektors mit 1.500 RM zu unterstützen. Daher sei man sehr bald in die Lage versetzt, „auch in den entferntesten deutschen Kolonien Tonfilme unabhängig von den evtl. vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Kinos vorzuführen“. Zugleich versuchte König in Verhandlungen mit der Reichsrundfunkkammer die Lieferung von Kurzwellen-Radios deutscher Firmen nach Brasilien in die Wege zu leiten. (Ebenda, Bl. 52)
[2] Vgl. BArch Berlin, R 55/1189, Bl. 52
[3] Die genaue Funktion Martins nach BArch Berlin, R 55/550, Bl. 232
[4] BArch Berlin, R 55/1189, Bl. 39f.
[5] BArch Berlin, R 55/1189, Bl. 41. Martin war auch Mitglied des Verwaltungsbeirats der Reichsmusikkammer. Vgl. BArch Berlin, R 55/1189, Bl. 77. Nach Einschätzung von Oliver Rathkolb entwickelte sich die Reichsmusikkammer um eine Institution, „die auf allen Ebenen vom RMVP geprägt und beeinflusst wurde“. (Oliver Rathkolb: Radikale Gleichschaltung und Rückbruch statt „Neubau“. Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte der Reichsmusikkammer; in: Albrecht Riethmüller/Michael Custodis (Hgg.): Die Reichsmusikkammer. Kunst im Bann der Nazi-Diktatur, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 33-46, hier S. 38