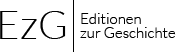Auftrag mit „Risiko“ - „Das sind doch unsere Zeitzeugen, wenn die Alten tot sind.“
Im Zuge ihrer Arbeit begegnet Dorothee Schmitz-Köster auch anderen Menschen, die sich mit der Feldpostkorrespondenz von Familienangehörigen auseinandergesetzt haben. So berichtet sie von einer pensionierten Lehrerin, die sich intensiv mit den Briefen ihres sehr viel älteren Bruders beschäftigt hat, der nicht mehr aus dem Krieg zurückkam und den sie folglich auch nie richtig kennenlernen konnte. „Sie hat ihn damit praktisch nochmal ins Leben gerufen.“ Ergebnis war eine kleine Broschüre, die innerhalb der Familie verteilt wurde. Solche rein privat motivierten Projekte empfindet die professionelle Journalistin als wichtig, aber durchaus auch „anrührend“, weil sie stets von dem Bestreben geleitet sind, jemand Entfernten wieder „näher heranzuholen“. Im Rahmen von Lesungen würden Zuhörerinnen und Zuhörer ohnehin häufig die Absicht artikulieren, dass sie ermutigt durch ihr Beispiel nun ihrerseits darangehen möchten, sich mit familieninternen Briefen und Tagebüchern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen.
Sie selbst, so Dorothee Schmitz-Köster, würde jeden in einer solchen Absicht bestärken, aber auch nicht verschweigen, dass man damit zugleich ein Risiko eingehe. „Du wirst da was lesen und entdecken, was Dir nicht gefällt.“ Das könne gerade mit Blick auf die politischen, d.h. oft sehr NS-orientierten Ansichten von engen Verwandten, oftmals recht „heftig“ ausfallen. In ihrem Buch „Der Krieg meines Vaters“ fasste sie ihre diesbezüglichen Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit den Briefen so zusammen: „Sie kann zu Entdeckungen führen, die schrecklich sind – oder nur peinlich. Sie kann ihn bloßstellen und mich beschämen. Sie kann verletzen und wehtun.“
Daher hält sie es für wichtig, dass man nicht gänzlich unvorbereitet mit dem Studium solcher Schriftstücke beginnen solle. Wichtig sei natürlich auch die jeweilige Konstellation zwischen den Korrespondenzpartnern. Bei Paaren würde es sich viel häufiger um Liebesbriefe handeln, in denen Ideologie und Politik eher in Halbsätzen abgehandelt würden als in anderen Briefwechseln.
Etwaige Zweifel sollten aber niemanden von einer oft zwar mühsamen und auch schmerzhaften, in nahezu allen Fällen aber gewinnbringenden Lektüre abhalten. „Man kann sie ja jederzeit abbrechen“, was sie ja auch gleich zweimal getan habe, ehe sie sich zur intensiven Beschäftigung durchgerungen habe. Dann taten sich Dorothee Schmitz-Köster aber durchaus neue Welten auf: „Womit ich nicht gerechnet hatte, war die Nähe, die sich bei der Lektüre einstellte. Ich hatte das Gefühl, in das Herz dieses jungen Mannes zu schauen, der später mein Vater wurde.“
Lesen ist das eine, eine Veröffentlichung solcher Quellen oft jedoch etwas völlig anderes. Das Ambivalente an dieser Situation durchlebte auch Dorothee Schmitz-Köster, die betont, sie habe erst mit dem Schreiben an ihrem Buch beginnen können, nachdem ihr Vater gestorben sei. „Das ging nicht, als er lebte. Das konnte ich nicht.“ Aber auch dann fühlt sie sich nicht zu jedem Zeitpunkt des Arbeitsprozesses wohl in ihrer Haut. „Ich habe das teilweise auch als Verrat empfunden.“ Sie habe sich im Projektverlauf mehrmals in einem „schwierigen seelischen Prozess“ wiedergefunden. „Das ist mein Vater, der so gedacht hat. Und damit gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit.“ Natürlich kämen auch die „schönen Seiten“ der Korrespondenz zum Tragen, aber Probleme habe man ja eben mit genau jenen Passagen und Inhalten, die einem nicht gefallen würden. Dabei gehe es keinesfalls um das Licht, dass dadurch auf einen selbst falle, sondern um das Gefühl, dass man einen Menschen, der sich nicht dagegen wehren könne, bloßstelle.
So fand und findet sie sich als Tochter in einer Zwickmühle wieder. Die Briefe, so findet sie, seien ganz eindeutig ein „Schatz“. Das rühre auch daher, dass ihr Vater gut hätte schreiben können. „Das liest sich teilweise auch richtig schön.“ Außerdem betrachte sie die Tatsache, dass ihr Vater ihr die Briefe übergeben habe, auch als „Auftrag“.
Sie könne solche Quellen aber auch aus einem anderen gewichtigen Grund nicht wegwerfen: „Das sind doch unsere Zeitzeugen, wenn die Alten tot sind. Die Generation stirbt aus, und so sprechen sie noch zu uns oder zur nächsten Generation. Und dann sollen sie auch sprechen.“
Ein Rest an Unsicherheit bleibt. „Aber ob er das wirklich wollte, dass ich das an die Öffentlichkeit bringe, bin ich mir nicht 100-prozentig sicher. – Und das ist ein Stückchen Verrat.“