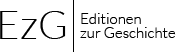Hannes Ließem: „Es muss doch einmal zu Ende sein…“
Hier werden die in den Jahren zwischen 1939 und 1944 verfassten Feldpostbriefe zugänglich gemacht, die der zu Kriegsbeginn eingezogene Hannes Ließem an seine Frau und seine kleine, 1938 geborene Tochter Dorothea richtete, bis er am 30. August 1944 im Osten ums Leben kam. Die Briefe sowie ein hier ebenfalls einsehbares Fotoalbum wurden von Dorothea zur Verfügung gestellt und dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln zur dauerhaften Aufbewahrung übergeben.
Über ihre Erfahrungen bei der intensiven Beschäftigung mit den Briefen des ihr ja weitgehend unbekannt gebliebenen Vater schrieb Dorothea Hölzer:
„Dann begann ich zu lesen. Und ich erinnerte mich an so Vieles, das meine Mutter mir von meinem Vater und der Kriegszeit erzählt hatte. (…) Auch lernte ich nun meinen Vater durch seine lebendige, anschauliche Art zu schreiben persönlich kennen. Seine Briefe lesen sich oft wie Teile eines Abenteuers. Mit dem Wissen der Vorgeschichte meiner Eltern begreife ich auch manche Sätze, die gar nicht zu seinem Wesen, seiner politischen Einstellung und den Schilderungen meiner Mutter zu passen scheinen und mich erschrecken lassen. Er wagte wohl kaum, Negatives über den Nationalsozialismus zu äußern, wenn er sich brieflich mit meiner Mutter unterhielt. Das hätte meine Eltern – insbesondere das Leben meiner Mutter – erneut in große Gefahr gebracht. Dass er seinen Aufenthaltsort nicht immer mitteilen und nichts Negatives in den Briefen stehen durfte, da sie durch Stichproben kontrolliert wurden, dürfte wohl bekannt sein.
Ich lernte allmählich auch selbst, die Handschrift meines Vaters zu lesen. Und meine Nähe zu ihm wurde und wird immer vertrauter und inniger. Er hat ja die vor mehr als siebzig Jahren geschriebenen Seiten berührt. Und nun ist er mir in Gedanken ganz nah, ein junger, hoffnungsvoller, lebensbejahender, verliebter, liebender und sorgender Mann und Vater. Bewegt und erschüttert lese ich, wie meine Eltern ihre Ehe und ihre Liebe in den Kriegsjahren in ihren Briefen gelebt haben – bis zum verzweifelten Ende durch den Tod meines Vaters. Die große Sorge, die meinen Vater während des Krieges begleitet, ist die Sorge um meine Mutter, die – auch infolge der leidvollen Erfahrungen durch die Nazis – sehr oft krank wird. Sie lebt in ständiger Furcht, meinen Vater zu verlieren.
Mein Vater war der „Fallschirm-Panzerdivision Hermann Göring“ zugeteilt. Um meine Mutter zu beruhigen, schreibt er in einem seiner Briefe: „… Und ich bin gar nicht bang vor der SS. …“ Solche kleinen Bemerkungen sollen ihr die Furcht nehmen. Ich glaube nicht, dass meine Mutter das wirklich beruhigen konnte.
Ich weiß, dass ich mir als kleines Mädchen damals einfach nicht vorstellen kann, dass mein Vater nie mehr aus dem Krieg zurückkommen sollte. Ich sehne mich nach seiner Umarmung, nach seiner Liebe, seiner Zärtlichkeit – und nach seinem Schutz. Angetrieben von dieser Sehnsucht laufe ich jedem Uniform Tragenden nach, klammere mich an ihn, um dann immer enttäuscht festzustellen, dass er gar nicht mein Vater ist. Meiner Mutter ist das verständlicherweise äußerst unangenehm. Glücklich küsse ich die Fotos, auf denen er zu sehen ist, immer wieder die Briefe, die ich von ihm bekomme. Manchmal macht er kleine Zeichnungen, die ich auch heute noch liebevoll betrachte. Auch in vielen Briefen an meine Mutter beschreibt mein Vater in Zeichnungen seine Umgebung oder Erlebnisse, um sie so noch stärker an seinem Leben teilhaben zu lassen.
Während eines Fronturlaubs meines Vaters denken sich meine Eltern eine kleine List aus. Da mein Vater eine steile Schrift hat, markiert er im Brief einen Absatz am Rand und setzt dann in verschiedene Worte schräg nach rechts liegende Buchstaben ein. Liest man diese Buchstaben nacheinander, lässt sich seine Nachricht entschlüsseln.
Der Krieg führt meinen Vater nach Belgien, Frankreich, Russland, Italien und Sizilien – und wieder in den Osten zurück. In den ersten Kriegsjahren wird er mehrmals schwer verwundet. Unter anderem liegt er mit einem Bauchdurchschuss, ein anderes Mal mit einem Lungensteckschuss im Lazarett. Je länger der schreckliche Krieg dauert, umso mehr spürt man die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit der Soldaten. Man liest verzweifelte Sätze: „… es muß doch einmal zu Ende sein…“
Im August 1944 wird mein Vater von der Ostfront nach Radom in Polen zum Hauptverbandsplatz gebracht, weil ein Blinddarmdurchbruch eine Notoperation erfordert. Nachdem er transportfähig ist, soll er am 29. August in ein Heimatlazarett geflogen werden. Das Flugzeug – mit dem Zeichen des Roten Kreuzes – wird nach dem Start in einer Höhe von achtzig Metern von russischen Jägern abgeschossen. Er überlebt den Absturz noch zwei Tage mit schweren Verbrennungen. - Mein Vater stirbt am 30. August 1944 an den Folgen des Abschusses.“
Mit Dorothea Hölzer wurde ein Video-Gespräch geführt, auf dessen Grundlage eine Darstellung über ihren Umgang mit den Feldpostbriefen ihres Vaters entstand. Sie ist hier an anderer Stelle einschließlich Auszügen aus dem Video-Interview einsehbar.