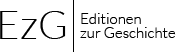Einberufung und Tod - „Ich glaube, in dem Augenblick wird man erwachsen.“
Hannes Ließem wurde direkt zum Kriegsbeginn im August 1939 zur Wehrmacht einberufen und musste seine kleine Familie nach knapp zweijähriger Ehe dauerhaft verlassen. Das galt auch für die 1938 geborene und heißgeliebte Tochter Dorothea, die in der Familie nur „Dorotheechen“ genannt wurde. „Ich war ein Jahr alt, und da kam mein Vati in den Krieg“, bringt die Tochter ihre nur sehr kurze Bekanntschaft mit ihrem Vater rückblickend auf den schmerzlichen Punkt. „Ich habe meinen Vater unendlich geliebt. Ich war verrückt nach ihm.“ – Alles was ihr geblieben ist, sind vage Erinnerungen an die kurzen „Heimaturlaube“ und Lazarettaufenthalte ihres Vaters.
Hannes Ließem war auf zahlreichen Kriegsschauplätzen aktiv. So nahm er nach einer Ausbildungszeit in der Eifel als Angehöriger der „Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring“ ab Mai 1940 ebenso am Westfeldzug teil wie ein gutes Jahr später am „Russlandfeldzug“. Nach mehrfachen dort erlittenen Verwundungen und teilweise sehr langen Lazarett-Aufenthalten wurde er dann ab Anfang 1943 in Italien eingesetzt. Nach der Teilnahme an einem Offizierslehrgang wechselte er Anfang August 1944 wieder an die Ostfront, wo er bereits nach einigen Tagen aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs notoperiert werden musste. Als man ihn am 29. August per Flugzeug in ein Lazarett ausfliegen wollte, wurde es von sowjetischen Kampffliegern abgeschossen. Hannes Ließem erlag einen Tag später seinen dabei erlittenen Verletzungen.
Dorothea Hölzer kann sich noch gut an das Eintreffen der Todesnachricht in Godesberg erinnern. An diesem Tag sei sie mit Großmutter und Mutter zum Einkaufen in Bonn gewesen. Nach der Rückkehr habe ihre Mutter dann völlig unvorbereitet den während ihrer Abwesenheit eingetroffenen Brief von der Front entdeckt. „Die hat nur noch geschrien: ‚Dem Hannes ist was passiert!‘“ Nie mehr, so Dorothea Hölzer noch immer erschrocken und bedrückt zugleich, habe sie einen Menschen so verzweifelt schreien hören, wie ihre Mutter beim Empfang der Todesnachricht. „Es war grausam.“
„Bei mir war niemand“ erzählt sie weiter, „denn ich habe ja nicht geschrien.“ Statt Trost erfuhr sie wenig Beachtung, sondern wurde sogar noch beauftragt, die übrigen Familienangehörigen über den Tod des Vaters zu informieren. „Ich war gerade sechs geworden“, zeigt sie sich ob der ungeschützt auf sie einströmenden Belastungen und Gefühle noch heute erschüttert. „Ich glaube, in dem Augenblick wird man erwachsen.“
Auch danach blieb die Sechsjährige weitgehend allein und auf sich gestellt. Ihre Mutter lag fast ein Jahr mit einem Nervenzusammenbruch zu Bett und das vater- und zunächst auch weitgehend mutterlose „Dorotheechen“ wohnte bei ihren Großeltern. Verschlimmert wurde ihre Lage noch dadurch, dass Mutter Elsbeth immer dann, wenn sie ihre Tochter sah, in Tränen ausbrach, weil diese sie zu sehr an ihren toten Mann erinnerte. Psychische Folgen konnten nicht ausbleiben: „Ich wollte nur noch Märchen von den Gebrüder Grimm hören, in denen es schrecklich war. Und immer musste ich weinen.“
Auch die ersten Nachkriegsjahre waren hart für Mutter und Tochter. Elsbeth Ließem bezog lediglich eine kleine Rente als Kriegerwitwe und Dorothea eine solche als Halbwaise. „Wir waren sehr arm.“ Immer wieder versuchte die Mutter, das schmale Einkommen durch Gelegenheitsarbeiten, etwa das Entwerfen und Nähen von Ledertaschen, aufzubessern. Insgesamt aber, so Dorothea Hölzer rückblickend, sei ihre Mutter dem Leben kaum mehr gewachsen gewesen. „Das Leben war für sie einfach zu schwer.“
Daher erwies es sich als Glück, als Elsbeth Ließem 1949 den Maler Paul Magar kennen- und lieben lernte. Er hatte die russische Kriegsgefangenschaft überlebt, aber sein Atelier mit sämtlichen Werken durch den Krieg verloren. Die beiden wurden später ein Paar und Dorothea bekam einen verständnisvollen zweiten Vater, ihren „Papi“, in dem auch sie eine Stütze fand. An der wirtschaftlichen Situation änderte das zunächst aber wenig. „Er war genauso arm. Er nagte ja auch am Hungertuch.“