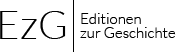Einstellungen - „Vorsichtig, aber doch deutlich.“
Aus dem, was er von seinen Eltern gehört und erfahren habe, so Klaus Endemann, lasse sich nicht schließen, dass Mutter oder Vater „offen oder heimlich mit den braunen Machthabern in Staat und Gemeinde sympathisiert hätten“. Er fährt fort: „An ihrer inneren Opposition zum Nazi-Regime hatte und habe ich – auch heute, nach Lektüre der Briefe – keinen Zweifel.“ Allerdings zeigt er sich ob der darin enthaltenen „triumphierenden Passagen“ über Erfolge der Wehrmacht auf dem Balkan im Frühjahr 1941 verwundert. Und „irritiert“ zeigt er sich zudem von jenen Briefstellen, in denen Charlotte Endemann „von einem Umzug nach Ostpreußen oder in die eroberten Gebiete Polens“ geträumt habe. „Es müssen wirtschaftliche Überlegungen und die Hoffnung auf einen Neuanfang unter weniger deprimierenden Umständen gewesen sein“, versucht er sich solch verstörende Aussagen zu erklären.
Stefanie Endemann entnimmt den Briefen, dass ihr Vater versucht habe, „ein guter Soldat“ zu sein. Als solcher habe er sich – zumindest zunächst – offenbar auch verpflichtet gefühlt, hinter den Kriegszielen des NS-Regimes zu stehen. „Er macht sich da keine Gedanken beim Einmarsch in die Sowjetunion. Da sagt er: ‚Das sind vielleicht sechs Wochen.‘“ Auch hinsichtlich der völligen und militärisch unsinnigen Zerstörung von Rotterdam im Mai 1940 habe er – nach der Durchfahrt durch die Ruinen – nirgendwo auch nur andeutungsweise die Frage gestellt: „Was soll das? Sind wir überhaupt befugt, das zu tun?“
Nach der Kriegswende von Stalingrad zur Jahreswende 1942/43 macht sie in den Briefen untergründig wachsende Verzweiflung aus, weil ihr Vater zunehmend der Tatsache habe ins Auge sehen müssen, „dass der Krieg vermutlich in die Binsen“ gehe. „‚Armer Führer‘, hat er gesagt.“
Charlotte Endemann, so berichtet ihre erst in der Nachkriegszeit geborene jüngste Tochter weiter, habe den Krieg an einigen Briefstellen sogar als „Glück“ für sich bezeichnet. Zum ersten Mal habe sie nämlich in diesen Jahren wegen des aufgrund der Einberufung ihres Mannes staatlicherseits gezahlten Unterhalts für die Kinder systematisch und ohne Existenzsorgen planen können. Und der fiel deshalb recht hoch aus, weil er auf Grundlage der vergleichsweise hohen Einkünfte der letzten Jahre errechnet wurde. „Davon hat sie sogar noch die Schulden abbezahlt. Das ist unglaublich.“
Heidi Diehl, bei Kriegsende elf Jahre alt, kann sich noch gut an bestimmte Situationen im Kriegsalltag und die damals geführten Gespräche und Äußerungen erinnern. Ihre Mutter habe Freundinnen gehabt, die sich recht offen regimekritisch geäußert hätten. Solche Gesprächsinhalte teilt sie durchaus auch ihrem Mann mit – allerdings in verklausulierter Art und Weise. Sie habe in solchen Fällen beispielsweise die Formulierung benutzt: „Unten auf der Straße gingen Leute vorbei, die haben gesagt …“ Auf diese Art und Weise sei es ihr möglich gewesen, ihren seit dem Überfall auf die Sowjetunion wachsenden Pessimismus mit aller gebotenen Vorsicht zum Ausdruck zu bringen. „Das geht nicht gut! Ab dann ist bei meiner Mutter nicht mehr viel Freude am Krieg da.“ Das habe sie in den Briefen immer wieder zum Ausdruck gebracht. „Vorsichtig, aber doch deutlich.“ So habe sie später auch begonnen, verbotene „Feindsender“ zu hören.