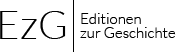Risiken und Chancen – „Das ist dann nicht mehr wahr!“
Die Beschäftigung mit der schriftlichen Hinterlassenschaft der Eltern kann durchaus auch zu Erkenntnissen führen, auf die man als Tochter oder Sohn vielleicht lieber verzichtet hätte. Stefanie Endemann etwa betont, ihr sei durchaus bewusst gewesen, dass sich das Denken ihres Vaters durch einen ausgeprägten Konservatismus und einen erheblichen Anteil deutschnationalen Gedankenguts ausgezeichnet habe. Allerdings habe er sich später und bis zu seinem Tod nie mehr zum Krieg oder zu seiner Grundeinstellung zum Nationalsozialismus geäußert. In dieser Hinsicht förderte die Auseinandersetzung mit den Briefen Harald Endemanns und seiner politischen Einstellung für die Tochter dann nicht nur Erfreuliches zutage. „Die war zum Teil sehr führergläubig“, was ihr „natürlich sehr quergegangen“ sei, resümiert sie ihre durchaus gemischte Gefühlslage bei der Lektüre. Insofern sei sie sehr froh gewesen, dass nach einem ersten Fund mit deutlichen Anklängen an das NS-Gedankengut keine weiteren so klar in diese Richtung deutenden Schreiben mehr gefolgt seien.
Angesichts der neu gewonnenen und wenig erfreulichen Erkenntnisse trat der „Geschwisterrat“ zusammen und diskutierte das problematische Thema und etwaige daraus zu ziehende Konsequenzen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: „Es ist die ganze Wahrheit, und die sollten wir nicht verstecken und weggeheimnissen. Das ist dann nicht mehr wahr!“
Man müsse, so eine weitere Erkenntnis aus der intensiven Beschäftigung mit den Briefen, die Eltern zugleich aber auch etwas in Schutz nehmen. Sie hätten damals zwar „mittendrin“ gelebt, wären jedoch nur sehr einseitig informiert gewesen, während sie als deren Kinder heute eben sehr viel über die Zeit des Nationalsozialismus wüssten. „Das ist für uns eine Erklärung gewesen, dass es so war.“
Dennoch bereiteten und bereiten die bei den Eltern partiell feststellbare „Sympathie“ und das ab und an aufscheinende „Mitgefühl für den ‚Führer‘“ und eine ebenfalls ansatzweise zum Ausdruck kommende „Herzlosigkeit“ gegenüber den oft bedrückenden „Geschicken anderer Völker“ den wesentlich liberaler eingestellten Geschwistern erhebliche Probleme. Auch die erst nachträglich aufgetauchten „Siegesgesänge“ von Mutter Charlotte aus dem Jahr 1941 hätten ihnen „gar nicht gefallen“. Aber auch hier entscheidet der Endemann’sche Geschwisterrat: „Trotzdem, es muss rein!“
Die intensive Auseinandersetzung wirft naturgemäß auch ganz andere Fragen auf: Wie hätte ich mich denn verhalten? Wäre ich da vielleicht genauso „darauf abgefahren“? „Das kann ich natürlich nicht sagen“, bekennt Stefanie Endemann trotz aller antifaschistischen Grundeinstellung offen und ehrlich. „Da kann ich nicht für mich gerade stehen.“
Sie persönlich, so ergänzt Heidi Diehl, habe besonders eine Briefpassage erschreckt, in der ihre Mutter geschrieben habe: „Vielleicht finden wir nach dem Krieg im Osten ein schönes großes Haus.“ Offenbar sah Charlotte Endemann - zumindest zeitweise - in der seitens der NS-Propaganda massiv geförderten Ostkolonisation einen Ausweg aus der von ihr als beengend empfundenen Familienkonstellation in dem Haus der Schwiegereltern. An die Notwendigkeit, dass man die erhofften neuen Besitztümer im Osten zuvor ja jemanden wegnehmen müsste, verschwendete sie hingegen – zumindest in den Briefen – augenscheinlich keinen Gedanken.
Stefanie Endemann empfindet die Konfrontation mit den Briefen von Mutter und Vater wie eine „Zeitreise“, bei der sie als mitreisendes „Mäuschen“ still und heimlich dabei gewesen sei. Bei allen Risiken, nicht nur Erfreuliches zu erfahren, so resümiert sie, habe es sich alles in allem um eine „lohnende Erfahrung“ gehandelt. Die Rezeption solcher Zeugnisse, so ergänzt Heidi Diehl, sei auch für die nachfolgenden Generationen als Verständnishilfe von großer Bedeutung.
Es gebe, so fährt sie fort, ja eine Menge Literatur, die auf der Montage von Briefinhalten beruhe. „Und die habe ich immer sehr gerne gelesen und die Zeit dann besser verstanden.“ Auch Stefanie Endemann zeigt sich vom Gehalt und dem Quellenwert solcher Selbstzeugnisse angetan. Sie seien „aus dem unmittelbaren Erleben heraus“ entstanden und „nicht aus dem, was man hinterher noch erfahren“ habe. „Das ist das unmittelbare authentische Erleben des Tages und des Moments. Das findet man natürlich in keinem Geschichtsbuch.“