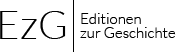Trauma und Trauerarbeit – „Sie müssen reden, reden, reden!“
Als sehr belastend und schmerzhaft empfand und empfindet Dorothea Hölzer bis heute die Lektüre des Berichts, den ein Kamerad ihres Vaters über dessen genaue Todesumstände verfasst und dessen Inhalt sie sehr lange verfolgt habe. „Ich konnte hingucken, wohin ich wollte. Das war wie ein Film vor meinen Augen.“ „Zwischen meinen Augen und der Wirklichkeit“ habe sich stets ein Film abgespielt, in dem ihr „halbverbrannter Vater“ eine zentrale Rolle gespielt habe.
Unter solchen Umständen wurde die Arbeit an der Veröffentlichung der Briefe zeitweise zur Tortur. Immer dann, wenn sie darüber erzählt habe, so berichtet Dorothea Hölzer rückblickend, habe sie weinen müssen. Als sie das einem Arzt erzählte, diagnostizierte der voreilig eine Depression und verordnete Medikamente, die ihren psychischen und physischen Zustand nur noch verschlimmerten.
Abhilfe schaffte schließlich Dorothea Hölzers Hausarzt, der festgestellt habe, dass es sich keinesfalls um eine Depression handele, sondern dass seine Patientin dringend eine zu lange unterlassene Trauerarbeit leisten müsse. „Sie waren als Kind vollkommen allein. Sie sind allein gelassen worden und haben alles selber verarbeitet und weggesteckt. Sie müssen reden, reden, reden!“
Hierbei half ihr schließlich eine Therapeutin. „Die ist gekommen, und da habe ich drei Monate lang geredet. Und dann ging es besser.“ Die Erkenntnis aus diesem langwierigen Prozess ist für sie eindeutig: „Ich habe immer meinen Vater vermisst.“
Mit ihr, so resümiert Dorothea Hölzer mit Blick auf ihre Arbeit an den Briefen ihres Vaters, sei dabei „eine ganze Menge passiert“. „Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich habe wirklich einen Vater gehabt. Und ich hatte einen Vater, der mich über alles geliebt hat.“ Er sei ihr durch die Briefe ungeheuer nah gekommen. Das habe so weit geführt, dass sie die Originalbriefe gestreichelt habe, als seien sie die Haut ihres Vaters. „Ich war ungeheuer zärtlich mit diesen Briefen, denn die hatte er ja berührt.“