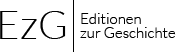Zum Quellenwert von Briefen
Persönliche Briefe eröffnen auch späteren Lesern häufig Einblicke in Stimmungen, Meinungen und Beweggründe für Denken oder Handeln der Autoren zum Zeitpunkt des Verfassens. Allerdings gilt es bei einer Bestimmung von dessen tatsächlichem Quellenwert einschränkend stets zu beachten, dass der Briefinhalt zumeist auf eine bestimmte Wirkung hin berechnet und zugeschnitten ist, die er beim Empfänger hervorrufen soll. Zugleich ist zu bedenken, dass Briefinhalte in aller Regel kaum vom Lebensentwurf der jeweiligen Autoren zu trennen sind.[1] Will man dem Mitgeteilten also intensiver auf den Grund gehen, ist es stets von Vorteil, möglichst viel zu den Biografien, den Lebensumständen und den Intentionen von Autoren und Adressaten in Erfahrung zu bringen. Denn Kommunikation findet stets unter bestimmten Umständen statt und kann daher nicht losgelöst betrachtet werden von den Bedingungen, unter denen sie stattfindet, wirken sich diese doch direkt oder indirekt auch auf die Themenauswahl, ihre Anordnung und ihre sprachliche Umsetzung und somit auf die übermittelten Inhalte aus.[2]
Die Berücksichtigung dieser Faktoren ist für eine fundierte Bewertung der Quelle „Brief“ nicht zuletzt deshalb unerlässlich, weil jede Kommunikation individuell gestaltet und wahrgenommen wird. Das heißt im Umkehrschluss, dass solche Dokumente keinesfalls die tatsächliche „Wirklichkeit“ oder gar die „Wahrheit“ wiedergeben, sondern allenfalls und im besten Fall das, was vom Briefeschreiber für diese gehalten wurde bzw. was ihm erwähnenswert und mitteilungswürdig erschien. Damit werden die subjektive Realität und deren jeweilige „Wahrhaftigkeit“ erst durch die Wiedergabe der selektiven Wahrnehmung in Briefform zugleich auch erst kreiert.[3] Umso bedeutsamer ist es für ein seriöses „Verstehen“ von Briefinhalten, die jeweiligen subjektiven Realitäten der Autoren möglichst genau zu erfassen und in eine Bewertung einzubeziehen.
Bei diesem Annäherungsprozess an die Briefinhalte gilt es außerdem zu berücksichtigen, dass Dialoge in Briefform mitunter spezifische Codes nutzen, die sich aus der Vertrautheit und dem Wissen generieren, über das ausschließlich die jeweiligen Korrespondenzpartner verfügen. Das führt dann häufig dazu, dass Andeutungen, die Autor und Adressat ohne Probleme „übersetzen“ und damit verstehen können, für Dritte - sofern sie überhaupt in der Lage sind, solche Briefpassagen zu identifizieren - nur äußerst schwer und ohne entsprechendes Hintergrundwissen wohl gar nicht interpretierbar sind. Daher ist der Aussagewert von Briefen in starkem Maße davon abhängig, inwieweit es im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen gelingt, den darin verwendeten Sprachcode unter Zuhilfenahme weiterer Informationen und anderer Quellen zu entschlüsseln.[4]
Wie wichtig gerade bei der Bewertung von Selbstzeugnissen eine möglichst breite Quellengrundlage ist, liegt zwar auf der Hand; soll aber an einem Beispiel veranschaulicht werden, durch das zugleich auch ein wichtiger (möglicher) Unterschied zwischen Tagebuch und Brief vor Augen geführt wird. Der deutsche Schriftsteller Arno Schmidt schrieb in einem Brief an den mit ihm befreundeten und für einen gemeinsamen Besuch mit seiner Frau angekündigten Wilhelm Michels: „Also wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen.“ In seinem Tagebuch legte Schmidt dagegen zeitgleich nieder: „Ein widerlicher Geselle, der Michels.“ Dieser Widerspruch lässt sich – wenn überhaupt – nur klären, wenn man der Beziehung zwischen den beiden Männern tiefer auf den Grund geht. Vor allem aber ist das Beispiel ein beredter Beleg dafür, dass man im Idealfall mehrere Quellen zur Verfügung haben sollte, um deren Glaubwürdigkeit dann im direkten Vergleich abwägen zu können.[5]
Zurück zum Brief als Quelle. Zumeist haben Historiker es mit Briefwechseln bzw. Briefkonvoluten zu tun. In solchen Fällen ist es stets sinnvoll, möglichst das gesamte verfügbare Material auszuwerten.[6] Denn nur die Briefserie kann – im Gegensatz zu statistischen Zufallsstichproben aus einer Menge von Einzelbriefen - durch den ihr innewohnenden prozessualen Charakter Veränderungen erkennen lassen und sowohl die Transparenz als auch die Aussagekraft des Gesamtkonvoluts erhöhen. Zusätzlich kann es durchaus sinnvoll sein, auch quantitative Untersuchungen an der Briefserie vorzunehmen.[7]
[1] Vgl. Weiß, Briefe, S. 48f.
[2] Vgl. Kilian, Medium, S. 21
[3] Vgl. Kilian, Medium, S. 22
[4] Vgl. Kilian, Medium, S. 22
[5] Vgl. Weiß, Briefe, S. 49f. Zum Hintergrund der Beziehung vgl. http://www.zeit.de/1987/43/ein-widerlicher-geselle (eingesehen am 14.11.2014)
[6] Vgl. Weiß, Briefe, S. 50
[7] Vgl. Kilian, Medium, S. 144f.: „Eine Briefserie zeichnet sich aus durch eine Anzahl von Briefen, innerhalb derer mindestens einer der beiden oder mehr Kommunikationspartner als Konstante erhalten bleibt („homogene“ Briefserie). Die kleinste Einheit der Briefserie ist die einzelne Sendung ungeachtet ihrer Länge. Die Briefserie gibt Aufschluss über Entwicklungen von Wahrnehmungen, aber auch über Schreibfrequenzen des Einzelnen. Sie lässt sich zum Beispiel in Sequenzen gliedern, die sich an für den Verfasser wichtigen Ereignissen orientieren. Die Aussageeinheit wäre die Briefserie in Abhängigkeit ihrer Merkmalsausprägungen, etwa Alter, Bildungsgrad, Konfession des Briefverfassers und ihrem Umfang. Aussagen müssen in Relation zur Menge der Briefe gesetzt werden, wenn unterschiedliche Briefserien miteinander verglichen werden.“ Vgl. auch Echternkamp, Kriegsausbrüche, S. 8