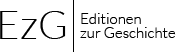Die Übergabe der Briefe - „Vielleicht war es der Wunsch, dass ich ihn besser verstehe.“
Auslöser für die für sie persönlich recht überraschende Übergabe der Briefe an sie, so Dorothee Schmitz-Köster rückblickend, sei wohl der Herzinfarkt gewesen, den ihr Vater kurz vor seinem 80. Geburtstag im Jahr 1994 erlitten habe. Danach habe er begonnen, sich „mit dem Ende auseinanderzusetzen“ und begonnen „Platz zu schaffen“. Zuvor seien ihr diese Schriftstücke gänzlich unbekannt gewesen. Alle Kinder hätten zwar das Fotoalbum mit den Fotos aus der Kriegszeit in Norwegen gekannt, das im Wohnzimmer-Regal gestanden habe, aber der Briefwechsel zwischen Vater und Großmutter sei familienintern nie thematisiert worden.
„Dann hat er mich irgendwann gefragt: ‚Willst Du die Briefe haben?‘“ Nach einer kurzen Erklärung zu deren Herkunft und Inhalt habe sie nicht lange gezögert. „Natürlich will ich die haben! – Und dann hat er sie mir gegeben.“ Die weit über 1.000 Briefe seien exakt sortiert und fein säuberlich in ordentlich beschrifteten Schnellheftern abgeheftet gewesen, die sie dann, so Dorothee Schmitz-Köster, in „Portionen nach Hause geschleppt habe“.
Natürlich habe sie sich gefragt, warum ihr Vater ausgerechnet sie als zweitälteste Tochter als Empfängerin seines Brief-Nachlasses ausgewählt habe. Er habe wohl gewusst, so ihre Vermutung, dass sie an den Briefen und der dahinter stehenden Geschichte Interesse habe und sie daher „zu schätzen“ wisse. Das Interesse ihrer Geschwister an zeitgeschichtlichen Hintergründen sei dagegen weniger ausgeprägt gewesen. Das habe ihr Vater wohl auch dadurch bemerkt, dass es eben sie war, die im Alter von 17, 18 Jahren während der Studentenbewegung mit ihm die Auseinandersetzung über aktuelle gesellschaftspolitische Themen geführt habe. „Er wusste also, dass ich an solchen Dingen interessiert war. Aber das war auch sein Risiko. Das ist er aber eingegangen. Es war ihm offensichtlich wichtig, dass er die Briefe weitergeben kann, dass sie erhalten bleiben, dass sie auf Interesse stoßen. Vielleicht war es aber auch der Wunsch, dass ich ihn besser verstehe. Das hat er aber alles nicht artikuliert.“
Den größten Teil des Bestands machen die Briefe aus Norwegen aus – „da hat er auch am meisten Zeit gehabt und meine Großmutter hat gern geantwortet“. Die „Abteilung Holland“, wo Rudolf Schmitz anschließend stationiert war, fällt dagegen schon deutlich kleiner aus, während die Briefe von der Ostfront bis auf zwei bemerkenswerte Ausnahmen fehlen. Sie wurden vor dem Einmarsch der Roten Armee in Mitteldeutschland vernichtet. Diese Lücke empfindet Dorothee Schmitz-Köster als Herausforderung und noch zu bewältigende Aufgabe. „Was hat der da überhaupt gemacht?“, fragt sie sich hinsichtlich der Tätigkeit ihres Vaters in der „Division Großdeutschland“ an der Ostfront. Was immer sie zu dieser Frage noch recherchieren wird, die überlieferten Briefe geben hierzu keine Auskünfte.
Diese „Aufgabe“ treibt die Journalistin nicht zuletzt deshalb um, weil nach ihrer Einschätzung schon einer der zwei überlieferten Briefe aus dieser Zeit ausreiche, um ihren Vater in einem sehr kritischen Licht erscheinen zu lassen. „Da sind plötzlich die ‚raffgierigen Juden‘ und die ‚verbrecherischen Kommunisten‘. Das trieft vor Ideologie, das ist unglaublich. Und vorher finden Sie das in den Briefen nicht.“ Darin komme zwar „Führer“-Gläubigkeit und eine positive Sicht auf die NS-Ideologie zum Ausdruck, aber nicht eine solch extrem negative Beurteilung tatsächlicher oder vermeintlicher Gegner. Dorothee Schmitz-Köster vermutet dahinter einen „psychologischen Mechanismus“, der die notwendige Basis darstelle, um sich auf eine derart brutale kriegerische Auseinandersetzung wie jener an der Ostfront überhaupt einstellen zu können. „Man muss dann einen Feind haben. Sonst kann man das nicht.“