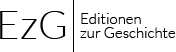Gisbert Kranz: Familiengeschichte
Crantz in Steele.
Die Ahnen
Ein Büchlein, in dem geschrieben steht wie ich den Spuren meiner Vorfahren folgte // gewidmet seinen lieben Eltern und der ganzen Familie Kranz von Gisbert Kranz
Weihnachten 1937.
Greifenkoven in Dahlen.
„Ahnenkult und Ahnenstolz haben ihren tiefen Sinn. Es ist nicht gleichgültig, aus welchem Blut wir stammen; denn unsere Vorfahren gehen immer leise mit uns durchs Leben und färben, uns selber unbewußt, all unser Tun.“
J. Kurz.
Vor einigen Jahren noch gab es Leute, die die Namen aller Sportgrößen kannten, doch nicht wußten, wie ihre Großeltern hießen. Es gibt auch heute noch einige solche, doch dies sind nur wenige; fast jeder junge Deutsche weiß heute über seine Ahnen Bescheid. Denn heute beschäftigt man sich wieder mehr mit der Familienforschung als früher. In Schule und Hitlerjugend wird darüber ausführlich gesprochen; Wettbewerbe regen die Jugend an, Sippenkunde zu betreiben; bei vielen Gelegenheiten wird der Ahnennachweis ver-
langt, der zukünftige Ausweis eines jeden Deutschen. Es ist jetzt schon oft Bedingung für den Eintritt in einen Beruf (Beamten, Offiziere). Seite um Seite der Kirchenbücher fotografiert man, um diese für die Familienforschung wertvollsten Quellen der Zukunft zu erhalten. In großzügiger Weise arbeiten die großen Staats- und Stadtarchive, die Kirchen- und Adelsarchive Hand in Hand mit den anderen für Familienforschung zuständigen Stellen. So wird heute alles getan, dem deutschen Volke die Liebe zu den Ahnen und so die Ehrfurcht vor sich selbst zu wecken; so werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es möglich ist, Familienforschung systematisch zu betreiben. Und das ist gut so. –
Es ist klar, daß man in einem Deutschland, das wieder auf seine Stammesart stolz ist und die Werte der Familie erkennt, auch die Ahnen aus der Vergessenheit herausholt und sich seines Blutes bewußt wird. Denn jeder ist zusammengesetzt aus seinen vier Großeltern, acht Urgroßeltern und sechzehn Alteltern; jeder trägt die Erbanlagen seiner Ahnen in sich. Also ist das Hauptziel der Ahnenforschung, seine Erbanlagen und die Zusammensetzung des Blutes, vielleicht auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse zu erkennen (was aber nur sehr selten möglich ist). –
Wenn bisher von Familienforschung die Rede war, so dachte ich vor allem an die Ahnenforschung. Ihre Ergebnisse trägt man in die Ahnen- oder
Vorfahrentafel ein, die Namen und Daten der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. enthält. Es gibt auch noch andere Darstellungsformen der Familienkunde. Dazu gehört an erster Stelle der Stammbaum, der bisher wohl die bekannteste und meistgebrauchte Art war. Er faßt die Nachkommen eines Stammvaters zusammen. Wenn man daran auch die Größe und Gesundheit eines Geschlechtes erkennen kann, darf man doch sagen, daß der Stammbaum nur eine Spielerei ist. Biologischen Wert erhält die Tafel erst dann, wenn sie ohne Rücksicht auf den Familiennamen auch die Nachkommen der Töchter führt. Sie wird dann zur Nachkommen- oder Nachfahrentafel. – Eine andere Art ist die Sippschaftstafel. Bei der Aufstellung einer
solchen geht man von sich aus, wie bei der Ahnentafel, zeichnet aber außer den Eltern und Großeltern auch noch deren Geschwister und die angeheirateten Personen auf, also Oheime, Muhmen, Großoheime, Großmuhmen, Vettern und Basen (Leider sind diese alten deutschen Worte durch die französischen Bezeichnungen Onkel und Tante, Kousin und Kousine verdrängt worden. Auch die Worte Großvater und Großmutter sind eine Nachäffung des französischen grand-père, grand’mère. Der „Ahn“ ist heute nur noch Sammelbegriff für alle Vorfahren. In Oberbayern und Tirol lebt dieses Wort noch in „Aeni“ fort.). –
Die wichtigste Art der Familienkunde ist ohne Zweifel die Ahnenforschung. „Wir müssen wieder Ehrfurcht vor den
Ahnen haben. Dazu hilft uns die Familienforschung. Wer nicht weiß, wer seine Vorfahren waren, wo und wie sie lebten, in welchem Beruf sie tätig waren und dergleichen mehr, der kann in kein inneres Verhältnis zu ihnen treten.“ –
Zu einer Ahnentafel gibt es verschiedene Wege. Der einfachste und sicherste geht über die Standesämter und Kirchenbücher. Ein anderer Weg ist das Zusammenstellen einer Ahnentafel nach mündlicher Überlieferung, dem Familienstammbuch, Taufscheinen, Kommunion- und Firmbildern, Schulzeugnissen, Heiratsurkunden, Erbverschreibungen, Militärpapieren, Gerichtsakten, letztwillige Verfügungen und Totenzettel. Jeder, auch wer den ersten Weg einschlägt, muß zuerst diese Unterla-
gen haben, die in jeder Familie vorhanden sind. Papiere solcher Art sind jedoch keine amtlichen Urkunden. Auch die Daten der Totenzettel, außer dem Sterbetag, sind nicht immer richtig. Dieser Weg ist interessanter als der erste, weil man außer den bloßen Daten auch noch allerlei anderes erfährt, was manchmal von großer Wichtigkeit ist. Doch ist diese Methode unsicher und lückenhaft; man kann nicht alle Daten mit Bestimmtheit festlegen. – Am besten, man geht beide Wege zusammen, wenn sie auch oft auseinander gehen; am Ende kommen sie doch in demselben Ziel zusammen. Geduld muß man auf beiden Wegen haben. Es geht nicht immer so schnell, wie man wünscht. Oft tauchen ungeahnte Hindernisse auf.
Nur durch systematische Arbeit räumt man solche Schwierigkeiten aus dem Wege. Dafür hat man aber auch einen schönen Erfolg, und manchmal macht man interessante Entdeckungen. –
Wie bin ich nun zur Ahnenforschung gekommen? Ich hatte mir schon immer vorgenommen, meine Ahnentafel aufzustellen, war jedoch von anderen Arbeiten, die mir zuerst wichtiger erschienen, abgehalten worden. In der Schule hatten wir im Deutschunterricht besprochen, wie man eine Ahnenkartei anlegt. Ich war ganz begeistert davon, doch schob ich die Arbeit immer wieder auf, bis eines Tages (13.XI.1935) mein Großvater starb. Obwohl dieser seine Eltern früh verlor (den Vater hatte er überhaupt nicht gekannt), hätte er
mir doch sicher noch manches erzählen können, was mein Vater nicht mehr weiß. Wenn wir ihn nicht aufforderten, erzählte er wenig über seine Jugendzeit und seine Verwandten. Jetzt war er tot. Von meinen Großeltern lebte nur noch meine Großmutter mütterlicherseits, die in Rheindahlen wohnte. – Das alles fiel mir beim Tode meines Großvaters ein. Trotzdem wartete ich noch ein Jahr, bis ich mit der Ahnenforschung begann. Warum ich solange zögerte, ist mir selbst heute unbegreiflich. Unser Deutschlehrer sagte damals: „Fangt sofort an, ihr wißt nicht, wie lange eure Großeltern noch leben!“ –
Wie jeder Familienforscher fing ich damit an, mündliche Nachrichten
Laurenz Friedrich Kranz.
geb. 7. Oktober 1858.
gestorb. 13. November 1935.
zu sammeln. Ich ließ mir von meinen Eltern erzählen, was sie von ihren Eltern erzählen, was sie von ihren Eltern und den anderen Verwandten wußten. Eine weitere Fundgrube für mich waren alte Geschäftsbücher, Rechnungen, Briefe und ein ganzer Packen Gerichtsakten, die mein Vater im Geldschrank aufbewahrt hielt. –
An einem regnerischen Sonntagnachmittag wurden diese Bücher und Akten hervorgeholt. Einzeln der Reihe nach sahen wir alle durch. Da war zuerst das älteste Geschäftsbuch, das von unserer Firma vorhanden war, aus dem Jahre 1767. Es war schon ganz vergilbt, und die Umschlagdeckel fehlten. Andere Geschäftsbücher aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts folgten. Dann
ein ganzer Berg von Schriftstücken: Quittungen, Rechnungen, Kaufkontrakte, Briefe, [.?.]hungsberichte, Schriften über K[.?.]handel, Schriftstücke des „Königl. Preuss. Essen-Werdenschen Bergamtes“, Testamente, und noch mehr. Die Namen meiner Ur-Ur-Ur-Großeltern tauchten auf. Dann blätterten wir eine große Anzahl Gerichtsakten durch. Ein Päckchen trug die Aufschrift: „Rechnungen der Zeche Pfaffenberg bei Baldeney an den Joh. Heinrich II Krantz. 1839-1840. Allerlei kleine Entdeckungen machen wir da, so zum Beispiel, daß der Name Kranz früher Krantz geschrieben wurde, daß meine Ahnen Gewerke waren, daß der Kaufmann Hugo Stinnes zu Mülheim a. d. Ruhr (ein Vor-
fahr des heutigen berühmten Großindustriellen gleichen Namens) uns verschuldet war, und noch vieles mehr. Aus einem Bilanzbuch von 1848, in dem der Warenbestand genau auf Stück und Wert aufgezeichnet ist, sahen wir, daß wir früher ein Gemischtwarengeschäft hatten und neben Eisenwaren, Werkzeugen und Küchengeräten auch Waffen, Munition, Taback, Lebensmittel, Speck, Wurst, Weine, Spezereien, Weiß- und Kurzwaren führten. Daneben hatten wir noch eine Schmiede, eine Schlosserei und eine Wirtschaft. – Es war schon spät am Abend, als wir die Akten und Bücher wegräumten. Stundenlang hatten wir in staubigen Papieren gewühlt und in vergilbten Büchern geblättert. Es war ein Er-
lebnis für meinen Vater und meine Brüder, der Anfang der Ahnenforschung aber für mich. Ein Bild unserer Vorfahren war vor unserem geistigen Auge entstanden, ein Bild aus vergangenen Zeiten, die längst überholt sind. Unsere Vorfahren sind tot – und doch leben sie; sie leben in uns. Wir haben ihr Blut. –
Wertvolle Unterlagen bot mir ein „Stammbaum der Familie Kranz in Steele“, den mein Großonkel Dr. Gisbert Kranz zusammengestellt hatte. Mit Hilfe dieses Stammbaumes konnte ich meine Ahnen väterlicherseits aufzeichnen, die Kranz-Linie sogar 8 Generationen weit bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Der älteste Ahn ist „Theodor Crantz
ex Bottrop“. Die Eltern dieses Mannes konnten nicht mehr festgestellt werden, da die Kirchenbücher der St. Kyriakus-Pfarre in Bottrop nach Dr. Gisbert Kranz keinen Anhaltspunkt mehr gaben für die Annahme, daß Crantz dort ansäßig gewesen sei. Das erste Datum über Th. Crantz steht in den Kirchenbüchern der St. Laurentius-Pfarre in Steele; am 3. Jan. 1746 heiratete er M. K. Plümer aus Steele. –
Dann hatte ich noch einen Stammbaum der Familie Stübben in Hülchrath, der von Dr. Herm. Josef Stübben „unter Benutzung von Aufzeichnungen aus dem Jahre 1890 von Franz J. Stübben und von Auskünften zahlreicher Familienmitglieder“ zusammengestellt worden ist. So konnte
ich auch die Ahnen meiner Großmutter väterlicherseits aufzeichnen, die Stübben-Linie bis 1695. –
In einem Aufsatz vom 26.II.1937 schrieb ich über meine bisherige Familienforschung folgendes: „Noch nicht lange treibe ich Ahnenforschung. Ich bin spät damit angefangen. Leider – denn von meinen Großeltern lebt nur noch die Großmutter mütterlicherseits. Mein Großvater väterlicherseits ist vor eineinhalb Jahren gestorben. Er wohnte bei uns. Von ihm hätte ich noch manches erfahren können, was mein Vater nicht mehr weiß. Ich habe vor, die Familiengeschichte und eine Ahnentafel in Fraktur niederzuschreiben. Als Quellen für die Familienchronik dienen mir die
Aussagen meiner Eltern und meiner noch lebenden Großmutter in Rheindahlen, die ich bald besuchen werde; ferner mehrere Pakete mit Briefen, Urkunden, alten Geschäftsbüchern, usw. Als Quellen für meine Ahnentafel benutze ich zwei Stammbäume der Familien Kranz und Stübben. Hiernach habe ich eine vorläufige Ahnentafel zusammengestellt, die bis zum Jahre 1695 zurückreicht und 8 Generationen umfaßt. Allerdings geht es nur mit den Ahnen meines Vaters so weit. Mütterlicherseits ist es mit den Großeltern zu Ende, da meine Mutter ihre Großeltern außer einer – nicht mehr gekannt hat. Ich hoffe, daß ich bei meinen Verwandten in Rheindahlen mehr erfahre, wenn
ich sie demnächst besuche.... –
Nicht alle meine Ahnen waren Kaufleute. Sehen wir uns die Ahnentafel weiter an, so finden wir Handwerker, Schlosser, Bäckermeister, Schuhmachermeister. Die Vorfahren meiner Großmutter väterlicherseits, der Franz Kehren aus M. Gladbach, waren Färbereibesitzer. Der Vater meiner Mutter war Kaufmann. – Meine Großmutter mütterlicherseits ist eine geborene Gripekoven. Die Gripekoven sollen von Raubrittern abstammen. Doch das ist nur eine Annahme, die aber begründet ist. Wie gesagt, ich habe über die Ahnen meiner Mutter noch viel zu forschen. – Sehen wir uns die beiden Stammbäume von Kranz und Stübben an, so finden wir alle Berufe, die
es gibt. Am meisten sind Juristen und Kaufleute vertreten. Auch Bauern, Lehrer, Beamte, Ärzte, Fabrikbesitzer und Ingenieure finden wir. Ganz einfachen Leuten stehen hervorragende Männer gegenüber: ein Multimillionär, ein Konsul in Kairo usw. Interessant ist, daß viele nach Amerika ausgewandert sind. Auch in England, Belgien, Österreich und Italien haben wir Verwandte. – Ahnenkunde – Sippenkunde, zwei Begriffe, die heute jeden Deutschen angehen. Wir erkennen, daß wir Deutsche alle verwandt und versippt sind. Wir erkennen, daß wir unter unseren Ahnen Arme und Reiche, Hohe und Niedrige, Beamten und Arbeiter, Bauern und Soldaten haben. Wir erkennen, daß das deutsche Volk
eine Blutsgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft ist.“ –
Soweit mein Aufsatz.
„Ihre Geister wurden lebendig, Pforten taten sich auf, ich hörte ihre Geschichte, und mit einem Male fühlte ich mich als Glied einer Kette, einer Familie. Ich war nicht mehr zusammenhangslos in dies Leben hineingestellt, der Blutstropfen regte sich und pochte an die Wand: Du bist ein Deutscher!“ Ludwig Finckh.
Der erste Abschnitt meiner Ahnenforschung lag hinter mir. Jetzt wäre es an der Zeit gewesen, amtliche Urkunden zu sammeln und einen sogenannten Ahnenpaß anzulegen. Ich wäre dann in der Ahnenreihe noch viel weiter gekommen. Doch vorläufig fehlte mir das Geld, das für die Anschaffung eines Ahnennachweises unbedingt nötig ist. So war ich darauf angewiesen, auch bei der Erforschung der Ahnen mütterlicherseits anderes Material zu sammeln. –
Ich beschloß also, nach Rheindahlen zu fahren und dort nach geeignetem
Material herumzustöbern. Zuerst wollte ich meine Großmutter in den Osterferien besuchen, doch es wurde nichts daraus, denn im März starb Onkel Josef, ein Stiefbruder meiner Mutter, der das Geschäft in Rheindahlen führte. So mußte ich bis zu den Pfingstferien warten. – Während dieser Zeit besuchte uns Oma mit Tante Aloisia. (30.IV.) Ich hatte ihr schon öfters über meine Familienforschung geschrieben. Jetzt sagte sie mir: „Jong, ich hab dinge Ur-ur-ur-ur-Großeldere!“ Wobei sie jedes Ur betonte. In ihrer Begeisterung fügte sie noch ein Ur zuviel dabei, wie ich nachher sah, als mir Oma einen Zettel gab, auf dem sie ihre Ahnen aufgeschrieben hatte. Manche der Angaben erschienen mir zweifelhaft, doch freute ich mich da-
rüber, wie sehr Oma sich für meine Ahnenforschung interessierte. Sie sagte mir: „Ich hatte Dag un Nacht de Ahne un de Urgroßeldere em Kopp, ich konnte Nachts nit schlafe!“ – Sie erzählte mir alles, was ich noch wissen wollte, und lud mich zu Pfingsten nach Rheindahlen ein. Ich freute mich natürlich sehr und konnte die Zeit kaum abwarten. – Am 12. Mai schrieb ich Oma und die Sache wurde perfekt. Am frühen Morgen des 15. Mai fuhr ich mit meinem Bruder Karlheinz per Rad von Hause ab, wohlversorgt mit Butterbroten und Obst. Eine Tüte Bonbons hatte uns die gute Mutter auch mitgegeben. Im Affen lag, gut verpackt, ein Geschenk für Oma, das uns Mutter ebenfalls mit-
gegeben hatte. Mit Papier und Schreibzeug hatten wir uns ebenfalls reichlich versehen. Auch nahmen wir einen Fotoapparat mit. – Was soll ich noch viel von der kleinen Fahrt erzählen? Den ganzen Morgen fuhren wir durch Fisselregen, der uns beiden natürlich wenig ausmachte. Den Weg kannte ich fast auswendig; ich war die Strecke schon oft mit dem Rad gefahren. Sie ging über Mülheim – Duisburg – Krefeld – M. Gladbach.
Gegen halb eins waren wir da. Zuerst feierliche Begrüßung und reichliches Mittagessen. Als wir Oma das Geschenk von Mutter auspackten und bei dieser Gelegenheit die vielen Grüße bestellten, sagte sie: „Och, wat muß dat (Mutter) emmer
’n Gedöhns machen. Dat war doch garnich nötig! Nee, dat kann Berta auch nie sein lassen!“ – Wir wurden nach allermöglichen Dingen gefragt, wie es zu Hause gehe, ob das Geschäft klappte, und ich weiß nicht, was noch alles. Als wir alle Fragen geduldig beantwortet hatten, drängte Oma mich, ich sollte mich auf’s Sofa legen; ich wäre so müde. Doch ich ging lieber spazieren, zumal da ich von Müdigkeit nichts spürte. Ich sah mir das liebe Dahlen an, besuchte auch Onkel Josefs frisches Grab und kehrte gegen Kaffeezeit zurück. Tante Aloisia hatte natürlich wieder feinen Kuchen gebacken, sogar drei Stück. Die sollten aber erst am nächsten Tag angebrochen werden; dann war Pfingsten. –
Wir begannen nach dem Kaffee sofort mit unserer „Forschungstätigkeit“, indem wir den Geldschrank im Kontor durchwühlten. Es war aber kein Geld darin, sondern eine Menge alter Gerichtsakten und Geschäftsbücher. Ich war in meinem Element. – Im Nu war das Kontor eine Staubwolke. Mein Bruder, der sich für alte Akten weniger interessierte, holte sich einen Stuhl, stellte ihn in Ermangelung einer Stehleiter an den hohen Geldschrank und holte eine Menge Kisten und Kartons herunter. Der Inhalt war für uns von keiner Bedeutung, außer einem alten „Phonographen“. Das ist ein kurioses Ding. Auf eine Walze, die durch Uhrwerk gedreht wird, steckte man eine Wachsrolle. Eine Nadel, die mit einer Membran
und einem Trichter verbunden ist, kratzt dann über diese Rolle. Wenn man in den zerdüllten Blechtrichter hineinspricht, werden die Worte von der Nadel in die Rolle „eingeritzt“. Nachher kann man die Rolle wieder laufen lassen, und die Worte kommen jetzt aus dem Schalltrichter heraus. Es ist also ein ähnliches Ding wie das Grammofon. – Nun, Karlheinz ließ die vorhandenen Rollen ablaufen. Das Ding quietschte und brummte; wenn man scharf aufpaßte, konnte man abgerissene Melodien von Musikstücken verstehen. Als Tante Aloisia und Oma ins Kontor kamen und Karlheinz am Phonograph arbeiten sahen, sagten sie, es sei auch eine Rolle da, auf die eine Rede Großvaters
bei einem Kränzchen aufgenommen worden ist. Wir ließen die Rolle laufen, konnten jedoch nur einige Sätze verstehen und das Lachen der Gäste heraushören. Zum Schluß hörte man, wie die Leute „Prost, Hugo!“ riefen. Wir lachten laut. Tante Aloisia sagte, zum Schluß riefe Oma: „Süch, da dreht he all widder ’ne Knop ab!“ Opa habe die Angewohnheit gehabt, wenn er in guter Stimmung war, die Knöpfe seiner Weste abzudrehen. Nachher sei er dann beschämt zu Oma hingegangen, sie möchte ihm den Knopf wieder annähen. Von dem köstlichen Satz Omas hatten wir nichts gehört. Wir ließen die Rolle noch einmal ablaufen und hörten zum Schluß so etwas, wie ein Grunzen und
Quietschen, dann die Worte „Knop ab – Knop ab – Knop ab –“, die sich immer wiederholten. An dieser Stelle hatte die Nadel in die Wachsrolle eine tiefe Rille eingekratzt, sodaß sie nicht weiter laufen konnte und immer in derselben Rille stecken blieb. –
Ich nahm die Arbeit an den Akten wieder auf. Tante Aloisia sah mir interessiert zu. Es war da ein alter Akt, in dem der ganze gripenkovensche Besitz an Häusern, Ackerland, Wäldern, Pachten usw. aufgezeichnet war. Es war ein ungeheueres Besitztum. Tante Aloisia sagte lachend: „Da haben wir was von! Jetzt sind wir arm ’ne Kirchenmaus!“ Allerlei Sachen, die mir wichtig erschienen, schrieb
ich ab. Schließlich war Abendessenszeit. Wir mußten Schluß machen. Während dem Essen erstattete ich Oma Bericht über die Ergebnisse meiner bisherigen „Forschung“. Nachher erzählte sie mir noch manches Interessante. –
Am anderen Morgen besuchte ich Tante Linchen, die Schwester Großmutters, die mit Onkel Rudolf, ihrem Bruder, im Hause nebenan wohnte. Dann besah ich die vielen Bilder, die an den Wänden hingen, und ließ mir von Oma und Tante Aloisia erklären, wer auf den Bildern dargestellt war. – Oma sah mit mir eine große Anzahl Totenzettel durch, die sie in einem Kasten gesammelt und in einzelnen Briefumschläge sortiert hatte. Da wa-
ren die Totenzettel meiner Urgroßeltern und vieler anderer Verwandten. Die Doppelten durfte ich behalten; die anderen schrieb ich zum Teil ab. Dann sah Oma noch nach anderen Dingen nach, die mich vielleicht interessieren würden. Als sie eine Schachtel öffnete, machte sie den Deckel schnell wieder zu. Auf meine Frage, was darin sei, antwortete sie: „Nee, dat is nix für dich!“ Ich glaube, es waren Liebesbriefe. – Danach zeigte mir Großmutter ein Fotoalbum, worin viele Bilder von Ahnen und Verwandten waren. Ich entdeckte in dem Bücherschrank, aus dem Oma das Fotoalbum genommen hatte, ein Postkartenalbum. Ich blätterte darin herum, sah auch hinter die Karten und
bemerkte eine Reihe ausländischer Briefmarken. Ich war begeistert, denn ich bin leidenschaftlicher Philatelist. Ich fragte Oma, ob ich die Marken loslösen und behalten könne. Sie hatte nichts dagegen. Mit Dampf löste ich die Marken ab und ..., doch das gehört ja nicht zur Ahnenforschung. –
Nach dem Mittagessen legte Oma, wie immer, sich schlafen; Karlheinz spielte wieder mit dem Fonograf, von dem er sich nicht mehr trennen konnte. Ich aber kroch auf den Speicher. Tante Aloisia hatte mir nämlich gesagt, da oben ständen noch viele Kisten; vielleicht fände ich dort noch ’was. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, kletterte hinauf und kramte in den Kisten
herum. Außer Schulbüchern von Opa, Schülermützen von Onkel Hugo, Puppen von – ich weiß nicht – welcher Tante, und allerlei anderem Gerümpel fand ich alte Gerichtsakten aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts aus der napoleonischen Zeit. Das war etwas für mich! Die Akten waren in Deutsch und Französisch abgefaßt und trugen dicke Siegel. Eine Urkunde (der Kaufakt des Hauses am Wikrather Tor, in dem Oma jetzt wohnte) trug das Datum: „Im zwölften Jahre der fränkischen Republik“. – Außer diesen für die Familienforschung wertvollen Dingen fand ich noch einen Brotbeutel aus dem Kriege von meinem Onkel Hugo. Dieser (der Brotbeutel natürlich) hat mit
der Ahnenforschung nichts zu tun, ich konnte ihn aber gut gebrauchen, da meiner ganz verschlissen war. Es war allerdings ein kleines Loch drin, das von Mäusen stammte; aber das konnte man flicken. Als ich Oma nachher den Brotbeutel zeigte, schenkte sie ihn mir. –
Nach dem festtäglichen Kaffeeklatsch versuchte ich die Ahnentafel meiner Mutter zusammenzustellen. Die Gripekovens hatte ich soweit fertig, doch die Zilges fehlten mir. Großmutter wußte mir darüber auch nichts zu sagen. Doch Tante Aloisia sagte mir, ich sollte mal nach Gripekovens auf der „Gladbacher Chaussee“ gehen. Das seien Verwandte, die einen Stammbaum hätten. Ich ging also mit Karlheinz zusammen hin. Frau Gripeko-
ven sagte, ihr Sohn Rudolf, der verreist war, habe den Stammbaum mitgenommen. Sie zeigte uns aber Bilder von meinen Ur-ur-ur-Großeltern, Martin Loebens und Josefa von Roßbach. Martin Loebens war ein Maler in Köln, seine Frau war als Baronesse zu Haus Klee bei Waldniel geboren. Sie sei blind gewesen. Die Daten standen auf der Rückseite des Bildes drauf. So hatte ich wieder eine Lücke in meiner Ahnentafel ausgefüllt. –
Am Morgen des Pfingstmontages fragte ich Großmutter, ob sie wüßte, welches Wappen Rheindahlen habe. Sie konnte mir darüber keine Auskunft geben. Auch Tante Linchen wußte davon nichts. Ich erinnerte mich, daß bei Prenten, Großmutters Haus gegenüber,
wo wir als Kinder oft waren, ein alter Kupferstich hing, der die Belagerung der Stadt Dahlen darstellte. Vielleicht war das Wappen darauf zu finden. Ich ging also zu Prenten ’rüber, sagte mein Begehren, und die guten Leute zeigten mir das Bild. Auf der rechten Hälfte ist die Stadt Dahlen dargestellt mit ihren Wällen und Türmen (Dahlen war ja früher Festung). Links und im Vordergrund greifen große Truppen an, Kavallerie und Infanterie. Es ist ein interessantes Bild, das wahrscheinlich aus dem 30 jährigen Kriege stammt (Eine Jahreszahl ist nicht angegeben, und die Geschichte Dahlens ist mir unbekannt, als daß ich wußte, wann es einmal belagert worden war. Ebenso fehlt eine Unterschrift; nur der Name Dahlen ist
Oma vor ihrem Haus.
Der Hof.
über die Stadt geschrieben). Das Wappen fand ich aber nicht. Mir kam der Einfall, mal zum Rathaus zu gehen; vielleicht fand ich an der Front, was ich suchte. Und richtig, über dem Portal befand sich ein Wappenschild mit einem querstehenden Balken. Darüber war eine Krone. Ob das nun das richtige Wappen von Rheindahlen ist, weiß ich nicht. –
Wir besuchten dann Onkel Hugo, von dem wir auch noch etwas zu erfahren hofften. Zu unserem Erstaunen hatte dieser einen fertigen Ahnenpaß, sodaß wir nur noch unsere Daten mit denen im Ahnenpaß vergleichen und die Lücken ausfüllen konnten. Doch wir waren sehr froh darum. Gefreut haben wir uns, als wir unter unseren Vorfahren eine Anzahl Bau-
ern fanden. –
Mittags machte ich trotz des stark bedeckten Himmels auf dem Hofe drei Aufnahmen von Oma und Tante Aloisia. Ich mußte allerdings lange belichten. Dies waren die letzten Aufnahmen von Oma. – Ich wollte auch noch zur Burg Gripekoven. Doch Onkel Hugo sagte mir, von der Burg sei nichts mehr da, höchstens noch ein paar Steine. –
Am Nachmittag fuhren wir mit den Rädern nach Dülken, um Tante Nettchen zu besuchen. Das Wetter hatte sich etwas aufgeklärt. Tante Nettchen war über unseren Besuch sehr erfreut. Kurt zeigte uns die Druckerei. Wir mußten mit Kaffeetrinken, wobei wir uns manches erzählten. Bei unserem Abschied gab uns Tante Nettchen noch
Tante Aloisia, Oma und Karlheinz.
Der Hof mit der alten Pumpe.
eine Flasche Sekt für Oma mit. Sie sollte sich „einen antrinken“. Als wir das Oma nachher wiedererzählten und ihr die Flasche überreichten, hatte sie großen Spaß; denn einen guten Trunk verachtete sie nicht. –
Am anderen Morgen fuhren wir nach Hause. Oma wollte uns noch länger dahalten, doch ich brannte darauf, meine Ahnentafel fertigzustellen. So verabschiedeten wir uns und fuhren über Dülken, wo wir Tante Nettchen nochmal besuchten, nach Hause zurück. –
IV.
Jetzt begann für mich eine arbeitsreiche Zeit. – Meine Mutter hatte eine Abschrift des Buchs von Karoline Hoster, geborene Gripekoven, einer Schwester meines Urgroßvaters: „Erinnerungen aus meiner Jugendzeit und späterem Ehestande“. Dies Heftchen, voll von netten Anekdötchen, sprühend von Witz und Humor, versah ich mit Anmerkungen. Für meine Familienkunde hatte dieses Buch eine große Bedeutung, da K. Hoster alle ihre Verwandten schildert; sogar von ihrer Großmutter schreibt sie, meiner Ur-ur-ur-Großmutter.
– Dann legte ich eine Ahnenkartothek an. Ich kaufte mir 100 Postkarten. Am oberen Rande jeder Karte klebte ich einen Streifen Papier auf, um die Karte zu verstärken und auch, um die Vordrucke zu verdecken. Links oben kam – in römischen Ziffern – die Nummer des Geschlechts, rechts die Nummer in der Ahnentafel. Nummer 1 war ich, 2 und 3 meine Eltern, 4-7 meine Großeltern usf. Auch nahm ich oft Geschwister von Ahnen in die Kartei auf. So bezeichnete ich meine Onkel mit 2a, b, c, 3a, 3b, 3c usf. So kann ich die Kartei auch als Sippschaftskartothek verwenden. – Wo sonst auf der Postkarte die Adresse steht, also auf der rechten Seite, schrieb ich Vor- und Familiennamen sowie den
Beruf hin; auf der linken Seite standen die Eltern der Person, die Daten und die Namen der Frau (bezw. des Mannes) und der Kinder. Auf die Rückseite schrieb ich den Lebenslauf, meistens nach dem Totenzettel, oft auch Auszüge aus dem Tagebuch von Karol. Hoster. Zuweilen vermerkte ich auch die Namen der Taufpaten und Trauzeugen. –
Stolz darauf bin ich, daß die Ehen meiner Ahnen reich mit Kindern gesegnet waren. Väterlicherseits ist der Durchschnitt 7 Kinder auf jede Ehe; bei den Ahnen meiner Mutter habe ich je Ehe durchschnittlich 9 Kinder ausgerechnet. –
Als ich die Kartei fertig hatte, legte ich eine Ahnentafel in Frakturschrift von der Größe 1,00 x 1,60 m an. Es war eine schwierige Arbeit. Da ich einen
Ahnen der Gebrüder Kranz
Wappen der Stadt Steele
Wappen von Rheindahlen
Tisch von solcher Größe nicht hatte, mußte ich die Vorzeichnungen auf dem Boden machen. Auf die Tafel malte ich auch noch drei Wappen: Das Steeler-Wappen mit den drei schwarzen Ringen auf gelbem Grund, das Wappen der Stadt Rheindahlen mit rotem Querbalken im grünen Grund und der Krone (die Farben habe ich selbst gewählt), und schließlich unser Familienzeichen. Dieses habe ich allerdings selbst entworfen. Es zeigt auf rotem Grund einen grünen Kranz, mit dem Merkurstab (Zeichen der Kaufleute). Zu der Titelseite dieses Heftes, auf der diese drei Wappen abgebildet sind, entwarf ich noch ein viertes, das Familienwappen der Gripekovens. Der Name Gripekoven war, wie Karol. Hoster in ihrem Buch „Erinnerungen“
schreibt, früher Greifenkoven. Nach ihrer Meinung rührt der erste Bestandteil des Namens von dem sagenhaften Vogel Greiff her. Der zweite Teil des Namens sei das Dorf Hoven. So zeichnete ich in die obere Hälfte des Wappenschildes den Vogel Greiff, unten drei Fachwerkhäuser – das Dorf Hoven – ein. Über dem Wappen steht ein Ritterhelm zum Zeichen dafür, daß die Ahnen der Gripekoven einst Raubritter waren. Das letzte ist eine zweifelhafte Annahme, die man aber gerne glaubt. – Die Ahnentafel wurde auf einer Ausstellung „Volksgemeinschaft – Blutsgemeinchaft des Karl Humann-Gymnasiums am 18. Juli ausgestellt. –
So bin ich zu einer Ahnentafel gekommen, die sich über acht Generationen bis zum Ende des 17. Jahrhun-
derts erstreckt, ohne daß ich selbst die Kirchenbücher und Standesämter befragt hatte. Trotzdem kann ich sagen, daß die Angaben im großen und ganzen richtig sind (außer die beiden ältesten Generationen). Die Vorfahren meiner Mutter habe ich nach dem Ahnennachweis meines Onkels aufgeschrieben. Die Ahnen meines Vaters haben mein Großonkel Dr. Gisbert Kranz und Dr. Hermann Jos. Stübben zum großen Teil mit Hilfe der Kirchenbücher zusammengestellt. So habe ich selbst keine richtige „Forschungsarbeit“ geleistet, sondern nur Material zusammengetragen. Trotzdem hat es mir großen Spaß gemacht. –
Wenn ich später einmal das Geld dazu habe, hoffe ich, die noch bestehenden Lücken auszufüllen und noch weiter zu forschen. –
V.
In den Sommerferien ging ich mit meinem Freund auf große Fahrt nach Südwestdeutschland. Wir waren am Bodensee gewesen. Als wir uns auf der Rückfahrt befanden, ereilte mich in Freiburg die Nachricht vom Tode meiner Großmutter. – Als ich diese Botschaft erfuhr, lag meine liebe Oma schon vier Tage unter der Erde. Am Freitag, den 23. Juli, war sie plötzlich verschieden. Ich war zu der Zeit in Heidelberg. –
Jetzt habe ich keine Großeltern mehr. Es ist gut, daß ich Oma Pfingsten noch besucht habe. Hätte ich es aufgeschoben,
Katharina Gripekoven.
* 22.9.1858.
+ 23.7.1937.
wäre manches für die Ahnenforschung verlorengegangen. – Als ich von der Fahrt zurückkehrte, konnte ich auf der Ahnentafel das Sterbedatum meiner Großmutter eintragen... – Meine Mutter litt sehr unter diesem Schicksalsschlag. 78 Jahre alt war Oma geworden. Sie starb auf St. Appollinaris, den sie so sehr verehrt hatte. Seitdem sie 1911 eine schwere Kopfgrippe gehabt und dem hl. Appollinaris eine Wallfahrt gelobt hatte, wenn sie gesund würde, war sie jedes Jahr zur Kirche des Heiligen in Remagen gepilgert, selbst in ihrem Alter noch. In diesem Jahr konnte sie wegen ihrer Schwäche nicht mehr die gewohnte Wallfahrt machen. Am Morgen ihres Todestages hatte sie zu Tante Aloisia gesagt, wie leid es ihr tue,
daß sie nicht nach Remagen fahren könne. Sie war nicht – wie man sagt – ganz auf dem Damm. – Tante Aloisia putzte gerade, da hörte sie Großmutter schreien. Sie eilte hinzu und find die fallende Frau auf. Nach ein paar qualvollen Augenblicken, in denen sie angstvoll nach Atem rang, gab sie ihren Geist auf. Tante Aloisia rief sofort den Arzt, der nur noch den Tod feststellen konnte. Der herbeigeeilte Geistliche erteilte der Toten die hl. Ölung bedingungsweise. Jeden Morgen war sie in der Frühmesse zum Tisch des Herrn gegangen. Auf ihrem Nachttischchen fand man noch das offene Gebetbuch liegen...
VI.
Meine Mutter fuhr nach dem Tode Omas öfters nach Rheindahlen. Sie brachte mir jedesmal Akten und Bücher mit, worüber ich mich sehr freute. – Meine Kusine Anita in Dülken schickte mir einen Artikel aus einem Buche über die Burg Gripekoven. So bekam ich immer mehr Material zusammen, sodaß ich endlich mit der Verwirklichung des Planes, ein Familienarchiv einzurichten, beginnen konnte. –
In den Herbstferien vom 8. bis zum 12. Oktober war die beste Gelegenheit dazu. Zuerst galt es, einen geeigneten
Platz zu bekommen. Auf meinem Arbeitszimmer hatte ich einen Wandschrank. In diesem bewahrte ich Bücher und andere Dinge auf. Ich mußte ihn nun ausräumen. Material hatte ich genug. Nur mußte ich alles ordnen, eine große Arbeit, die viel Geduld erforderte, doch auch viel Zeit beanspruchte, die ich ja in den Ferien genug hatte. – Ich unterteilte das ganze Archiv in Abteilungen und numerierte jedes Stück. Alles trug ich in ein Verzeichnis ein. Als alles fertig war, bestand das Archiv aus 15 Abteilungen. I. Geschäftsbücher von Steele und sonstige Bücher. II. Alte Schriftstücke, Steele. Quittungen, Briefe, Notizbücher, usw. III. Rechnungen der Zeche Pfaffenberg bei Baldeney. IV. Schriften des Königl. Preuss. Essen-Werdenschen Berg-
amtes. V. Gerichtsakten (Steele). Kaufkontrakte, Hypothekenscheine, Testamente usw. VI. Bücher, Hefte usw. (Dahlen). Rezeptbücher, Schulhefte, Tagebücher. Schulhefte von Berta Zilges. Schulhefte von Gisbert Kranz jun. Tagebücher des Gisbert Kranz jun. Kinderbriefe der Gebrüder Kranz. VII. Verschiedenes. Urkunden, Stammbaum der Familie Kranz, Stammbaum der Familie Stübben, Ahnenkartei, Erinnerungskreuz aus dem Feldzuge 1866. VIII. Akten (Rheindahlen). Verträge, Testamente, Rechnungen, Liquidationen, Kaufakten. IX. Totenzettel der Familien Kranz und Zilges. X. Fotografien. Fotoalbum (Steele), Fotos von Verwandten und Bekannten, Bilder aus dem Kriege, Großaufnahmen. Fotoalbum von Maria Zilges, Fotos aus Dülken und Rheindahlen. XII.
Verschiedene Schriftstücke. Rechnungen, Briefe, Aktienscheine, Briefe an Behörden, Testamente, Schulzeugnisse. XIII. Zeitungen. – Dazu kommen noch Ahnentafeln, Kommunionbilder, Diplome, usw. –
So hatte ich ein Familienarchiv zusammengestellt, um das mich mancher beneiden konnte. Im ganzen sind 1500 verschiedene Akten, Fotos usw. vorhanden, darunter sehr viele Dinge, die über 100 Jahre alt sind, einige, die aus der napoleonischen Zeit stammen. Das älteste Stück des Archivs ist wohl das Geschäftsbuch aus dem Jahre 1767. –
Als meine Mutter, die wieder nach Rheindahlen gefahren war, nach den „Kartoffelferien“ wiederkam, brachte sie mir eine Menge neuer Dinge für mein Archiv mit. Ich freute mich natürlich sehr da-
rüber. Es kam noch sehr vieles im Laufe der Zeit hinzu, und auch jetzt ist das Archiv noch nicht abgeschlossen. –
Noch vieles im Archiv war zu ordnen, so vor allem die Fotografien. Mit Vater und Mutter sah ich mir alle Bilder durch, und sie mußten mir sagen, wer auf jedem Foto abgebildet war. Dann ordnete ich die Fotos nach Generationen und heftete sie in das dicke Album ein. Unter jedem schrieb ich den Namen, sowie Kartei- und Archivnummer. So hatte ich bis zum Ende des Jahres immer noch hier und da Mängel im Archiv zu beseitigen, Neues hinzuzufügen und den Schrank fein auszugestalten. –
Ich machte auch noch ein alphabetisches Verzeichnis aller Ahnen und Verwandten und schrieb zu jedem Na-
men die betreffenden Archivnummern. Mit Hilfe dieses Namenregisters ist es mir möglich, in wenigen Augenblicken alle Archivstücke zur Hand zu haben, die über eine bestimmte Person Auskunft geben können. –
Zu Weihnachten schenkte ich meinen Eltern einen Stammbaum in Frakturschrift und ein Bild meiner beiden Großeltern, die ich gekannt hatte. Das Bild hatte ich nach nebenstehendem Foto gemalt. –
In den Weihnachtstagen entstand dieses Werk, mit dem – wie ich wohl sagen darf – ein arbeitsreiches Jahr abgeschlossen wurde. – Für mich war die Familienforschung eine große Freude und zugleich ein Erlebnis, aber auch ein Erfüllen einer selbstverständlichen Pflicht den Vorfahren und der Familie
Oma und Opa.
gegenüber. Das Archiv der Familie Kranz wird späteren Geschlechtern eine Fundgrube des Wissens über die Ahnen sein. –
„Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt,
Der froh von ihren Taten, ihrer Größe
Den Hörer unterhält und still sich freuend
Ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht.“
Goethe.