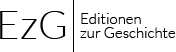Hubert Schäfer
Dieser Briefwechsel wurde dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln von Hubert Schäfers Tochter Dorothea Schokking zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür! Er beinhaltet in erster Linie Briefe, die er als Wehrmachtssoldat an seine Familie in Köln-Neuehrenfeld richtete. Es sind aber auch Schreiben enthalten, die Hubert Schäfers gleichnamiger Vater mit seiner Frau Elisabeth wechselte. Ergänzt werden die Selbstzeugnisse aus der Feder von Hubert Schäfer von einem Reisetagebuch, das er im August 1940 verfasste und das im Rahmen der EzG hier einzusehen ist. Der Nachlass von Hubert Schäfer wurde dem NS-Dokumentationszentrum von dessen Tochter Dorothea Schokking zur Verfügung gestellt und dort unter N 589 archiviert.
Johannes Schäfer, der älteste Sohn von Liesel Schäfer-Strausfeld und Hubert Schäfer, stellte dem Projekt am 17. September 2019 folgende Kurzbiografie seines Vaters zur Verfügung:
„Unser Vater, Hubert Schäfer, wurde am 7.November 1922 in Köln-Ehrenfeld geboren.
Seine Mutter war Elisabeth, die als eins von sieben Kindern der Familie Thomas 1890 in der Ehrenfelder Marinstraße geboren worden war. Sein 1891 in Oberwichterich - heute ein Stadtteil von Euskirchen - geborener Vater Hubert arbeitete vor allem als Bäcker und Gärtner. Er war zudem Teilnehmer beider Weltkriege. Neben Sohn Hubert hatte das Ehepaar zwei ältere Töchter: die 1917 geborene, später mit Franz Haas verheiratete Anna und die drei Jahre jüngere Elisabeth („Lisa“), die 1941 Ewald König heiratete, der kurtz darauf in Russland ums Leben kam. Die Familie bewohnte in einem um 1930 errichteten Neubaugebiet in Köln-Neuehrenfeld eine Genossenschaftswohnung in der Gravensteiner Straße.
Hubert Schäfer besuchte die Volksschule in der Nussbaumerstraße. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre bei der Firma Heinrich Rohr in der Geisselstraße in Ehrenfeld, die Modelle für die Maschinenindustrie herstellte. Seine Gesellenprüfung legte er 30.Oktober 1940 mit guter Benotung ab.
Ein Jahr später wurde der Neunzehnjährige im Oktober 1941 zur Wehrmacht eingezogen und zunächst zum Funker geschult. Erst relativ erfolgten dann tatsächliche Fronteinsätze in Südrussland („Kalmückensteppe“), denen seine Einheit mit Glück entkam, weil sie frühzeitig in den Westen verlegt wurde. Beim Rückzug vor den Westalliierten Richtung Osten wurde Hubert Schäfers Einheit nach Überschreiten des Rheins von einem die Realitäten erkennenden Befehlshaber gegen den ausdrücklichen Willen Hitlers aufgelöst. Er überquerte - de iure als Deserteur - mit Hilfe eines anderen jungen Mannes den Rhein bei Leverkusen mit einem selbstgebauten Boot, um danach zunächst unterzutauchen, bis die Amerikaner Mitte April 1945 auch das rechtsrheinische Köln eingenommen hatten. Es folgten zwei Monate in einem der Rheinwiesenlager – wahrscheinlich in Remagen -, danach die Entlassung nach Hause.
Dort konnte er seine Arbeit bei der Firma Rohr wieder aufnehmen. Zugleich engagierte er sich stark in der katholischen Jugendarbeit seiner unmittelbar am Elternhaus gelegenen Heimatpfarre St. Barbara am Ansgarplatz ein. Hierbei lernte er im November 1946 Elisabeth Strausfeld kennen, die zu dieser Zeit in der weiblichen katholischen Jugend Kölns eine führende Rolle spielte.
Beruflich bereitete sich Hubert Schäfer – finanziell von seinen beiden Schwestern unterstützt - auf die Meisterprüfung vor, die er dann am 4.November 1948 bestand. Als 1949 oder 1950 der Firmeninhaber verstarb, übernahm er als einziger angestellter Meister faktisch die Leitung des kleinen Betriebs mit rund zehn Beschäftigten, wobei die Witwe Rohr aber stets seine „heißgeliebte Chefin“ blieb, als die er sie stets bezeichnete.
Familie Schäfer wuchs in den Nachkriegsjahren, und als sich 1956 das fünfte Kind ankündigte, gelang es durch einen Tausch, in das „Häuschen“ in der Brentanostraße einzuziehen, das – ebenfalls unmittelbar an der St. Barbara-Kirche gelegen – künftig das Familiendomizil darstellte. Es war zwar von denkbarer einfacher Ausstattung, war aber in sich abgeschlossen und verfügte über einen Garten."
An anderer Stelle finden sich in den EzG zudem die umfangreichen Materialien von Liesel Schäfer-Strausfeld, die dem NS-DOK teils noch von ihr selbst, in weiteren Teilen ebenfalls von Frau Schokking überlassen wurden.
1950 verfasste Hubert Schäfer einen kurzen Lebenslauf, der hier zur Orientierung über seine Person, seine Einstellung und seine Aktivitäten hier zum Abdruck kommt:
„Hubert Schäfer, Köln-E'feld, den 14.7.50
Köln-Ehrenfeld,
Gravensteinerstr. 8
Lebenslauf!
Am 7.11.1922 wurde ich, Sohn des Bäckers Huber Schäfer und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Thomas, geboren. Vom 6. Lebensjahre an besuchte ich die kath. Volksschule Köln-Ehrenfeld und wurde dort am 24. März 1937 aus der I. Klasse entlassen.
Am 1. April 1937 trat ich als Modellbauer-Lehrling in die Fa. Heinr. Rohr in Köln-E'feld ein. Gleichzeitig besuchte ich die Fachklasse für Modellbauer und 3 Semester maschinentechnische Abendlehrgänge in der Gew.-Berufsschule Ullrichgasse in Köln. Nach Beendigung meiner Lehre legte ich am 30. Okt. 1940 meine Gesellenprüfung als Modellbauer ab. Anschließend arbeitete ich noch 1 Jahr als Modellbauer-Geselle in meiner Lehrfirma.
Am 1. Okt. 1941 wurde ich zum Militärdienst einberufen. Von 1942 bis 1945 war ich als Infanterist in Rußland und in Frankreich. Von Mai bis Juli 1945 war ich in amerik. und engl. Gefangenschaft. Nach meiner Entlassung aus der Gefangenschaft nahm ich meine Beschäftigung als Modellbauer bei der Fa. Albert Huth in Köln-E'feld wieder auf. Am 3. April 1946 ging ich wieder zur Fa. Heinr. Rohr in Köln-E'feld zurück.
Am 3. Nov. 1948 legte ich vor der Handwerkskammer in Köln meine Meisterprüfung als Modellbauer ab.
Am 25. August 1948 schloß ich die Ehe mit Fräulein Liesel Strausfeld, geb. am 14.2.1924. Nach dem Tode meines Chefs übernahm ich am 29. März 1949 die techn. Leitung der Fa. Heinr. Rohr, wo ich auch heute noch beschäftigt bin.
Hubert Schäfer“
Außerdem liegen von Hubert Schäfer - leider undatierte – handschriftliche Aufzeichnungen über die von ihm erlebte und geleistete Jugendarbeit in der katholischen Kirchengemeinde St. Barbara in Köln-Ehrenfeld vor:
„Jugendarbeit von 1935 bis in den Krieg hinein war weitgehend bestimmt durch die politische Situation. Außer der H.J. der „Staatsjugend” wurden mehr und mehr alle Jugendorganisationen verboten, oder auf den rein kirchlichen Raum begrenzt. Und doch blieben in St. Barbara wie anderswo zahlreiche Jugendgruppen lebendig, die stark von der katholischen Jugendbewegung geprägt waren: Sturmschar + Jungschar sowie Mädchengruppen die sich bald nicht mehr Jungfrauen-Kongreation, sondern kath. Mädchenjugend nannte arbeiteten auch mit stillschweigender Duldung einiger H.J. Funktionäre an Idealen von Reinheit und Wahrheit, sie gingen auf Fahrt und sangen die Lieder der Jugendbewegung, sie lasen Walter Flex und Guardini, die Jugend begann auch mitten in der national-soz. Indoktrination mit einer vorsichtigen Liturgie-Reform.
Gleichzeitig gerieten die aktiven kath. Jugendverbände mehr und mehr in eine Bekenntnis-Situation. Es geschah auch in St. Barbara, dass Jugendgruppen auf einer Sonntags-Osterfahrt verhaftet wurden weil sie keine H.J. Ausweise hatten, ins El.D Haus und für zwei Tage nach Brauweiler gebracht wurden. Es gab Jugendkundgebungen im Dom die zu einem begeisterten Bekenntnis zu Christus wurde und auf dem Domvorplatz mit einer Schlägerei mit dort postierten H.J. Trupps endete, die eine Gegendemonstration versucht hatten.
Mit Beginn und im weiteren Verlauf des Krieges wurden die Sturm-Schar mehr u. mehr dezimiert, die Führer wurden eingezogen, die Nachrichten vom Tod vieler Freunde mehrten sich. Die Mädchen übernahmen viele Funktionen, sie hielten Verbindung mit den Soldaten, sie bereiteten Friedens-Gottesdienste vor und Gedenkfeier. Allwöchentlich gingen einige von St. Barbara zur deutschen Komplet nach Maria im Kapitol. Ab 1943 setzten sie gemeinsam mit den noch zu Hause gebliebenen Jung-männer durch dass auch in St. Barbara jeden Samstag-abend eine deutsche Komplet gesungen wurde. Hier und in einer Jugendmesse mittwochs-morgens um 6 ¼ Uhr traf sich in den letzten Kriegsjahren die kath. Jugend von St. Barbara.
Im Raum unter dem Turm der Kirche, der als Luftschutzkeller diente hielten in den letzten Jahren jede Nacht einige Helfer aus der Jugend Bereitschaftsdienst, die bei Bombenangriffen, die Kirche davor bewahrten, dass sie ganz abbrannte. Nach dem Fliegerangriff am 30. April 44 der die Umgebung der Kirche verwüstete waren es auch die Jugendlichen die im Saal eine Notkirche liebevoll gestaltete in der dann die Gottesdienste stattfanden.
Sofort nach dem Ende des Krieges begannen die Daheimgebliebenen und die Heimkommenden mit Wiederaufbau und der Organisation kirchlicher Jugendarbeit. Es ist schwer, den Elan zu beschreiben, mit der die Jugend und hier auch vor allem die Mädchen sich daranmachten ihr Leben in Gemeinde und der Stadt neu zu gestalten. Es gab wenig zu essen, nichts zu kaufen an Schuhwerk und Kleidern, es gab viel Trümmer und Obdachlosenelend, aber die Jugend organisierte in kurzer Zeit einen Dienst am Bahnhof, der sich um Flüchtlinge kümmerte, einen christlichen Hilfsdienst der sich auseinander gerissenen Familien annahm. Im Winter 1946 gestalteten sie im Pfarrsaal eine Weihnachtsfeier für Flüchtlinge mit einem Theaterstück von Joh. Büchner. Das Gebäck hatten die Mädchen im Schweiße ihres Angesichts gebacken mit Naturalien aus Carepaketen; die Jungens hatten die Brikett bei Nacht + Nebel auf dem Bahndamm gestohlen damit die Backaktion überhaupt möglich war.
Neben diesen und anderen Aktionen die sich vor allem der akuten sozialen Nöte annahmen lebte ein intensives Interesse an religiösen Fragen auf, das nach dem braunen Spuk nun neu nach Sinn und nach der Zukunft frage, außerdem das Bedürfnis nun da es wieder möglich war das Bekenntnis zu Christus zu zeigen. Meine Gruppe nähte ein neues Jugendbanner mit dem Christuszeichen. Es wurde in[?] der deutschen Komplet von Pfarrer Kahles geweiht und am Tag danach am 1. Juli 1945 in der ersten Prozession durch die drei Gemeinden St. Peter, St. Anna nach St. Barbara getragen. Auch unser Schlussaltar vor der Kirche war von der Jugend gestaltet. Auch dieser Altar trug als Hintergrund ein rotes [..] auf weißem Grund. Hunderte von Margeriten und roten Rosen bildeten das Material für diese Symbolwand.
Am 20.9.1945 am Fest der Kreuzerhöhung wallfahrteten wir mit der kath. Jugend der Stadt Köln nach Altenberg. Es sollte ein Sühneweg sein bei dem das Kreuz aus der Krypta von St. M. i. Kapitol und aus den Ruinen der Stadt hinausgetragen wurde in den Altenberger Dom. Dieser Gang war für alle die dabei waren ein ergreifendes Erlebnis gemischt aus Freude darüber das man sein Christsein wieder öffentlich zeigen durfte, aus Gedenken an die im Krieg gebliebenen und dem Bewusstsein der Verantwortung für die Zukunft. Die Wallfahrt endete für unsere J. In der Barbarakirche mit gemeinsamen Lob u. Dankliedern.
Gemeinsames Singen war überhaupt ein wichtiges Element des Zusammenfindens unserer Jugend. Herr Kaplan Zingsheim der als Subsidiär in unserer Gemeine Jugendkaplan wurde führte einen für Mädchen und Jungen gemeinsamen Singeabend ein. Er sammelte auch die aus Gefangenschaft zurückkommenden Soldaten zu einem Heimkehrerkreis, aus dem dann bald Gruppenführer für unsere Jugend hervorgingen. Er arbeitete mit den Gruppen intensiv an der Neugestaltung der Jugendgottesdienste.
Zur Zeit seines Nachfolgers, Herr Kapl. Kreuels entstand in unserer Gemeinde mit Hilfe von Ina Breuer eine Laienspielschar die wirklich Theater auf die Bühne brachte. Sie hatte u. a. „den Rossdieb” von H. Sachs in kölsche Mundart übersetzt der überall, wo er aufgeführt wurde (es gab Gastspielreisen) ein köstlicher Erfolg war.
In den Jahren 46 u. 47 entstanden neben der „Pfarrjugend” auch wieder andere kath. Jugendgemeinschaften wie die „Schar” und die St. Georgs Pfadfinder, die in unserer Gemeinde von Anneliese Blens, die heute in Karmel lebt neu gegründet wurde und sich rasch über die Pfarre hinaus ausbreitete.
Wegen allgemeinen Raummangels mussten die meisten Gruppenabende in Privatwohnungen stattfinden bis sich die männl. Wie die weibl. Jugend je einen Raum im Keller der Kirche unter der ehemaligen Sakristei zurechtgemacht hatten. Die Führer-Schulung die in unserem Dekanat der unvergessene Kpl. Milde leitete ebenfalls in seiner Etagen-Wohnung in Hl. Dreikönigen statt, die fast so etwas wie die erste „offene Tür” für uns alle wurde. Im Übrigen hatte die kath. Jugend keine Freizeitprobleme. So oft es möglich war wurde auf Fahrt gegangen, per Rad, mit der Bahn und zu Fuß zogen die Gruppen nach draußen, machten die Erfahrungen der noch nicht zerstörten Natur, Erfahrungen gemeinsamen Erlebens, Erfahrungen die ihnen niemand mehr nehmen konnte.“