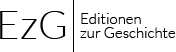Briefgeheimnis und Zensur
Das NS-Regime schränkte die freie Meinungsäußerung und das hiermit eng zusammenhängende Briefgeheimnis unmittelbar nach der Machtübernahme drastisch ein. Das bis dahin als hohes Gut geschützte Grundrecht des Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnisses wurde bereits einen Tag nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 durch die berüchtigte Verordnung „zum Schutz von Volk und Staat“, die sogenannte “Reichstagsbrandverordnung”, außer Kraft gesetzt. Zugleich wurde damit der Polizei und hier insbesondere der Gestapo, „die Möglichkeit gegeben, im Interesse der Staatssicherheit die dem Staat und der Staatsführung durch die Tätigkeit der staatsfeindlichen Elemente drohenden Gefahren durch wirksame Maßnahmen in vorbeugender Weise zu beseitigen oder auf ein Mindestmaß zu beschränken” – so der Text einer offiziellen Darstellung aus dem Jahr 1938. Damit wurde zwar nicht das Briefgeheimnis, wohl aber das Postgeheimnis gebrochen, indem auf entsprechende Anforderung von Gestapo oder dem Sicherheitsdienst der SS Postbeamte Briefe zur inhaltlichen Kontrolle aussonderten und an die Polizei weiterleiteten. Nach Überprüfung der Sendungen wurden freigegebene Briefe und Pakete dann zurück ins Postamt zurückgeschafft und weiterbefördert.[1]
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs erfuhr die Briefzensur eine erhebliche Verschärfung. Etwaige kritische Äußerungen in Feldpostbriefen fielen nunmehr unter den Straftatbestand der „Wehrkraftzersetzung“, der mit Gefängnis, Zuchthaus oder gar mit dem Tode bestraft werden konnte. Die Zahl der von solchen Sanktionen Betroffenen wird immerhin auf 30.000 bis 40.000 geschätzt. Die deutschen Zensurbehörden nahmen ihre Arbeit am 12. März 1940 auf, wobei die Prüfung der Briefe durch die Zensurbehörde des Oberkommandos der Wehrmacht erfolgte.
Die briefliche Übermittlung folgender Inhalte war untersagt:
- Angaben über dienstliche Vorgänge, die der Geheimhaltung unterliegen,
- Gerüchte aller Art,
- Lichtbilder und Abbildungen, die der Geheimhaltung unterliegen,
- Feindpropaganda, zum Beispiel Flugblätter,
- kritische Äußerungen über Maßnahmen der Wehrmacht und der Reichsregierung,
- jegliche Aussagen, die den Verdacht der Spionage, Sabotage und Zersetzung erwecken.
Im Kriegsverlauf war eine deutliche inhaltliche Modifikation der Zensurbemühungen zu beobachten. Hatten sie zunächst vorwiegend der Abwehr von Spionage gedient, entwickelten sie sich immer stärker zu einem Instrument politisch-ideologischer Überprüfung und Überwachung. Die Feldpost wurde in den Prüfstellen auf „Haltung und Stimmung“, „Stand der Disziplin“, „Geheimhaltung“, „Zersetzung“ sowie „Spionage und Sabotage“ hin analysiert und gegebenenfalls sanktioniert.
Zugleich wurden in Zeitungen, Zeitschriften und anderen öffentlichen Medien immer wieder Anleitungen zum mustergültigen Abfassen von Feldpostbriefen verbreitet. So sollten aus der Heimat beispielsweise keine Probleme, Klatsch und Tratsch mitgeteilt werden, während Frontsoldaten ihre Angehörigen hingegen positiv beeinflussen und zum Durchhalten auffordern sollten. So wurde die „äußere Zensur“, also die Kontrolle der Briefe durch die Prüfstellen der Wehrmacht Schritt für Schritt durch eine „innere Zensur“ ergänzt und überlagert. Das konnte dann zu einer selbst auferlegten Enthaltung gegenüber bestimmten Themen führen, die dann überhaupt keine Erwähnung fanden, um so sicherzustellen, dass der Brief in jedem Fall den Empfänger erreichte und nicht konfisziert wurde.
Wie immer die jeweilige Motivlage auch war, so beeinflusste sie den Inhalt der Feldpost in vielen Fällen deutlich und nachhaltig. Das, was in den Briefen geschildert wurde, entsprach dann oft nicht mehr dem realen Alltag an der Front, was den Quellenwert der Korrespondenzen einschränken muss, die dann lediglich eine „Konstruktion von Wirklichkeit unter äußeren und inneren zensierenden Bedingungen“ darstellen und jeweils nur für eine „Kommunikationspartnerschaft“ Geltung haben können.[2]
Das traf allerdings nicht auf alle überlieferten Feldpostkorrespondenzen zu. So ergab eine inhaltliche Analyse von rund 50.000 Briefen, dass der Großteil der Soldaten ihre Meinungen und Ansichten offenbar unbeeindruckt jeglicher Zensurauflagen erstaunlich offen zu Papier brachten. Das hing sicherlich auch mit der Erwägung zusammen, dass angesichts eines derart großen Postaufkommens nur einen kleinen Teil der Post tatsächlich von den Zensurbehörden kontrolliert werden konnte.[3]
Eine Möglichkeit, die Zensur irrezuführen, war das kodierte Schreiben, bei dem durch Nutzung von – zuvor zumeist mit den Adressaten vereinbarten – Tarnbegriffen bestimmte Personen und Orte, aber auch Gefühlszustände und Ereignisse bezeichnen wurden. Viel sicherer und effektiver war aber ein Verfahren, von dem Soldaten immer wieder Gebrauch machten, indem sie auf Urlaub fahrenden Kameraden Briefe und Mitteilungen auf den direkten Weg zum Adressaten mitgaben. Diese Schriftstücke liefen natürlich an der Zensur vorbei, so dass sich der Schreiber, der dies ja wusste, in ihnen weitaus deutlicher äußern konnte als das im normalen Feldpostverkehr ratsam war.[4]
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Wirksamkeit der „äußeren“ wie der „inneren“ Zensur auf die jeweiligen Briefinhalte sicherlich vorhanden war. Da die Einhaltung der einschränkenden Vorschriften aber jeweils auch sowohl vom Temperament und Mut des Schreibers als auch der jeweiligen Kriegslage mitbestimmt wurde, und es zudem immer wieder auch Möglichkeiten gab, die Zensur zu umgehen, ist keine genaue Definition der Auswirkungen möglich. Bei der Analyse von Feldpostbriefen gilt es solche Möglichkeiten stets zu berücksichtigen und im Einzelfall zu prüfen, ohne dass dadurch der Aussagewert dieser Briefe als historische Quelle generell in Frage gestellt würde.
[1] Vgl. Katrin Kilian: Das Medium Feldpost als Gegenstand interdisziplinärer Forschung. Archivlage, Forschungsstand und Aufbereitung der Quelle aus dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 2001, S. 14ff.
[2] Martin Humburg, Das Gesicht des Krieges, Opladen, Wiesbaden 1998, S. 117. Vgl. hierzu auch Jander, Selbst- und Fremdbilder, S. 33ff.
[3] Vgl. Ortwin Buchbender/Reinhold Sterz (Hgg.): Das andere Gesicht des Krieges. Deutsche Feldpostbriefe 1939-1945, München 1982, S. 24 und Kilian, Medium, S. 102. Vgl. mit einem interessanten Einzelbeispiel auch Jander, Selbst- und Fremdbilder, S. 34f..
[4] Vgl. Vgl. Jander, Selbst- und Fremdbilder, S. 35f. Dort, S. 36f. auch zum Folgenden.