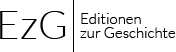Der Briefkreis um Freddy Gothmann
Friedrich Gothmann, im Freundeskreis „Freddy“ genannt, wurde am 12. Dezember 1915 in Köln geboren, wo er zunächst das Apostelgymnasium besuchte, das er nach der Untertertia aber verließ, um eine Lehre als technischer Zeichner bei den Rheinischen Draht- und Kabelwerken anzutreten. Seit dem 1. Oktober 1936 leistete er seinen Arbeitsdienst ab.
Schon früh war er mit der katholischen Jugendbewegung Kölns in Kontakt gekommen und wurde bald eine von deren prägenden Gestalten. Als Gymnasiast war er 1827 zunächst dem „Bund Neudeutschland“ beigetreten, nach dem Abbruch der Schule dann aber dem „Katholischen Jungmännerverband“ (KJMV) beigetreten und später zum Stadtführer der „Deutschmeister-Jungenschaft“ aufgestiegen, bis diese sich – so Gothmanns eigene Darstellung vor der Gestapo - aufgrund mangelnder Unterstützung durch das Jugendhaus in Düsseldorf selbst auflöste. Danach war er dann seit 1934 unter der Führung von Kaplan Adelkamp ein sehr aktives Mitglied des KJMV in der Pfarre St. Aposteln.[1]
Freddy Gothmann geriet aufgrund seines Engagements in der katholischen Jugend früh in den Fokus der Gestapo und wurde entsprechend beobachtet. Am 3. Juni 1934 wurde er mit weiteren Jugendlichen erstmals wegen des Verdachts der verbotenen Durchführung von Geländespielen mit seiner Jugendgruppe angezeigt. Zuvor hatte die NSDAP-Ortsgruppe Köln-Zollstock gemeldet, dass Angehörige des KJMV in einer Kiesgrube eine Versammlung abhielten, woraufhin ein Polizeibeamter Freddy Gothmann und andere Jugendliche namentlich. Am 16. Juni 1934 wurde er von der Gestapo vernommen. Dabei räumte er ein, man habe sich in Kiesgrube Martinez, die im Besitz der Familie eines befreundeten Gruppenmitglieds sei, „zum geselligen Zusammensein getroffen“, wobei er hervorhob, dass die Jugendlichen einzeln dorthin gekommen seien, um so den Eindruck eines gruppenmäßigen Auftretens zu vermeiden. Mit einer Jugendvereinigung, so die von Gothmann präsentierte Schlussfolgerung, habe das alles also nichts zu tun gehabt, auch wenn er eingestehen musste, dass auch andere Teilnehmer des Treffens dem KJMV angehören würden. Es sei auch kein KJMV-Führer anwesend gewesen, wobei Freddy Gothmann verschwieg, dass es sich beim ihm selbst ja durchaus u einen solchen handelte. Es sei „Ringtennis“ gespielt, anschließend habe man in der Sonne auf der Landzunge im „Grundwassersee“ gelegen. Den Eindruck wehrsportlicher Übungen versuchte er in der Vernehmung nicht eben glaubhaft zu entkräften. Er habe dann aus Langeweile den anderen lediglich gezeigt, wie eine exakte Kehrtwendung ginge, die er selbst gerade erst an Pfingsten im Lager erlernt habe. Er habe die „Jungens“ antreten und die Kehrtwendung üben lassen, verneinte aber vehement, dass es sich hierbei um Exerzieren gehandelt habe. Das Ganze habe ohnehin nur etwa 20 Minuten gedauert. Er habe das keinesfalls als verbotenes Spiel im Sinne der Verordnung vom 29. Mai 1934 verstanden, die er bis dahin ohnehin noch nicht gekannt habe. Auch Kluft oder Abzeichen hätten die Beteiligten nicht getragen. – Nachdem die Kölner Gestapo noch einige andere der Beteiligten, die Gothmanns Aussage weitgehend bestätigten, befragt hatte, leitete sie den Vorgang dann an die Staatsanwaltschaft weiter, die, nachdem ausschließlich gegen Freddy Gothmann eine Anklageschrift verfasst worden war, auf Grundlage des Straffreiheitsgesetzes vom 7. August 1934 das Verfahren am 16. August 1934 jedoch gänzlich einstellte.[2]
1935 wurde Freddy Gothmann gemeinsam mit Ernst Reden, Siegfried Mühlberg und Hans Hackenberger des Hochverrats beschuldigt, weil sie bündische Jugendzeitschriften bezogen hätten und „der Mithilfe zur Errichtung gesonderter Jugendgruppen dringend verdächtig“ seien.
Am 28. Januar 1937 wurde Freddy Gothmann schließlich, nachdem man ihm im RAD-Lager verhaftet hatte, wegen „bündischer Umtriebe“ zu einer Geldstrafe von 300 RM verurteilt.[3] Ab Februar 1937 folgten weitere Vernehmungen über katholische Jugendorganisationen und die Rolle, die er in ihnen einnahm, über Fahrten und Treffen, Kontakte nach außen und die verbotene Verteilung von Schriften. Die hierüber angelegte Akte enthält zahlreiche Namen von katholischen Jugendführern aus der gesamten Erzdiözese Köln und ist ein weiterer Beleg für die besondere Rolle, die Gothmann in diesem Kontext einnahm. Einige der hier Genannten – z.B. Wilhlem Hackenberg, Ernst Didier oder Ernst Bohlen - zählten zu den Korrespondenzpartnern im Rahmen des hier nun zugänglichen Briefwechsels. Aber auch andere – genannt seien hier Maria Teusch oder Mike Jovy – waren damalige Größen der katholischen-bündischen Jugendbewegung. Mit der am 12. Februar 1937 erfolgten Beschlagnahme seiner „Klampfe“, auf der eine Kohte eingebrannt war, fand auch dieses Verfahren offenbar sein Ende.[4]
Damit endete bis vor kurzem zugleich aber auch das Wissen des NS-Dokumentationszentrums über Freddy Gothmann. Das änderte sich erst am 5. September 2019, als Ulrike Corcilius aus dem fernen Elze bei Hildesheim in Niedersachsen das EL-DE-Haus besuchte. Bei dieser Gelegenheit teilte sie mit, dass sie im Besitz der sich auf den Zeitraum von 1935 bis zu dessen Tod am 30. April 1942 erstreckenden Korrespondenz von Freddy Gothmann verfüge und darüber nachdenke, diese dem NS-Dokumentationszentrum zur Verfügung zu stellen. Schnell war der Kontakt zu Frau Corcilius geknüpft, war doch gerade dieser Briefbestand im Kontext des aktuell laufenden Editionsprojekts „Selbstverständnis und Zusammenhalt katholischer Jugendlicher zwischen 1939 und 1945 im Spiegel von Selbstzeugnissen und Lebensgeschichten“ von besonderem Interesse und dessen Integration in das kurz vor dem Abschluss stehende Vorhaben so naheliegend wie wünschenswert. Frau Corcilius stimmte dem Anliegen nach Rücksprache mit ihrem Bruder umgehend zu und ließ es sich nicht nehmen, die Materialien am 30. September 2019 höchstselbst nach Köln zu bringen. Zugleich stellte sie auf Bitte des NS-DOK die folgende Skizze zu dessen Überlieferungsgeschichte zur Verfügung:
Es ist nicht einfach, Hintergründe zu dem Briefwechsel zu liefern, da es sich in diesem Fall nicht um die Korrespondenz innerhalb einer Familie, sondern um den Briefwechsel eines Freundeskreises handelt, der sich weitgehend aus Angehörigen von katholischen und bündischen Jugendgruppen und ihnen nahestehender Personen rekrutierte, die damals weiterhin ihre Existenzberechtigung neben der Hitlerjugend beanspruchten.
Die Briefe wurden von rund 50 verschiedenen Jugendlichen und wenigen Erwachsenen zwischen 1935 und 1942 geschrieben. Zudem umfasst das Konvolut nicht ausschließlich Briefe katholischer Jugendlicher, denn mit Fritz Corcilius [im Übrigen der spätere Vater der Leihgeberin] war mindestens einer der Korrespondenzpartner evangelisch. Überschneidungen gab es wohl auch hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit: Katholische Jugend, Bündische Jugend – hier wahrscheinlich verschiedene Gruppen der dj 1.11 und „Nerother“ - und auch italienische Jugend. Loreto Martinez war gleich in allen drei Richtungen engagiert.
Ein weiterer und wesentlicher gemeinsamer Nenner war als beliebter Treffunkt der Jugendlichen mit großer Sicherheit die Kiesgrube der Gebrüder Martinez. In den 1930er Jahren errichtete der Bauunternehmer Dario Martinez für seine Familie auf dem Gelände auch ein Wohnhaus. Dessen Tochter Irene Martinez [ihrerseits später Mutter der Leihgeberin] stand dem Freundeskreis ihres Bruders Loreto sehr nahe, gehörte wohl aber nicht der Bündischen Jugend an. Nach 1945 wurde sie Hüterin der Korrespondenz und weiterer Dokumente, die ihr – evtl. durch Gerd Tenbieg - zur Aufbewahrung übergeben worden waren.
Irgendwie, so erinnert sich Ulrike Corcilius, habe sie die Aussage eines der Beteiligten im Ohr, das man „da was draus machen müsse“. Das sei ihrer Mutter nicht gelungen, aber immerhin habe sie die Dokumente bis zu ihrem Tod im Jahr 2010 aufbewahrt. Danach gingen nicht nur die Briefe in den Besitz von Tochter Ulrike Corcilius über, sondern auch ein Teil der daraus in deren Augen erwachsenden Verpflichtung: „Da ich mit den Erzählungen aus ihrer Jugend aufgewachsen bin und mir einige Menschen vertraut, andere zumindest den Namen nach bekannt waren, habe ich versucht, den Auftrag, ‚da muss man was draus machen‘, in die Tat umzusetzen.“ Das Projekt habe – „nach einem euphorischen Auftakt“ – dann jedoch lange brachgelegen, nicht zuletzt, weil es Ulrike Corcilius nur unter großen Mühen und mit entsprechendem Zeitaufwand möglich war, die zahlreichen Briefe überhaupt erst einmal ansatzweise zu entziffern und tabellarisch zu erfassen. Daher reifte - nach einigem Zögern – der Entschluss, die Briefe mit ergänzenden Dokumenten dem NS-Dokumentationszentrum zu überlassen. „Wenn schon die Überlebenden dieses Freundeskreises sich der Besonderheit bewusst waren, so ist es vielleicht in ihrem Sinne, diese Gruppe und besonders das Andenken an ihren Leiter einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“
Im Mittelpunkt der Materialien, so betont Frau Corcilius, stünde nicht etwa die Familie jener Person, die die Dokumente jahrzehntelang aufbewahrt habe, sondern eindeutig Freddy Gothmann und damit jener Mensch, der das „Herz“ dieses Freundeskreises dargestellt habe und für viele von dessen Angehörigen eine Art „Lichtgestalt“ gewesen sei. „An ihn richteten sich die meisten Briefe. Es sind viele verschiedene Personen, deren Korrespondenz hier publik gemacht wird. Leider weiß ich zu den wenigsten Daten, im besten Fall habe ich Erinnerungen an Erzähltes, was aber alles kaum einer historischen Überprüfung standhalten dürfte. Insofern wäre es wünschenswert, wenn Historiker das Thema genauer unter die Lupe nehmen würden und/oder Nachkommen der Verfasser den Briefen weiteres Hintergrundwissen zur Seite stellen könnten.“ – (Diesem Wunsch schließt sich das NS-DOK vollinhaltlich an.)
Freddy Gothmann überlebte den Krieg nicht. Bei einem Tieffliegerangriff verlor er im April 1942 an der Ostfront beide Beine, was er nur für einige Tage überlebte. Er starb am 30. April 1942 Mariupol am Asowschen Meer.
Der Briefwechsel, der mit weiteren Dokumenten und einem die Zeit 1939 bis Anfang April 1940 umfassendes Tagebuchfragment aus der Feder von Freddy Gothmann dem NS-DOK dauerhaft zur Aufbewahrung übergeben wurde, wird dort unter der Signatur N ??? aufbewahrt.
[1] Angaben nach LAV NRW R, Ger., Rep. 17, Nr. 482
[2] Darstellung nach LAV NRW R, Ger., Rep. 112, Nr. 14867
[3] Vgl. LAV NRW R, RW 58/19717, Bl. 134
[4] Darstellung nach LAV NRW R, Ger., Rep. 17, Nr. 482