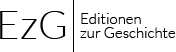Gisbert Kranz: "Meine Pennezeit" (2
Es handelt sich hier um das zweite von vier Heften, die Gisbert Kranz als Schüler des Carl-Humann-Gymnasiums in Essen Steele angelegt hat. Auf insgesamt fast 300 handschriftlichen Seiten (die hier auch transkribiert vorliegen) bietet er eine Chronik seiner Schulzeit von seiner Aufnahmeprüfung am Gymnasium im März 1931 bis zum Abitur acht Jahre später.
Es wird Wichtiges und Unwichtiges beschrieben und immer wieder um längere Charakteristiken einzelner Lehrer ergänzt. Insofern bietet diese "Chronik" aus Schülersicht interessante Einblicke in den Schulalltag in Steele.
Das Werk entstand offenbar nicht "in einem Guss". Der erste Band etwa wurde zwischen Juli 1935 und Februar 1937 im Schularchiv aufgehoben und muss demnach bereits vor Juli 1935 entstanden sein.
Meine Pennezeit, G. Kranz.
2. Buch.
[Zeichnung]
Zülpich
Kreis Euskirchen
Regierungsbez. Köln
WHW
Kampf dem Verderb
Zeugnis
Die Bierzeitung
UII 1936/37
2. Abschnitt: Obertertia bis Untersekunda.
Nachtrag zum ersten Buch.
Ende Untertertia wollten wir eine Bierzeitung machen. Josef Lillich, Paul Buchholz und ich waren die Redaktion. Paul wollte die Zeitung drucken. Wir sammelten Gedichte und Geld in der Klasse und taten unser Bestes, um eine Bierzeitung, die pfundig war, zu schaffen. Wir hatten schon ein paar Seiten fertig. An den vielen Gedichten, die wir erhielten, sah man, wie die Klasse begeistert war. Aber die Sache scheiterte doch. – Ein paar Jungens, Rudi Stricker und Heinz Hecker, machten auch eine Zeitung. Sie nannte sich: „Das Komplott“.
Sie verteilten Zettel in der Klasse, auf denen etwa folgendes drauf stand: „Kameraden! Habt acht vor den Elementen, die Euch mit einer „Bierzeitung“ locken wollen. Lasst Euch nicht beirren! Abonniert das <<Komplott>>!“ Da wurde die Redaktion der „Bierzeitung“ aufgelöst, d. h. sie löste sich auf. <<Das Komplott>> gab eine Probenummer heraus. Sie war zweiseitig und mit Schreibmaschine auf dünnem Papier bedruckt. Die Zeitung wurde von vielen abonniert. Sie erschien ein zweites Mal. In dieser Nummer 1 des Jahrgangs 1 stand u. a. dieses: „Wir bitten die Schüler, die Zeitung nicht während der Stunde zu lesen, da sie sonst verboten wird.“ Dann standen Gedichte, ein Roman (frei nach Karl May), der fortgesetzt werden sollte, Anzeigen und ein Silbenrätsel drin. Das war die erste und letzte Nummer des <<Komplotts>>, da die Redaktion kein Geld erhielt. Es fiel auch keinem ein, 5 Pfennig
für so eine Zeitung zu bezahlen. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. –
Die Gedichte, die ich als Schriftleiter der „Bierzeitung“ erhielt, hatte ich in ein Heft zusammengefasst, damit sie nicht verloren gingen. Ich betitelte es „Meine Pennezeit“. So ist das Buch entstanden.
Aus Versehen hatte ich es in meine Mappe eingepackt und mit zur Schule genommen. Wir hatten Latein. „Karlchen“ Dittmar sagte: „Hausaufgaben ’raus!“ Ich nahm das Heft heraus und schlug es auf: Da war es „Meine Pennezeit“! Karlchen ging gerade an meiner Bank vorbei, sah das Heft mit den Zeichnungen und nahm es mir weg. Er setzte sich auf’s Pult und las. Nach einer Viertelstunde sagte er: „Och, dat kann man sich ja mal mit nach Hause nehmen!“ Das er dann auch tat. – Als ich am anderen Morgen das Heft von ihm wieder haben wollte, schnauzte er mich an: „Geh, hol’s dir beim Direktor
ab!“ Da hatte dieser ... das Heft allen Paukern gezeigt und dann dem Direx gegeben! Stutz kniff mir in die Backen und sagte: „Na, ist das auch alles wahr, was Du da von mir geschrieben hast?“ August Böhmer sagte, ich habe den Dr. Knupfer so prächtig getroffen. Und der Chef sagte: „Das Buch bleibt im Schularchiv, solange, bis du abgehst.“ Ich erwiderte: „Da steht doch nichts Schlimmes drin?“ „Nein, nein, das Buch hat mir gut gefallen! Aber du bekommst es nicht wieder.“ Gefallen hatte es ihm deswegen sicher, weil ich über ihn soviel Schmus geschrieben hatte. Dackel Dittmar hatte es bestimmt nicht gefallen. Als meine Mutter ihn mal besuchte, weil ich schlecht stand, hatte er ordentlich geschimpft über mich und „Meine Pennezeit“. Jedenfalls hatte ich beim Chef eine gute Nummer bekommen und er nannte mich bei einer Gelegenheit vor der ganzen Schule als Schrift-
steller. So kam es, dass mein Buch in das Schularchiv kam. – Bei einer besonderen Angelegenheit bat ich den Chef, mir das Heft zurück zu geben. Er tat es. Vorher war ich deswegen schon oft bei ihm gewesen. Aber jedesmal wies er mich ab. Am 25. Februar 1937 hatte ich es erreicht. – Ich las „Meine Pennezeit“ durch. Alte Erinnerungen tauchten wieder auf. Aber auch viele Schreibfehler. Damals, als ich das Buch schrieb, war ich in Untertertia. Da konnte ich die deutsche Rechtschreibung noch nicht so gut, wie jetzt als Obersekundaner. Ich liess aber die Fehler alle stehen. –
In diesem Buch stehen keine Gedichte. Sie stehen alle in „Der Bierzeitung“, die wir, Rudi Stricker, Heinz Hecker und ich, Ende Untersekunda gemacht haben. Sie ist sehr fein geworden.
Essen-Steele, 29.III.37.
V. Obertertia.
Ostern 1935-Ostern 1936.
1. Erinnerungen.
Mit frischem Mut ging es in das neue Schuljahr. Es war wieder sehr erlebnisreich. –
Im Sommer 1935, am 21. Juli, dem letzten Schultag vor den grossen Ferien, hatten wir unser Schulfest. Am Morgen fand eine Feier zu Ehren Karl Humanns statt. Bei dieser Gelegenheit wurde die Tafel, die früher an seinem Geburtshause hing, und eine Büste feierlich aufgestellt. Die Tafel hat folgende Inschrift:
„Diese Tafel widmet die Vaterstadt dem Andenken ihres in diesem Hause am 4.1.1839 geborenen und zu Smyrna am 12.4.1896 gestorbenen Ehrenbürgers Karl Humann. Dem gelehrten und uneigennützigen Forscher ver-
dankt das Vaterland die Kunstschätze von Pergamon. / Das Geburtshaus stand Chaussestr. 27, jetzt Isinger Markt, Ecke Hansastr. Diese Gedenktafel wurde am 22. Juli 1935 im K.H.-G. wieder aufgestellt.“
Direktor Dr. Trieloff verkündete feierlich den Namen „Karl Humann-Gymnasium“ und nahm die Weihe der Schulfahne vor. Dann überreichte er Frau Ledschbor, der Schwester Karl Humanns, die bei der Feier mit vielen anderen Ehrengästen zugegen war, einen Blumenstrauss. Nach der Feier fanden sportliche Wettkämpfe statt. – Über dem Portal der Schule glänzt seit diesem Tage der Name „Karl Humann-Gymnasium“. – Am Abend kamen Eltern, Lehrer und Schüler im Stadtgarten zusammen. August Böhmer führte mit den Schülern der Oberklassen ein Stegreifspiel auf, das über 2 Stunden dauerte. Es hiess: „Kirmes auf dem Nottenköppelskamp“. August wirkte selbst als Luftballonverkäufer mit. Wir lachten Tränen. Alles zu schildern, würde zu weit führen. Erwähnen muss ich
noch die Musikkapelle, deren 12 Mitglieder alle Fräcke und Zylinder trugen. Sie hatten dicke rote Nasen und hatten sich das Gesicht angemalt. Es waren die ungeheuerlichsten Blechinstrumente da, so Riesendinger, die man um den Leib hängt. Der Mann, der die dicke Pauke trug, hatte einen Badeanzug an. Ein Orgelspieler war auch da mit einer richtigen Drehorgel, die ging so: „Tülülut, quietsch quitsch!“ Woher August diese herhatte und die Instrumente der Kapelle, das ist mir ein Rätsel. – Nachher wurde noch getanzt.
Bei dem Wettbewerb „Der rote Hahn“ erhielt ich eine Anerkennung, bei dem Wettbewerb der Polizei den 2. Preis.
Wenn ich auch im Zeichnen 1 war, so stand ich in den anderen Fächern um so schlechter. Weihnachten brachte ich ein Zeugnis mit nach Hause, auf dem ich 5 mal „mangelhaft“ hatte, u. a. in Französisch, Griechisch, Mathematik. In Latein
hatte ich „genügend schwach“. Unter dem Zeugnis die schöne Bemerkung: „Nach dem Stand seiner jetzigen Leistungen ist die Versetzung sehr gefährdet.“ Dass da meine Eltern nicht erfreut waren, ist klar. Ich hatte mir als Weihnachtsgeschenk ein Schaubeck-Briefmarkenalbum gewünscht. Das erhielt ich nicht. Wenn ich Ostern steige, würde ich es bekommen. Nun wurde aber gearbeitet, wie noch nie. Ich erhielt Nachhilfestunden, was für einen Obertertianer ja beschämenswert ist. Aber ich tröstete mich damit, dass noch ein paar andere auch Nachhilfestunden bekamen. Unsere Klasse stand überhaupt sehr schlecht. Von 33 erhielten 23 einen blauen Brief. Erhielten wir eine Arbeit wieder, hatten über die Hälfte mangelhaft. – Ich verbesserte mich sehr. Ein ganzes Jahr stand ja auf dem Spiel. Meine Eltern machten mir noch allerlei Versprechungen. Ich liess mir für nichts mehr Zeit. Die letzten
französischen Arbeiten hatte ich sogar „gut“. Mein Zeugnis war sehr gut, mit Ausnahme von „mangelhaft“ in Griechisch. In Aufmerksamkeit hatte ich sogar „gut“, was ich hierin nie gehabt habe. Oberlehrer Kaps sagte mir, als er mich auf der Strasse traf: „Na, da hast du dich ja angestrengt. Bestell deinen Eltern ’nen schönen Gruss von mir. Sag, sie sollten dir nach Ostern noch weiter Nachhilfestunden geben lassen, damit du das Einjährige schaffst.“ Das fand ich aber nicht für nötig, zumal da ich die Nachhilfestunden von meinem Geld bezahlen musste. Ich wusste auch, dass ich es auch so schaffen werde. Und ich habe es geschafft. Eine „vier“ hatte ich in Untersekunda nicht mehr bekommen. In Latein, Deutsch, Biologie, Religion hatte ich sogar gut, in Zeichnen sehr gut. Und dabei habe ich mich garnicht so angestrengt, wie das viele meinten, man muss nur im Unterricht achtgeben. –
[Fotos]
2. Unsre Klasse.
Diese beiden Bilder machte Dr. Weyres in der Physikklasse von uns, als wir in Physik den Photoapparat durchnahmen. An den Wänden ein Teil von den Geräten, die wir zu unseren Versuchen brauchten. An jeden Tisch sassen drei Jungen, die eine Gruppe bildeten.
3. Die Pauker.
Latein hatten wir, wie in Obertertia, bei Studienrat Dittmar, genannt „Dackel“. Im vorigen Heft und in der Bierzeitung steht von ihm geschrieben. Er war unser Ordinarius. – Griechisch hatten wir in den beiden ersten Tertialen der Obertertia bei Herrn Studienr. Hochkirchen. Als er sich dann bis Ostern 1936 beurlauben liess wegen Krankheit, hatten wir das letzte Tertial bei Herrn Dr. Goldstein, einem neuen Lehrer, Griechisch. In seinen Stunden war immer ein Heidenlärm, als ob kein Pauker da sei. Er sagte aber nie etwas dagegen.
Französisch gab uns Studienassessor Dr. Tillmann, ein kleiner, junger Pauker, „Tilly“ genannt.
Dr. Steinbrink gab uns Deutsch. Bei ihm hatten wir feine Stunden. Er brachte uns eine Anzahl von Volksliedern bei. Er hatte einen Holzarm, den er uns in einer Stunde mal gezeigt hatte,
nach Professor Sauerbruch. Er schrieb immer mit der linken Hand. Dann hatten wir noch Geschichte bei ihm. – Eine Zeit lang hatten wir bei Herrn Balensiefer Geschichte. Er sagte immer: „Ich muss noch sehr viele Prrrädikate schreiben.“
Mathematik und Physik gab uns Dr. Weyres, genannt „Peias“. Im vorigen Buch steht von ihm geschrieben.
Zeichnen hatten wir nach wie vor bei Herrn Studr. Böhmer. Er ist hinreichend bekannt genug. –
Religionsunterricht erteilte uns Studienr. Spennrath, „Heini“ oder „Spenni“ genannt.
Musik und Turnen hatten wir bei Herrn Oberlehrer Kaps. Spielturnen hatten wir bei Herrn Wagner, „Kiki“ genannt, von dem schon im letzten Buche stand.
In Erdkunde hatten wir einmal Herrn Balensiefer, ein andermal bei Dr. Steinbrink, wieder ein andermal Dr. Tillmann. Die meiste Zeit fielen die Stunden aus.
Über jeden Pauker steht in der „Bierzeitung“ genug geschrieben.
Eine Zeitlang gab uns Studienassessor Nussbaum Geschichte und Erdkunde.
VI. Untersekunda.
Ostern 1936-Ostern 1937.
1. Die neuen Pauker.
In Untersekunda bekamen wir eine Anzahl neuer Lehrer. „Dackel“, der zwei Jahre lang unser Klassenlehrer war, verliess uns. An seine Stelle trat Studienrat Linnenborn, der uns Mathematik und Physik gab. Wir nannten ihn „Pille“ oder „Pat“. –
In Latein und Griechisch bekamen wir Studienassessor Holtermann, der Johannes hiess. Er zensierte gut und konnte lange Reden schwingen mit guten Ermahnungen in wohlgesetzten Perioden. Alles weitere siehe in der „Bierzeitung“ nach. –
In Französisch bekamen wir den Chef selbst, Dr. Otto Trieloff. Er war sehr launisch. Im letzten Heft steht noch mehr von ihm.
In Deutsch behielten wir Dr. Steinbrink, „Schöps“
genannt. In Religion hatten wir, wie vorher, „Spenni“, im Zeichnen „August“, in Musik und Turnen Kaps. –
Aber in Spielturnen bekamen wir zuerst Studienassessor Beckmann, später Studienassessor Schultes. – In Biologie hatten wir im ersten Tertial Herrn Decker, den wir „Sendralgörbersche“ nannten. Er kam aus Aachen. Im zweiten Tertial hatten wir Dr. Weyres (Peias), im dritten Dr. Eggenrath. Dieser war „hoch in Ordnung“. Wir nannten ihn „Peias sein Stift“. Er ist ein hoher HJ-Führer. – Im zweiten Tertial musste sich Dr. Steinbrink beurlauben lassen. Wir erhielten in Deutsch Dr. Sternitzke, einen jungen Studienassessor. Weihnachten kam „Schöps“ wieder. In Erdkunde bekamen wir Herrn Dr. Tillmann, den wir in Obertertia in Französisch hatten. Sein Unterricht war sehr interessant. Geschichte hatten wir bei Herrn Beckmann,
später, im dritten Tertial, wieder bei Herrn Dr. Steinbrink.
In der „Bierzeitung“ steht über die Pauker noch mehr geschrieben.
2. Die Bierzeitung.
Zum Einjährigen wollten wir eine Bierzeitung machen. Es wurde ein Komitee gegründet, in dem folgende Jungen waren:
1. Heinz Hecker, Präsident, Geschäftsführer.
2. Fritz Badde, Verantw. für Text und Inhalt.
3. Josef Lillich, Kassierer.
4. Paul Buchholz und
5. Ferdi Frölich, Druck und Verlag.
6. Meine Wenigkeit als „Werbereferent“.
Montags in der 6. Stunde war immer
Komitee-Sitzung. Ich hing Aufrufe und Mitteilungen an die Klasse in den Glaskasten. Über die einzelnen Sitzungen, worüber Heinz Hecker gewissenhaft Protokoll führte, und die Arbeit des „Bierzeitungs-Komitees“ siehe in den Akten der „Bierzeitung“ nach. –
Kurz vor den Weihnachtsferien wurde das Komitee aufgelöst. Heinz Hecker hatte schon lange vorher sein Amt als Praesident niedergelegt. Gründe für die Auflösung waren: Wir bekamen kein Geld und keine Gedichte. Das, was wir an Geld und Gedichten hatten, war von den Komitee-Mitgliedern selbst. Diese hatten auch die Lust verloren. – Nach den Weihnachtsferien nahmen Heinz Hecker, Rudi Stricker und ich die Arbeit wieder auf. Heinz war Kassierer, Rudi Drucker, und ich machte die übrige Arbeit (Schriftleiter). Jetzt wurde gearbeitet, wie noch nie. Der Laden klappte auch. Ich erhielt genug Gedichte,
und Heinz hatte in kurzer Zeit 20 M zusammen. Jeder musste 65 Pf. bezahlen. – Ostern hatten wir eine feine Bierzeitung von 27 Seiten fertig. Aufrufe, Berichte, Rechnungen und sonstige Akten, sowie sämtliche eingesandten Gedichte, siehe im Bierzeitungsarchiv.
3. Was sonst im Schuljahr 1936-37 geschah.
Am 21. Juli feierten wir wieder unser Schulfest im Steeler Stadtgarten. –
Vom 19. Oktober bis zum 4. November waren wir im Schulungslager in Zülpich. Der Abschnitt VII. handelt davon. –
Im Sinne des Vierjahresplanes sammelten wir Küchenabfälle für die Schweinefütterung. In Beuteln brachten wir diese zur Schule. Hier wurden sie jedesmal von einem Bauern abgeholt. – Über die Sammelaktion (Kampf dem
Verderb!) schrieb ich im Auftrage des Direktors zwei Artikel für die Zeitung. –
Die neuen Schulreformen bestimmten, dass in Zukunft die höhere Schule nur noch acht Jahre dauere. Das war ein Jubel in der Unterprima, als die Verfügung herauskam! Hatten sie doch ein Jahr gespart und machten sie noch im selben Jahr mit den Oberprimanern das Abitur! – Diese Verfügung war deshalb gekommen, weil die Dienstzeit beim Militär auf zwei Jahre verlängert worden war. Weiter wurde bestimmt, dass es nur noch zwei Schulformen bei höheren Schulen geben sollte: 1. Die Hauptform mit Englisch als erster und Latein als zweiter Fremdsprache. 2. Das Gymnasium mit Latein, Griechisch und Englisch. Französisch fällt in beiden Formen fort. – Unser Gymnasium wurde in die Hauptform umgewandelt, d. h. die nächsten Sexten haben das Pensum der Hauptform, die anderen Klassen halten das alte Pen-
sum des Gymnasiums bei. –
Am zweitletzten Schultag, den 23. März, machte unsere Klasse eine Fahrt per Omnibus nach Xanten und Calcar. Wir hatten 35 M auf eine Gemeinschaftsarbeit „Der deutsche Schwur“ beim Wettbewerb „Volksgemeinschaft – Wehrgemeinschaft“ erhalten. Jeder musste noch 1,80 M hinzulegen, dann hatten wir das Geld zusammen. – Mit uns fuhren August Böhmer, Studienrat Linnenborn, Dr. Eggerath, Dr. Gaillart, Herr Wagner und Beckmann, und Herr Schultes, der mit seinem eigenen Wagen fuhr. Da in dem Omnibus nicht alle reingingen, fuhr noch ein Auto mit, sodass an der Fahrt 3 Wagen beteiligt waren. – Zunächst fuhren wir zum Flugplatz Essen-Mühlheim. Nach einer kurzen Besichtigung fuhren wir weiter nach Duisburg-Ruhrort. Hier machten wir eine Bootsrundfahrt durch den grössten Binnenhafen der Welt. Nachdem wir die Schifferbörse besichtigt
hatten, nahmen wir in einem Restaurant eine kräftige Erbsensuppe ein. Nachdem wir uns alle genügend gestärkt hatten, stiegen wir wieder in den Omnibus, und weiter gings nach Xanten. Hier besichtigten wir das castra vetera und den Viktorsdom. In Calkar wurden uns die geschnitzten Altäre gezeigt in der Nikolai-Kirche. – In froher Stimmung fuhren wir über Wesel wieder heim. –
Am folgenden Tag gab’s Zeugnisse. – Abends fand sich unsere Klasse zu einem Kommers im Steeler Stadtgarten zusammen. Von den eingeladenen Lehrern waren „Pille“ und Dr. Eggerath erschienen. Es war sehr fein. Die Stimmung war grossartig. Herbert Weise spielte auf dem Klavier. Der Präsident des Kommerses war Wolfgang Büscher. Dieser hielt die Eröffnungsrede. Ich las unter Jubel und Spannung die „Bierzeitung“ vor,
die danach verteilt wurde. Helmut Hecker, der schon nach dem ersten Glas Bier besoffen war, hielt im Namen der zwölf, die abgingen, eine Rede. Wir bogen uns vor Lachen. Studienrat Linnenborn, den wir an dem Abend nur noch mit „Pille“ anredeten, hielt auch noch eine lange Ansprache. – Wir hatten ihm ein halbes Dutzend Gläser hingestellt. Da sagte er: „Kerls, wo wollt ihr hin! Das kann ich doch nicht alles trinken! Doch, wenn man so’n Glas dastehen hat, kann man es doch nicht stehen lassen.“ Und er soff und soff. Nachher konnte er nicht mehr grade stehn. – Als Dr. Eggerath kam (mit etwas Verspätung), stellte ihm der Ober ein Glas Milch hin. Wir haben uns totgelacht. Ein anderer hatte es für ihn bestellt. Gegen 3 Uhr zogen die Schüler, die noch da waren, mit den besoffenen Pauckern Arm in Arm den Laurentiusweg runter, wo sie vor
VII. Lehrgang 7, Zülpich.
19. Oktober – 4. November 1936.
1. Vorwort.
Im folgenden Kapitel schreibe ich vom Nationalpolitischen Lehrgang in Zülpich. Ich habe es zum grössten Teil nach einem Bericht aufgezeichnet, den ich an das Provinzialschulkollegium in Koblenz gesandt hatte.
2. Was kurz vor dem Lager Greuliches geschah.
Es war etwas ganz Greuliches. Um es kurz zu sagen: Wir hatten sechs Stunden geschwänzt! Die ganze Klasse! Drei vor den Kartoffelferien und drei am letzten Schultag vor dem Lager (Zwischen Kartoffelferien und dem Lager waren nur 9 Schultage.). – Es war am
Samstag, den 17. Oktober. Um ½ elf Uhr gingen wir schon nach Hause. Wir freuten uns, dass alles so gut klappte. Aber... Ich sass zu Hause auf meiner Bude und packte. Da schellte es. Es waren wohl ¼ vor 12. An der Tür standen Herbert Weise und Wilhelm Velten. „Nanu, was wollt ihr denn...!“ sagte ich. – „Fall nicht auf den Hintern!“ erwiderte Herbert. „Wir müssen die ganze Klassen holen kommen. Um 1 Uhr muss die ganze Klasse an der Penne zusammen sein! ...“ „Waaas...!!“ „Ja! -“ Mir stand der Atem still. Als wenn Herbert meine Gedanken ahnte, sagte er: „Ich musste noch vom Chef ’was unterschreiben lassen. Und der war noch nicht da, als wir streichen gingen. Und das ist ganz wichtig. So und so. – Und da musste ich doch noch mal zur Penne zurück. Und da stand Johannes und schnauzte mich an! Als ich ins Direktorzimmer ging und
die Unterschrift holen wollte, sagte Fräulein Buchholz: „Augenblickchen, bitte!“ – Und sie holte den Chef. „Die Untersekunda ist nach der 3. Stunde einfach nach Hause gegangen!“ Sagte sie zu ihm. „So!“ sagte er und glotzte mich an. Er tat so, als ob er noch von nichts wüsste. „Na, das sind ja nette Geschichten!“ Und ein Donnerwetter brach herein! Ich kann dir sagen, ich hab gezittert und gebebt! Und dann sagte der Idiot: „Und Du holst jetzt die ganze Klasse zusammen. Zuerst sagst du den Steelensern Bescheid; die sagen wieder den anderen Bescheid. Um 1 Uhr ist alles hier!“ Und dann drückte er mir die Ordinariatsliste in die Hand. Ja, und ...“ – „Der ist ja komplett verrückt!“ sagte ich. „Das ist ja unmöglich, um 1 Uhr alles da. Die sind doch garnicht alle zu Hause. Und stell Dir das mal vor! Ein paar wohnen in Altendorf, in Kray, Niederbonzfeld, Essen,
Bredeney, Freisenbruch ... nee, wahnsinnig! Als wenn die alle ’n Telefon hätten! Komm’, wir gehen zum Chef und sagen, ob er uns das nicht ersparen könnte; es sei unmöglich. Nach dem Lager könnte er uns ja Arrest geben.“ Gesagt – getan. –
Als wir drei in das Direktorzimmer traten, war gerade Dr. Sternitzke da und wetterte und fluchte: „Ist die ganze Untersekunda einfach nach Hause gegangen!“ Die 5. Stunde war gerade angefangen. Wir hatten in dieser bei ihm Deutsch. – Als er uns sah, sagte er: „Ah, da sind ja welche!“ Frl. Buchholz klärte ihn auf, was geschehen war. „Ja, ja, das ist richtig! Das tut euch gut!“ sagte Dr. Sternitzke und entfernte sich. Auf unsere bitte, den Direktor zu sprechen, sagte Frl. Buchholz: „Der ist nicht da!“ Da gingen wir zu Pille, zu fragen, ob wir das nicht lassen können. Da sagte er: „Nee, nee, was ihr einmal euch eingebrockt habt, da müsst ihr
auch nun sehn, wie ihr wieder ’rauskommt.“ Oberlehrer Kaps stand dabei und sagte lachend: „Ja, so ist’s richtig; das habt ihr nun davon!“ – Uns blieb aber nichts andres übrig, als uns aufs Rad zu schwingen und die Klasse zusammen zu holen.
Herbert hatte kein Rad. So musste er nach Hause gehn. Wilhelm fuhr nach Kray, um die beiden Krayer zu holen und dann nach Herbert Kirchhoff u. Berni Multhaupt. Ich sagte Rudi Stricker Bescheid, der jedoch keine Zeit hatte, andere zusammenzuholen. Dann fuhr ich nach Freisenbruch. Unterwegs kam mir Fredi Hasenkamp mit dem Rad entgegen. Er hatte eine Einkauftasche an der Lenkstange hängen. Ich hielt ihn an, und erzählte ihm die Geschichte. Er sperrte Mund und Augen auf. Er sagte: „Kurt Schön, Krause und Paganetty sind bei Witteler. Heinzi Hagenbruch sage ich Bescheid. Bis nachher dann!“ – Ich fuhr nach
Witteler und sagte da den dreien Bescheid. Sie machten natürlich grosse Augen. – Ich fuhr jetzt noch nach Herbert Weise, um ihm etwas zu sagen, traf ihn aber nicht zu Hause an. Ich sauste dann nach Huttrop, zuerst nach Paul Buchholz. Der wollte grade in die Badewanne steigen und musste sich festhalten, um nicht umzufallen, als ich ihm die Geschichte erzählte. Bei Heinz Vedder gings ebenso. Als ich bei Heckers anschellte, öffnete mir Helmut. Er machte so Telleraugen. Heinz sei nach Essen, sagte er. Er wollte aber gleich hingehen, zu Fuss, denn Heinz hatte sein Rad mit. Wir gingen zusammen nach Franz Woll, der schon halb ausgezogen war und auch baden wollte. Im Saus flutschte ich zur Schule zurück. Um den Essenern und Rellinghausern Bescheid zu sagen, langte die Zeit nicht mehr. Ich musste mich beeilen, noch zeitig zur Schule zu kommen. Er war kurz vor 1 Uhr.
Als ich zur Schule kam, standen schon alle da. Selbst die Altendorfer (Ferdi Frölich, Rudi Mintrop und Jupp Rotermund) waren da.
Fredi Hasenkamp hatte Josef Lillich (Überruhr) Bescheid gesagt, und der war nach Altendorf gefahren. Das Unmögliche ist möglich geworden. Alle, ausser den drei Essenern, zwei Rellinghausern und Schempi waren alle da. –
Doch der Chef war nicht da. Frl. Buchholz schrieb alle auf, die dawaren. Sie sagte: „Ihr seid doch dumme Jungens!“ „Montag fahren wir doch zum Lager. Da kann uns doch nichts mehr passieren! Wir können doch nicht aus dem Lager bleiben!?“ „Na, wartet mal ab!“ erwiderte sie und ging nach Hause. Wir hauten auch ab, zu Fuss, per Rad, per Omnibus, per Zug oder per Strassenbahn, wie wir gekommen waren. - -
Als wir am Montag Morgen, wie vereinbart, alle mit grossen Koffern am Bahnhof standen,
kam Pille, liess uns antreten und ... nicht in den Bahnhof gehen, sondern zum Gymnasium. Mit Ach und Krach schleppten wir die Koffer durch die Stadt. Die Leute grinsten uns an, als ob sie wüssten, was los sei. An jeder Ecke hielten wir, setzten die Koffer auf den Boden und verschnauften uns. Pille trieb uns an und sagte: „Jü! Ihr seid doch keine kleinen Kinder mehr! Nu mal los!“ Auf dem Schulhofe angelangt – es war gerade Pause – war ein grosses Hallo, als wir angelatscht kamen. Wir traten in einer Ecke an und warteten, bis die Pause um war. Dann kam Direx. Zuerst schritt er die Front ab. Dann mussten die vortreten, die Samstag Mittag um 1 Uhr nicht dawaren. Sie hatten keinen Bescheid gekriegt, damit war die Sache abgetan. Dr. Trieloff verhielt sich ganz ruhig. Er sagte: „Ich weiss nicht, was das für eine Disziplinlosigkeit ist, einfach 6 Stunden zu
schwänzen! Ihr meint, weil ihr jetzt ins Napo fahret, würde euch nichts passieren. Sollt mal sehn, wie ihr geschliffen werdet! Und Ihr kommt ja noch mal wieder... Dann habt ihr nichts zu lachen!“ Er liess uns eine halbe Stunde stillstehen. Abundzu musste er hineingehen, wohl um sich das Lachen zu verbeissen. Dann wurden wir geschliffen, da fehlen einem die Ausdrücke zu. Dauerlauf, gymnastische Übungen, Dauerlauf mit Koffern (!!!!), Marsch mit Koffern... usw. Als es zu Ende war, waren wir kaputt. Die Pauker standen alle an den Fenstern und lachten. Näheres zu schreiben, sträubt sich meine Feder. Heinz Hecker hat ein langes Drama darüber gedichtet, welches in der „Bierzeitung“ steht. Als wir endlich nach elf Uhr die Koffer aufnahmen, um zum Bahnhof zurück zu gehen, sangen wir alle vor Wut das Lied:
„Sennesand, du heisser Sand,
in dir bin ich sooft gerannt;
in dir vergoss ich manchen Schweiss,
du aber machst mich nicht mehr heiss!
Hauptmann, wenn ich dein gedenk,
so zittert mir mein Handgelenk,
du triebst uns in der Heid’ umher
mit einem Affen zentnerschwer.
Unser strenger Herr Major,
der nahm uns öfter selber vor;
und schien die Sonne garnicht heiss,
wir waren doch gebad’t in Schweiss.
Unser strenger Herr General,
der führt’ uns über Berg und Tal;
und war die Senne ihm zu klein,
gings in den Teutoburger Wald hinein.
(Trieloff, wenn ich dein gedenk,
so zittert mir mein Handgelenk.
Du triebst uns auf dem Schulhof her
mit einem Koffer zentnerschwer!)“
Erhobenen Hauptes, den Koffer hoch auf der Schulter, verliessen wir die Schule.
2. Bericht.
Am Fusse der Eifel, zwischen Düren und Euskirchen, liegt das alte Städtchen Zülpich, in anmutiger und fruchtbarer Gegend. Auf einem Höhenzug – 180 m hoch gelegen, beherrscht es mit seinen ragenden Burgtürmen nach allen Seiten hin das Blickfeld. Doch nicht nur im Landschaftsbild tritt Zülpich hervor. Schon im Altertum war „Tolbiacum“ römische Militärstation und ein wichtiger Knotenpunkt von zwei grossen Strassen; die eine führte in schnurgrader Linie nach Köln; sie ist heute noch zum grössten Teil erhalten. Die andere verband Trier mit Neuss. Beide Strassen kreuzen sich am Kin-
nab, dem Mittelpunkt der Stadt. Von einer grossen römischen Niederlassung zeugen heute noch Reste eines Bades und eine grosse Anzahl von Funden, die aus dieser Zeit stammen. –
Zülpich ist der Überlieferung nach der Ort, wo Chlodwig 496 die Allemannen schlug. Napoleon bezeichnete Zülpich im Hinblick auf diese Schlacht als die „Wiege des Frankenreiches“ (Inschrift in der Krypta der Petrikirche:
TOLBIACUM
CLODOVEI VICTORIA
INSIGNE
FRANCORUM FORTUNA
ET
IMPERAII INCUNABULA)
Die Stadt der Residenz Fränkischer Könige mit eigener Münzpräge und Kulturzentrum der bis an die Reichsgrenze ausgedehnten Zülpicher Christianität. Mitten im Jülicher Gebiet seit dem 11. Jahrhundert dem Erzstift
Köln gehörig, hatte Zülpich Sitz in den kurkölnischen Landtagen. Aus dieser Zeit (13. bis 17. Jahrh.) stammen Burg, Tore und Stadtmauer, die die kölner Kurfürsten und Erzbischöfe angelegt haben. Alle Befestigungsanlagen sind heute noch vollständig erhalten. – Zülpich hat heute 3600 Einwohner. Sein Hinterland mit Viehweiden, Obstgärten und weitgedehnten Äckern gestaltet sich, besonders im Westen, durch mannigfache Bodenbewegungen zu einer eigenartig schönen Landschaft, die langsam zu den Waldkuppen des Kermeter und den Rurbergen bei Niddeggen aufsteigt. – In diesem Städtchen fand vom 19. Oktober bis zum 4. November der 7. nationalpolitische Lehrgang statt. Siebzehn Tage verbrachten hier die Untersekunden des Adolf-Hitler-Gymnasiums in Opladen und des Karl-Humann-Gymnasiums in Essen-Steele in enger Kameradschaft, um nachher körperlich
und geistig gestärkt wieder nach Hause zurückzukehren. –
Die alten Bürger unseres 1000 jährigen Steele sehen sich verwundert um. Was mag heute morgen wohl los sein? Von allen Seiten kommen Jungen mit grossen Koffern zum Hauptbahnhof. Ist denn heute Musterung? Verständnislos blicken sie auf die jungen Kerle. – Nein, liebe Leute, so weit sind wir noch nicht. Aber zum Napolager gehts! Nach Zülpich. Allerdings zu einer späten Jahreszeit. Möge der Wettergott uns gnädig sein! Das wird eine grosse Sache! – „Ach soo! Napolager!“ sagen einige. Anderen wird die Sache noch geheimnisvoller. Aber dann werden sie schnell aufgeklärt, dass das Wort „Napo“ nichts wie „national-politisch“ bedeutet. Da hellen sich die Mienen auf, und lächelnd schauen die Alten auf die strahlenden Jun-
gen. – Da kommt unser Ordinarius. Der Klassenführer meldet die Klasse vollzählig angetreten. Nach einer Weile dampfen wir aus dem Bahnhof hinaus. „Nun, ade, du mein lieb’ Heimatland ...!“ Nein, schmerzlich ist der Abschied nicht. Bedeuten doch 17 Tage Napo-Lager 17 Tage keine Schule mehr! Manche wollen singen: „Reserve hat Ruh!“ Da sagt unser Ordinarius: „Ihr habt noch keine Ruh’! Für euch geht es jetzt erst los!“ – Es regnet Bindfäden. Doch ist die Fahrt nicht uninteressant: Wir kommen an vielen Braunkohlengruben vorbei. Manche haben so etwas noch nie gesehn. –
In Düren bleiben wir eine Stunde. – Kurz bevor wir nach Zülpich weiterfahren, reisen sicher 500 Rekruten nach Neustrelitz ab. Der Bahnsteig ist abgesperrt. Eine Musikkapelle spielt: „Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus, Städele hinaus, und du,
mein Schatz, bleibst hier.“ Der lange Zug setzt sich in Bewegung. Ein Winken und Rufen auf beiden Seiten, bis der Zug in der Ferne nur noch ein schwarzer Punkt ist, der immer kleiner wird, immer kleiner, und schliesslich unterm Horizont verschwindet. Noch eine Weile schauen die Zurückgebliebenen dem Schienenstrang nach. Dann wird der Bahnsteig langsam wieder leer. Viele weinen. Die Taschentücher, die vorhin Lebewohl gewinkt haben, trocknen jetzt die Tränen. Für die meisten ist es ein grosses Opfer, für die Rekruten wie für die Eltern; ist doch die Dienstzeit auf 2 Jahre erhöht worden. – Noch ein paar Jahre, dann kommen wir auch dran. Jetzt fahren wir ins Lager. Das ist noch kein Opfer; aber wir werden dort lernen, Opfer zu bringen, wenn das Vaterland ruft. –
Um ½ 5 Uhr marschieren wir durch das Kölntor in Zülpich ein. Es regnet. Doch das nimmt
uns nicht die Stimmung. Mit einem schmetternden Lied begrüssen wir die Zülpicher. – „Abteilung – halt!“ Wir stehen vor der Herberge. Hier sollen wir 17 Tage „hausen“?! Wenig versprechend! Eine kahle Hauswand ohne Fenster reckt sich vor uns in die Höhe. Die Opladener sind schon da. Damit sollen wir also 17 Tage zusammenleben!? Scheinen ja prima Kerle zu sein! Da kommt der Lagerleiter. Der wird besonders scharf angesehen..., wie er auch uns scharf ansieht. Das Lager wird eröffnet. Unter dem Gesange des H.J.-Liedes steigen die Fahnen hoch, die eine mit dem Hakenkreuz, die andre mit der Siegrune. – Jetzt werden wir in sechs Gruppen eingeteilt. Dann bekommen die Schlafräume angewiesen. Die Herberge ist eng. Alles muss gruppenweise geschehen. Endlich ist alles soweit. Mit Heisshunger wird das Abendessen vertilgt. Danach gibt
der Lagerleiter noch einige Anweisungen. Dann müssen wir die Füsse waschen und Zähne putzen. Der Waschraum ist gross und modern eingerichtet. – Nachdem jeder seine Decken und Bettwäsche bekommen hat. ist Lagerruhe. Jeder schläft mit dem befriedigenden Gefühl ein, in einer kleinen, aber schönen, gemütlichen Herberge zu sein.
„Aufstehn!“ Jäh fahren 62 Jungen aus dem Schlaf. Etwas umständlich – zuerst reckt man sich mal – steigt man aus dem Bett. Trainingszeug wird angezogen und auf der Strasse vor der Herberge angetreten. Im Dauerlauf gehts zum Krankenhaus, wo wir gewogen werden. Danach wird der letzte Schlaf aus den Augen gewaschen. Wir kleiden uns an, und dann werden die Betten gebaut. Manche machen es ziemlich ungeschickt; denen werden bei der Kontrolle die Decken wieder vom Bett abgerissen, und sie
müssen noch einmal von vorne beginnen. – Um ½ 8 ist alles im Tagesraum zum Frühstück. Zuerst wird der Tagesspruch vorgelesen. „Wir sind nicht auf der Welt zu geniessen, sondern unsere Schuldigkeit zu tun!“
Nach dem Kaffee tritt alles wieder an. Wir machen einen Ausmarsch in die Umgebung. Zuerst marschieren wir zum Weihertor hinaus nach Westen. Ungefähr ein Kilometer von Zülpich entfernt, bleiben wir stehen. Wir wenden uns um. Vor uns liegt die am Berghang sanft ansteigende Stadt. Zu ihren Füssen, ausserhalb der Stadtmauer, breiten sich Gärten mit unzähligen Obstbäumen aus. Auf dem höchsten Platz, dem Mühlenberg, die mächtige Burg, daneben die alte Petrikirche. Aus dem Häuserblock ragen der Rathausturm und der Turm der romanischen Martinskirche hervor. Vor uns liegt die Weihertorburg, eine der schönsten Doppeltoranlagen im niederrheinischen Gebiet. – Das
alles, umringt von der alten Stadtmauer, gibt ein prächtiges und geschlossenes Bild, und man könnte sich fast ins Mittelalter versetzt glauben, wenn man die Stadt mit ihren Türmen und Toren so vor sich liegen sieht, wenn nicht der rauchende Schornstein neben der Burg an die Gegenwart gemahnt. Die Burg ist seit 1847 im Besitz der Familie Sieger. Diese hat in den Gebäuden eine Schnapsbrennerei eingerichtet. Dadurch, dass sie die Burg erneuerte, hat sie diese vor dem Verfall bewahrt. Wenn der Schornstein nicht stünde, wären von der Burg nur noch Ruinen übrig. –
Wir wenden uns wieder um und sehen vor uns im Westen die Rurberge, links von uns im Süden die Hocheifel. Von einem 460 m hohen Berge grüssen die Schornsteine des Mechernicher Bleibergwerkes. – Während wir unsern Marsch fortsetzen, zeigt uns der Lagerleiter die Dörfer und Ortschaften, die wir um uns liegen sehn. Die
meisten sind im Tal eingebettet; von vielen erblickt man nur die Kirchturmspitze, die hinter einer Böschung hervorlugt. Der Lagerleiter zeigt uns Hoven, das direckt bei Zülpich liegt, Langendorf, Juntersdorf, Füssenich, Geich, Merzenich, Sinzenich, Linzenich, Lövenich, Ülpenich und Nemmenich. Eigenartig ist, dass fast alle Namen auf –ich endigen. In der Zülpicher Gegend geben es über 20 solche Ortsbezeichnungen. – Gegen Mittag kehren wir heim. Zuerst müssen wir unsere Schuhe reinigen. Wegen des nassen Wetters sind sie voll von Dreck. Sind sie gesäubert, nehmen wir von einem Regal die Hausschuhe und stellen die Stiefel darauf. Dann warten wir, bis zum Essen angetreten wird. – In der Zeit stehen viele vor dem Wandbrett, wo die Bekanntmachungen angeheftet sind. Es hängt dort schon der Tagesplan von morgen. Alle sind begierig, zu wissen, was es dann gibt. Manche studieren besonders den Plan
von Innendienst, der täglich gewechselt wird, ob sie auch schon drankommen. Es gibt da ein Küchendienst, der die Tische deckt, das Essen holt und aufträgt und nachher spült. Dann werden welche bestimmt, die die drei Schlafräume, die Treppe, den Tagesraum, Wasch-, Vor- und Gepäckraum fegen; einer muss den Abort reinigen (besonders angenehm, wenn ein Abtritt verstopft ist) und Hof und Strasse fegen. Der letzte „Posten“ war sehr gefürchtet und wer ihn hatte, wurde jedesmal von allen bedauert. Aber der ganze Innendienst ist ja schliesslich nur Dienst an der Gemeinschaft und erzieht jeden zur Selbständigkeit. – Der Unterführer vom Dienst pfeift. Im Nu ist alles auf der Strasse angetreten. Endlich! Alle haben Hunger. Es wird festgestellt, ob alles – ausser dem Küchendienst – da ist. Dann gehen wir hinein. Dampfende Schüsseln stehen auf den Tischen. Aber es wird nicht gleich drüber-
hergefallen. Jeder bleibt an seinem Platz stehen. Sobald alle eingetreten sind, meldet der U.v.D.: „Alles da!“ Der Tagesspruch wird wiederholt. „Guten Appetit!“ „Danke gleichfalls!“ Stühle rutschen und Gepolter; dann ist alles ruhig. Man hört nur noch das Klappern der Löffel und Gabeln. – Nachdem alle gesättigt sind, gehen wir in kleinen Gruppen, mit Skizzenblock und Bleistift bewaffnet, in die Stadt.
Wir müssen einen Plan mit den Strassen und wichtigen Gebäuden anfertigen. Bis 5 Uhr haben wir Zeit. Da gibt es allerlei einzuzeichnen: Die vier Tore, Weiher-, Bach-, Köln- und Münstertor, die Burg, Sparkasse, Bank, Molkerei, Schule, die Post und das Rathaus, die Gasthauskapelle, den Knochenturm mit dem Kriegerehrenmal, das Krankenhaus, die Landw. Schule, Kirche und Römerbad und schliesslich die Jugendherberge. Wenn auch die Stadt nicht gross ist, so ist es doch keine geringe Arbeit, alle Strassen mit
dem richtigen Winkel zueinander einzuzeichnen. Doch die Mühe wird dann belohnt, wenn man nachher einen guten Plan dem Lagerleiter zeigen kann. – Um ½ 7 essen wir unser Abendbrot. Dann marschieren wir zu einem Saal, wo der Film „Der höhere Befehl“ aufgeführt wird. –
Bevor wir zur Herberge zurückkehren, machen wir noch einen kleinen Nachtmarsch um die Stadt herum. – Man hört nur die Schritte. Sonst ist alles still. Keiner spricht... Über uns wölbt sich die sternenklare Nacht, leuchtet die schmale Mondsichel. – In den Bäumen rascheln die herbstwelken Blätter, vom Windhauch bewegt. Über uns ruft ein Vogel; ein anderer antwortet aus der Ferne. Dann Stille ... Wir marschieren durch das Münstertor wieder in die Stadt hinein. Finster ragt es in den nächtlichen Himmel. Viel grösser sieht es aus, wie am Tage. – Dunkel liegt die Strasse. Nur dort aus der Wirtschaft
dringt Licht heraus. Unsere Schritte hallen von den Häusern wieder. Wir stehen vor der Herberge, treten weg. In zehn Minuten liegt alles in den Betten. Es sind ½ 12. Nicht lange, so liegen alle in tiefem Schlaf. –
„Aufstehn!“ Haste, was kannste aus den Betten! Diesmal gehts schon schneller wie gestern. Frühsport, Waschen und Bettenbauen. Danach wird gefrühstückt. Die erste Post wird verteilt. Dann lässt der U.v.D. antreten. Wir marschieren zur Steinzeug und Rohrfabrik Kammerscheidt & Stumpf, die wir besichtigen wollen. – Zuerst wird uns der Ton gezeigt, die Werkmasse. Er hat eine helle, graublaue Farbe und wird in der Ville gegraben, wo er 40-50 m unter der Braunkohle liegt. Dieser Ton wird zerkleinert, dann zu Würfeln geformt und kommt so in die Formmaschine. Hier wird er zu Rohren geformt. Diese bekommen dann den Stempel
und unter einer anderen Maschine das Schraubgewinde. Bevor sie gebrannt werden, müssen sie eine Zeit lang trocknen. Dann kommen sie in grosse Öfen, wo sie übereinandergestellt in grosser Hitze gebrannt werden. Damit die Temperatur nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist, wird ein „Thermometer“ mit in den Ofen hineingestellt. Dieses besteht aus einer Platte, auf der sechs kegelförmige Säulchen stehen, die aus einer chemischen Substanz hergestellt sind und bei bestimmter Hitze nacheinander schmilzen. Diese Dinger seien sehr teuer, und es muss ja jedesmal, wenn der Ofen neugefüllt wird, ein neues hinein. Aber wenn die Hitze zu gross ist, sind alle Rohre, die (je nach Grösse des Ofens) einen Wert von 5-10000 M haben, verdorben. Die prächtige, rotbraune Farbe, die zuweilen blauschwarz schimmert, wird durch einfaches Kochsalz erzeugt, das schaufelweise mit den Kohlen in die Feuerungen geworfen wird. –
Als uns das alles gezeigt und erläutert worden ist, bedanken wir uns und verlassen die Fabrik. Draussen vor den Gebäuden liegen in grossen Stapeln Rohre verschiedenster Art, lange und kurze, enge und weite, gebogene und gerade, je nach der Güte sortiert. Die besseren bekommen die Stadtverwaltungen geliefert. – Mit neuen Kenntnissen erfüllt, marschieren wir zur Herberge zurück. –
Dann ist Freizeit. Viele gehen in die Petri-Kirche, um den Ausgrabungen, die dort zur Zeit vor dem Chore gemacht werden, zuzuschaun. Die Ausgrabung war nötig, um einen neuen Zugang zur Krypta zu schaffen. Sie umfasst einen Raum von 10 m Länge, 1,80 m Breite und 2,30 m Tiefe. Bei den Arbeiten stiess man, wie erwartet, auf römische Überreste. Vor uns liegen Scherben von Krügen und Schalen (terra sigillata) und anderes. Es wurden auch die Skelette von zwei
Männern zutage gefördert. Sie sollen von zwei Pröbsten stammen, die hier beigesetzt worden sind. Man stiess auch auf die Fundamentsmauern römischer Bauten, die die Fortsetzung des Römerbade neben der Kirche sind. So konnte ein gut erhaltener Abwässerkanal freigelegt werden. – Die Petri-Kirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist eins der ehrwürdigsten und baugeschichtlich interessantesten Bauwerke des Kölner Flachlandes. In der Krypta, die im 11. Jahrhundert von Erzbischof Anno erbaut wurde, sind Gedenktafeln zur Erinnerung an die Schlacht bei Zülpich u. a. aufgestellt. Die prächtigen Seitenaltäre sind aus Antwerpener Schnitzwerkstätten und 400 Jahre alt. Der Turm der Kirche wurde 1815 erbaut. Über dem Portal ist folgende Inschrift:
TVRRIS CONSTRVCTA INFINITO SIT DEDICATA DEO.
(Die grossen Buchstaben zusammengezählt als römische Ziffern ergeben das Erbauungsjahr) –
Um ½ 1 wird zu Mittag gegessen. – Das Essen war das ganze Lager über gut; nur hätte es abwechslungsreicher sein können. Aber wenn einige Muttersöhnchen stöhnten, das Essen sei schlecht, man würde nicht satt, so haben sie Unrecht. Man konnte immer noch nachholen. Öfters blieb sogar noch etwas übrig. Wenn welche nicht satt geworden waren, so lag es daran, dass sie nicht nachgeholt hatten, weil sie so verwöhnt waren und das Essen nicht mochten. – Nach dem Essen wird die Post verteilt. Nach einem Ausmarsch ist Freizeit. Manche schreiben nach Hause, andere lesen. Zeitungen und Zeitschriften stehen uns genug zur Verfügung. Andere spielen Tischtennis, von denen drei Stück da sind, Mühlchen oder Schach. Die Lehrer spielen mit uns und gewinnen dabei sehr oft. Manche skaten, wieder andere zeichnen. Wir haben sogar ein Radio. Nach dem Abendessen hören wir die Nachrichten.
Dann steigt ein Singabend. Wir singen die Kampflieder der Bewegung, Fahrtenlieder und ein paar lustige Kanons, bei denen die Mimik nicht fehlt. – Um ½ 10 gehen wir zu Bett. –
Am andern Morgen werden Arbeitsgemeinschaften gebildet. Vier Jungen (die blass aussehn, aber doch ziemlich kräftig sind,) sollen jeden Morgen zur Molkerei. Dort müssen sie „schwer ’ran“, aber sie dürfen soviel Milch trinken, wie sie wollen. Viele sollen paarweise zu Bauern nach verschiedenen Orten gehen. Zwei gehen in die Gärtnerei. Andere zeichnen, fotografieren oder treiben Geländekunde. Das alles wird nun besprochen. Die Jungens, die zu den Landwirten, zur Molkerei und zum Gärtner kommen, werden ausgewählt. Die „Bauern“ werden zu den verschiedenen Ortsbauernführern geschickt, um zu
sehn, wo sie unterkommen können. Ebenso gehen die „Bleichen“ zur Molkerei und die „Gärtner“ zur Gärtnerei, um sich vorzustellen. Die Zeichner und die anderen machen sich auch sofort an die Arbeit. –
Es ist Sonntag. Die Sonne lacht vom Himmel, die Kirchenglocken läuten; alles ist in froher Stimmung. – Nach dem Frühstück gehen die Katholiken zum Hochamt. Die Protestanten hören am Radio eine Morgenfeier, da in Zülpich keine evangelische Kirche ist. – Nach dem Kirchgang ist ein kleiner Ausmarsch in den frischen Morgen hinein. Gegen 11 Uhr kehren wir wieder heim. Bis zum Essen ist Freizeit. Es gibt: Nudelsuppe, Kartoffeln, Gurken und Gulasch, ein sonntägliches Essen. –
Nach der Mahlzeit ist grosses Stiefelputzen. Das tun wir jeden Tag wohl zwei oder drei mal. Aber so genau, wie heute... Einer muss
alle Schule prüfen. Keiner kommt auf das Regal, der nicht tip-top ist. Der Kontrolleur ist unerbittlich. Der Lagerleiter selbst sieht auch die Schuhe nach. „Was?! Die sollen blank sein? Raus! Noch mal putzen! Da muss ich mich drin spiegeln können!“ Auch unter der Sohle darf kein Körnchen Schmutz sein. Besonders schwer, genagelte Schuhe zu säubern! Der Lagerleiter kratzt mit dem Fingernagel unter jede Sohle. „Was! Das soll sauber sein! Sieh mal meinen Fingernagel! Ganz schwarz. An euren Schuhen mache ich mir alle Fingernägel dreckig! Die Sohlen muss man ablecken können! Das soll Leder sein? Das machst du mir nicht weis! Dreck ist das, purer Dreck!! Sieh mal hier! Raus! Noch mal putzen! – Da kommst du ja schon wieder! Die Stiefel sind noch genau so schmutzig, wie vorhin. Noch mal! Du putzt solange, bis sie ganz sauber sind, dass ich
mir nicht mehr die Finger dran versaue!“ In diesen und anderen Tönen geht es weiter, bis alle zur Musterung in Sonntags-Zeug und blanken Schuhen antreten müssen. Jeder wird von vorne und hinten kritisch beschaut. Dann ist bis 5 Uhr Ausgang! – Von 5 Uhr bis zum Abendessen ist „Sacheninstandsetzen“, wie auf dem Plan steht. Das ist: Knöpfe annähen, Löcher stopfen, usw. Die nichts kaputt haben, spielen, schreiben oder lesen. – Nach dem Abendessen hören wir den Sportbericht und die Nachrichten, von denen uns besonders der Wetterbericht interessiert. Dann ist ein Spielabend. –
An einem Nachmittag gehen wir ins Heimatmuseum und Römerbad. Das Museum befindet sich im Probsteigebäude neben der Kirche. Wir sehen dort viele Gemälde von Prof. Hubert Salentin. Dieser wurde am
15.I.1822 in Zülpich geboren. Er war zuerst Nagelschmied. Er ist einer der hervorragendsten Meister der deutschen Genrekunst des vorigen Jahrhunderts. Er starb hochbetagt am 6.VI.1910. Die Vaterstadt setzte ihrem Ehrenbürger über sein Grab auf dem Friedhof von Zülpich ein Denkmal. Unter seinen vielen Gemälden sehen wir auch Studien aus dem Schwarzwald, wo Salentin längere Zeit gewesen war. – Dann ist unter anderem ausgestellt: frühgeschichtliche, römische und fränkische Funde, alte Gewerbe (Lichtezieherei, Hostienbäckerei) Hausrat, Volksbrauch, Stadt- und Bruderschaftsgeschichte, Trachten, Figuren, eine alte Küche und eine Wohnstube, alte Schlösser, eine Münzensammlung. –
Als wir das alles gesehen haben, gehen wir ins Römerbad. Dieses stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus – 5. Jahrh. n. Chr. Es ist ein Kalt- und Warmwasserbad. Wir
sehen die Feuerungen und alle kunstvollen Vorrichtungen. Das Bad beweist, dass zu Zeiten der alten Römer schon auf dem Boden, auf dem das heutige Zülpich steht, eine grössere Ansiedlung gewesen war.
An einem Morgen besuchten wir die Papierfabrik Sieger. Hier wird Packpapiere und Pappkarton fabriziert, in dem einen Werk aus Stroh und Kalk, in dem anderen aus Altpapier. Zuerst betreten wir das Kesselhaus. Hier wird der Dampf für die Maschinen erzeugt. Das Brennmaterial ist Braunkohle. Die Krafterzeugung geht von Dynamos aus, die durch Turbinen angetrieben werden. – Jetzt treten wir aus dem Raum hinaus und stehen vor einem grossen Speicher, in dem Stroh aufgestapelt ist. Dieses wird zu Häksel zerkleinert, welches, mit Kalk und Wasser vermengt, gekocht wird. Dieser Brei kommt auf Walzen, wo er gepresst
und getrocknet wird. Schliesslich wird das so entstandene Papier geschnitten, aufeinandergepappt und „veredelt“, indem die braune Pappe auf beiden Seiten mit weissem Papier beklebt wird. Alles geht natürlich maschinell. Würde man die Pappe ganz aus weissem Papier herstellen, kostete sie zu viel Geld. – Die grossen, viereckigen Kartons werden jetzt gebündelt und verpackt. Die Packungen, die wir sehen, tragen die Aufschrift: „Haifa – Tel-Aviv“. Also bis nach Palästina geht der Versand! Auf unsere Frage sagt der Herr, welcher uns führt, dass die Tagesverarbeitung 150 000 kg Stroh ist. 100 kg Stroh kostet 1,60 M, 100 kg Papier 13,00 M. –
Nun gehen wir zu dem anderen Werk. Grosse Haufen von Altpapier liegen davor. Dieses wird in der Papiermühle zerkleinert zwischen grossen Steinen, die 30-40 Zentner schwer sind. Aus dem Brei wird Holz, Stan-
niol usw. heraussortiert. Dann wird der Brei wieder gewalzt, getrocknet und das Papier geschnitten, ähnlich, wie wir es vorhin sahen. – Zum Schluss sehen wir die grosse Dampfmaschine. Das grosse Schwungrad misst sicher 4 Meter im Durchmesser. Alles blinkt und blitzt. Die Riemen sausen, die Kolben stampfen, der Zentrifugalregulator kreist. Bewundernd stehen wir vor dem Werk der Technik.
So vergingen die Tage. – Einmal hörten wir einen interessanten Vortrag in der landwirtschaftlichen Schule in Zülpich über „Ackerbau und Viehzucht im Kreis Euskirchen“. Aus dem Referat möchte ich noch wiedergeben, dass Zülpich die wenigsten Regentage der Eifel und der Kölner Buch hat. Es liegt im Regenschatten des Hohen Venn. Zülpich ist durch seine Obstbaumzucht berühmt. Es werden besonders viel Zuckerrüben
angebaut. Die Ernte war dieses Jahr besonders gross. Da aus den Rüben Zucker gewonnen wird und die Kühe die Strünke gern fressen, tragen die Bauern der Zülpicher Gegend viel zur Erzeugungsschlacht bei. – Der Gärtner zeigte uns einmal seinen Garten. Später hielt er bei uns in der Herberge noch einen Vortrag über die Obstbaumzucht. –
Das Bindeglied zwischen Lehrgang und der Zülpicher HJ. wurde durch einen gemeinsamen Heimabend hergestellt. – Auf einem Abend der Partei, zu dem wir eingeladen waren, sprach Pg. Haase über die Erzeugungsschlacht. – Durch den Rundfunk hörten wir die Reden Görings und Mussolinis. –
Auch Sport trieben wir im Lager. Mehrere Male spielten wir Fuss- und Handball. Ein Fussballspiel machten wir gegen den Zülpicher Fussballklub, das mit 4:1 für Zülpich ausging. – Einmal machten wir ein Gelände-
spiel (in der Wollersheimer Gegend), am letzten Tag noch eine Schnitzeljagd. –
Am letzten Tag war Grossreinemachen. Die Böden wurden geschrubbt, die Fenster und Bilder geputzt (mit Papier), Tische und Bänke und Stühle abgestaubt, der Abort gereinigt (zwei Abtritte waren übergelaufen), der Waschraum geschrubbt, die Kräne darin geputzt, Hof und Strasse gefegt. Die Bettdecken wurden ausgeschlagen; alle hatten genug zu tun. War alles sauber, wurden die Schuhe gewichst und die Koffer gepackt, soweit es ging. –
Am Abend sassen wir alle noch einmal zusammen, zum letzten Mal. Die uns schon so vertrauten Lieder, die wir während des Lehrgangs gelernt hatten, wurden gesungen. Viele sammelten Autogramme. – Nachher kam noch der Herbergsvater, den wir
„Paul Kemp“ nannten wegen seiner grossen Ähnlichkeit mit dem Filmschauspieler. Er sang zur Klampfe ein Lied, dessen Verse auf verschiedene Jungen gemünzt waren und die er aus dem Stegreif machte. „Paul Kemp“ wurde mit Beifall überschüttet, und wir hatten grossen Spass. – In der letzten Nacht kam noch der „heilige Geist“...
Am anderen Morgen stehen wir schon um 5 Uhr auf. Die Herbergsdecken werden abgegeben, die Betten gemacht und die Koffer gepackt. Dann waschen wir uns und warten auf das Frühstück. Wir plaudern noch lange miteinander, bis es Zeit wird. Es ist ½ 7 und noch dunkel; es regnet. Zum letzten Mal steht der Lehrgang vor der Herberge angetreten. Der Lagerleiter spricht kurze Abschiedsworte. Die Fahnen werden eingeholt. „Der Lehrgang ist beendet!“ Wir treten weg. Die Opladener bleiben noch da; sie fahren erst später.
Ein herzliches Abschiednehmen und Händedrücken. Ein dreifaches Heil, welches die Opladener an uns Essener bringen, erwidern wir. Als auch der Herbergsvater kommt und sich verabschieden will, ruft einer: „Paul Kemp ein dreifaches Sieg-Heil!“ Alle stimmen heiter mit ein. „Paul Kemp“ lacht über’s ganze Gesicht. Ich höre, wie einer sagt: „Und schön war’s doch!“ Ja, schön war es, das ganze Lager. Schön war sogar das Strafexerzieren, weil welche Weintrauben geklaut hatten. –
Wir Essener treten wieder an. Marschieren ab zum Bahnhof. Die Koffer bringt schon ein Wagen hin. Ein paar Opladener begleiten uns noch. Wir singen die Lieder, die wir im Lehrgang gelernt haben. Der Schritt hallt von den Häusern wieder.
„Reserve hat Ruh’, Reserve hat Ruh’;
und wenn Reserve Ruhe hat,
dann hat Reserve Ruh’! -
Wenn wir einst am Bahnhof stehn,
und müssen auseinandergehn,
dann wird noch mal die Mütz’ geschwenkt,
weil uns kein Sennesand mehr drängt. -
Die Welt ist gross, die Welt ist schön;
Wer weiss, ob wir uns wieder sehn?“
Wir stehen am Bahnhof. Ein letztes Händedrücken. – Um 7.22 Uhr rollt der Zug ab in den grauenden Morgen.
4. Ein Witz.
Jakob Laux’ kleine Tochter: „Papa! Die Jungens sagen immer, du wärst der Paul Kemp. Du bist doch der Laux Köbes!“ –
5. Die Opladener.
Als Lehrer waren bei den Opladenern Oberturnlehrer Gressner und Studienassessor Dr. Nebel. Letzterer war ziemlich dick, hatte eine Glatze und besass noch ein Fahrrad, was er im Lager hatte. – Die Namen der Opladener Kameraden sind diese:
H. Schmid (genannt Pico), K. Becker, W. Paulerberg, Hans Leyhausen, Clemens Dietsch (Clemm), Klaus Rothhaus, Günther Huckenbeck, Hans Klünsch, Herbert Fenner, Erich Petry, H. Pöhland (Pilo), Kurt Schultes, Heinz Kraft, F. Helfer, Adolf Geller, Hans Peters, H. Hommel, Hans Jost, Karl Heinz Neberdieck, Heinz Hertel, Egon Bauer, Fritz Steffens, Peter Eschweiler, Alfred Paas, Clemens Budde, Heini Pahls, Hans Günter Wirtz, G. Dornhaus, Heinz Wirths, Willi Haase.
Der Lagerleiter war Studienassessor Cramer.
6. Was bekamen wir zu essen?
Wie das Essen im allgemeinen war, habe ich auf Seite 127 oben geschildert. –
Morgens gab es immer Marmelade-Butterbrote und Kaffee. –
Montag, den 19. Oktober.
Abends: Puddingsuppe, Butterbrot.
Dienstag, den 20. Oktober.
Mittags: Bohnensuppe.
Abends: Reissuppe, Butterbrot (Käse).
Mittwoch, den 21. Oktober.
Mittags: Rindfleischsuppe, Kartoffeln, Wirsing, Frikadellen.
Abends: Frühlingssuppe, Butterbrot (Wurst).
Donnerstag, 22. Oktober.
Mittags: Linsensuppe, Knackwurst.
Abends: Griesmehlsuppe mit Rosinen, Butterbrot (Leberwurst).
Freitag, den 23. Oktober.
Mittags: Suppe, Endiviensalat, Kartoffeln, Klops.
Abends: Suppe, Butterbrot.
Samstag, den 24. Oktober.
Mittags: Sauerkraut, Kartoffelbrei, Wurst.
Abends: Suppe mit Butterbrot.
Sonntag, den 25. Oktober.
Mittags: Nudelsuppe, Kartoffeln, Gurken, Gulasch.
Abends: Puddingsuppe, Butterbrot (Schinken).
Montag, den 26. Oktober.
Mittags: Bohnensuppe mit Knackwurst.
Abends: Kartoffelsuppe, Butterbrot (Leberwurst).
Dienstag, den 27. Oktober.
Mittags: Suppe, Kartoffeln, Möhren, Frikadelle.
Abends: Griesmehlsuppe, Butterbrot (Blutw.).
Mittwoch, den 28. Oktober.
Mittags: Erbsensuppe mit Knackwurst.
Abends: Puddingsuppe, Butterbrot (Leberw.).
Donnerstag, den 29. Oktober.
Mittags: Suppe, Kartoffeln, Wirsing, Gulasch.
Abends: Griesmehlsuppe, Butterbr. (Sülze).
Freitag, den 30. Oktober.
Mittags: Linsensuppe mit Bratwurst.
Abends: Puddingsuppe, Butterbrot (Käse).
Samstag, den 31. Oktober.
Mittags: Sauerkraut, Kartoffeln, Wurst.
Abends: Reissuppe, Butterbrote (Leberwurst).
Sonntag, den 1. November.
Mittags: Graupensuppe, Kartoffeln, Gurken, Gulasch.
Abends: Puddingsuppe, Butterbrot (Zungenw.).
Montag, den 2. November.
Mittags: Bohnensuppe, Knackwurst.
Abends: Kartoffelsuppe, Butterbrot (Wurst).
Dienstag, den 3. November.
Mittags: Nudelsuppe, Wirsing, Kartoffeln, Frikadellen.
Abends: Kartoffeln mit Sose, Butterbrot (Wurst).
Inhalt
Seite
Nachtrag zum ersten Buch. 75
V. Obertertia 80
1. Erinnerungen 80
2. Unsere Klasse 85
3. Die Pauker 86
VI. Untersekunda 89
1. Die neuen Pauker 89
2. Die Bierzeitung 91
3. Was sonst im Schuljahr 1936/37 geschah 93
VII. Lehrgang 7, Zülpich 99
1. Vorwort 99
2. Was kurz vor dem Lager Greuliches geschah 99
3. Bericht 109
Zülpichs Geschichte und Lage 109
Tag der Abfahrt 112
Abfahrt, Düren, Ankunft, Eröffnung des Lagers.
Der erste Tag 116
Aufstehn, Frühsport etc., Zülpichs Lage, die
Umgebung, Innendienst, Mittagessen, Stadtplan,
Nachtmarsch.
Der zweite Tag 123
Besichtigung der Steinzeugfabrik,
Ausgrabungen in der Petri-Kirche, Mittagessen,
Spiele, Beschäftigung in der Freizeit, Singabend.
Arbeitsgemeinschaften 128
Ein Sonntag 129
Der Morgen, Stiefelputzen, Ausgang, Der Abend.
Das Museum 131
Das Museum, Hubert Salentin, das Römerbad.
Die Papierfabrik 133
Schulung 135
Vortrag in der Landw. Schule, Ackerbau und
Viehzucht. Geistige und körperliche Schulung.
Der letzte Tag 137
Grossreinemachen, Abschied.
4. Ein Witz 140
5. Die Opladener 141
6. Was bekamen wir zu essen? 142
Inhalt 145
Register 147
1. Die Lehrer.
Balensiefer, Studienrat 87.
Beckmann, Studienass. 90, 95.
Böhmer, Studienrat, „August“ 81, 82, 87, 90, 95.
Cramer, Studienass. 141.
Decker, Studienassessor, 90.
Dittmar, Studienrat, „Dackel“, 77, 86, 89.
Eggerath, Dr. Studienass., 90, 95, 96, 97.
Gaillart, Dr. Studienrat 95.
Goldstein, Dr. Studienass. 86.
Gressner, Oberlehrer 141.
Hochkirchen, Studienr. 86.
Holtermann, Studienass. 89, 100.
Kaps, Oberlehrer, 84, 87, 103.
Linnenborn, Studienrat, „Pat“, 89, 95, 96, 102, 106.
Nebel, Dr. Studienassessor 141.
Schultes, Studienass. 90.
Steinbrink, Dr. Studienrat, „Schöps“, 86, 87, 90, 91.
Sternitzke, Dr. Studienass. 90, 102.
Spennrath, Studienrat, 87, 90.
Tillmann, Dr. Studienass. 86, 87, 90.
Trieloff, Dr. Otto, Direktor, 78, 79, 81, 89, 101, 105-108.
Wagner, Studienass. „Kiki“, 87.
Weyres, Dr. Studienrat, „Peias“, 84, 85, 90.
2. Die Schüler.
Badde, Fritz, KM, 91. (1941 gefallen)
Buchholz, Paul, KM, 75, 91, 104.
Buchholz, Frl. 101, 103, 105.
Büscher, Wolfg., „Jonni“, 96.
Frölich, Ferdi, KM, 91, 105.
Hagenbruch, Heinz, 103.
Hasenkampf, Fred, 103, 105.
Hecker, Heinz, KM, 75, 76, 79, 92, 91, 93, 104, 107.
Hecker, Helmut, 97, 104.
Kirchhoff, Hub., „Gandhi“, 103. (1941 gefallen)
Krause, Hans, 103.
Lillich, Josef, KM, 75, 91, 105.
Mintrop, Rudi, 105.
Multhaupt, Berni 103.
Paganetty, Theo, 103.
Rotermund, Josef, 105.
Schempershofe, Leo, 105.
Schön 103.
Stricker, KM, 75, 76, 79, 92, 103. (1941 gefallen)
Vedder, H. 104.
Velten, W. 100-103.
Woll, F. 104.
Weise, H. „Zappel“, 96, 100-104.
Essen-Steele und Umgegend
„Herr Hase weiß mal wieder von nichts“
Die Schüler des Karl-Humann-Gymnasiums sammeln Küchenabfälle
Herr Hase meldete gestern seinen Jungen am Karl-Humann-Gymnasium an. Der Termin ist allerdings längst vorüber, aber da Hase nun einmal Hase ist und keine Zeitung liest, wußte er von nichts. Erst gestern erfuhr er am Stammtisch davon. Nun beeilte er sich, seinen Sohn noch anzumelden.
Als er das Schulgebäude betrat, erblickte er eine riesengroße Kiste.
Darin konnte man wohl mehrere Jungen hineinstecken. Nun ist Herr Hase von Natur aus nicht so wißbegierig, aber diesmal wollte er doch wissen, wofür eine so große Kiste hier in der Schule steht. Er ging also hin, hob den schweren Deckel hoch und steckte den Kopf hinein. Was war das für ein Geruch? Die Mülleimer riechen auch oft so. Herr Hase erkannte Kartoffelschalen und alle möglichen Küchenabfälle, die den Boden der Kiste bedecken. Da machte er große Augen. Einen Jungen, der vorbeiging, fragte er, was das zu bedeuten habe. Da machte der Junge ebenfalls große Augen. „Wie, das wissen Sie nicht? Solche Kisten stehen doch in jeder Schule. Darin kommen Küchenabfälle, die wir von Hause mitbringen.
Das ist doch für die Schweinefütterung.“
„Schweinefütterung?“ sagte Herr Hase und machte noch größere Augen. – „Was ist denn das wieder?“ – „Ja, lesen Sie denn keine Zeitung? Mit den Küchenabfällen werden in Essen 1000 Schweine für das WHW gefüttert. Jeder Schüler hatte einen Sack bekommen, worin er die Küchenabfälle, die er zu Hause und in der Nachbarschaft sammelt, hineinsteckt. Den vollen Beutel bringt er zur Schule zurück und entleert ihn in diese Kiste. Dann nimmt er ihn wieder mit nach Hause, um ihn von neuem zu füllen.“ – „Ach so!“ sagte Herr Hase. „Muß da jeder die Abfälle mitbringen?“ – „Sicher, alle!“ – „Ja, da müßte doch die Kiste viel voller sein; es ist ja nur eben der Boden bede[ck]t!“ – „Ja,“ sagte der Junge und kratzte sich hinterm Ohr. „Leider bemühten sich nicht alle Schüler so eifrig bei der Sammlung. Die Kiste müßte viel voller sein! Der Bauer, dessen Schweine unsere Schule mit Futter versorgt, hat sich schon deswegen beschwert. Er hat sich nämlich eine Reihe neuer Schweine angeschafft und verläßt sich in der Futterbeschaffung auf uns, da er die Schweine nicht alle versorgen kann. – Viele Jungen haben ihren Beutel auch viel zu lange zu Hause, anstatt ihn sofort zur Schule zu bringen, wenn er voll ist. – Wenn die Jungen zu Hause nicht genug Abfälle haben, so sollen sie in der Nachbarschaft sammeln. Ueberhaupt soll jeder deutsche Volksgenosse sich an dieser Aktion beteiligen. Die Küchenabfälle, die sonst in den Aschenkasten geworfen wurden, soll man den Sammlern geben, die danach fragen.“ – „Ach Gott, was heute nicht alles gesammelt wird. In meiner Jugend war das nicht so. Was hat man denn auch davon?“ klagte der Herr Hase. Der Junge erwiderte: „Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß Deutschland vieles entbehrt, was es vor dem Kriege aus dem Ausland beziehen konnte. So muß heute alles Altmaterial gesammelt werden, damit es wieder verwendet wird. Genau so ist es mit der Küchenabfallsammlung. Wie Sie wissen, haben wir keinen Ueberfluß an Schweinen. Mancher Bauer kann jetzt durch diese Hilfe seine Schweinezucht vergrößern. Wer sich weigert, Altmaterial und Küchenabfälle zu sammeln, sabotiert den Vierjahresplan und damit das Aufbauwerk des Führers. Manche nehmen vom Staat dies und jenes als selbstverständlich hin, aber daß sie etwas dem Staate, dem Volke, geben, halten sie für unnötig. Was sie dem Volke vorenthalten, verweigern sie sich selbst. – Ihre Frage, was Sie davon hätten, Herr Hase, ist hiermit beantwortet. Ich glaube, daß Sie sich, wie alle Volksgenossen, in den Dienst des Vierjahresplanes stellen!“
Kranz