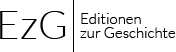Gisbert Kranz: "Meine Pennezeit" (3)
Es handelt sich hier um das dritte von vier Heften, die Gisbert Kranz als Schüler des Carl-Humann-Gymnasiums in Essen Steele angelegt hat. Auf insgesamt fast 300 handschriftlichen Seiten (die hier auch transkribiert vorliegen) bietet er eine Chronik seiner Schulzeit von seiner Aufnahmeprüfung am Gymnasium im März 1931 bis zum Abitur acht Jahre später.
Es wird Wichtiges und Unwichtiges beschrieben und immer wieder um längere Charakteristiken einzelner Lehrer ergänzt. Insofern bietet diese "Chronik" aus Schülersicht interessante Einblicke in den Schulalltag in Steele.
Das Werk entstand offenbar nicht "in einem Guss". Der erste Band etwa wurde zwischen Juli 1935 und Februar 1937 im Schularchiv aufgehoben und muss demnach bereits vor Juli 1935 entstanden sein.
3. Abschnitt:
Obersekunda. I.
Eine neue Epoche in der Geschichte des Schulwesens begann. Große Reformen kamen. In diese Epoche fiel unsre Grenzlandfahrt, die wir im Sommer 1937 mit unsrer Klasse machten. Sie war das größte Erlebnis dieses Schuljahres 1937-38, ja – vielleicht meiner ganzen Schulzeit. Deswegen setze ich sie zu Anfang dieses Abschnittes und lege ein besonderes Heft dafür an. Denn in wenigen Sätzen oder auf wenigen Seiten kann ich nicht schildern, was wir auf dieser Fahrt alles erlebt haben.
VIII. Grenzlandfahrt.
13. Juni – 19. Juni 1937.
1. Wie es kam.
In den ersten Tagen des neuen Schuljahres 1937/38 sagte unser neuer Klassenlehrer, Studienassessor Konrad Eggerath, daß er etwas Besonderes mit uns vorhabe. Wir sollten uns deswegen fleißig anstrengen, damit wir es auch verdienten. Wir wußten natürlich nicht, was er meinte, und drängten ihn, doch zu sagen, was er mit uns „Besonderes vorhabe“. Schließlich sagte er uns auch, daß er mit uns eine Grenzlandfahrt machen wolle, und zwar nach Aachen und Monschau. Wir waren alle hochbegeistert, denn Herr Eggerath hatte uns vor Ostern, als wir noch in UII waren und bei ihm Biologie hatten, einmal erzählt, wie er eine Grenzlandfahrt nach Aachen mit einer Klasse gemacht habe. Er hatte diese Fahrt schon mehrere Male unternommen. Er ist – nebenbei
gesagt – auch Leiter der Stelle „Grenzlandfahrten“ am Standort Essen der HJ. – Also, der Plan war gefaßt, und zwar sollte es für 3 Tage losgehn. Wir müßten aber gute Leistungen zeigen, uns anständig aufführen, die monatlichen 30 Pfennig pünktlich abgeben und fleißig Küchenabfälle für die Schweineversorgung mitbringen, damit wir beim Chef auch eine gute Nummer bekämen und er uns die Fahrt erlaube. Wir sollten aber noch keinem etwas von dem Plan sagen. – Seitdem rechnete unsere Klasse als erste am Monatsanfang ab. Die Kartoffelschalenkiste war viel voller, als sonst. Ja, einmal sagte der Chef, wenn die Schule in zwei Tagen die grosse Kiste voll kriegte, würden wir schulfrei bekommen, kartoffelfrei! Die Kiste war natürlich in zwei Tagen voll, und zwar zum Überlaufen; es mußte noch eine zweite, kleinere Kiste geholt werden, um alle Abfälle unterzubringen. Unsere Klasse hat da wohl am meisten mitgetan. – Wie es so kam, eines Tages sagte Herr Eggerath zu
uns, mit drei Tagen kämen wir nicht aus, wir müssten schon 7 Tage haben. Die Eisenbahnfahrt nach Aachen würde sich sonst nicht lohnen. Wir waren damit natürlich alle einverstanden. – Mit dem Geld regelten wir es so: Herr Eggerath sagte, er brauche von jedem durchschnittlich 16 Mark für die Fahrt. Jeder sollte einen verschlossenen Briefumschlag mit einem Zettel mitbringen, worauf der Vater schreiben solle, wieviel er für die Fahrt bezahlen könnte. Wer mehr als 16 M aufbringen könnte, sollte es tun, wer keine 16 M aufbringen könnte, sollte weniger bezahlen. So wurde es dann auch gemacht. Als das Geld zusammen war, hatte Herr Eggerath von jedem durchschnittlich knapp 16 M in der Fahrtenkasse. – Der Direktor gab uns die Erlaubnis, und vom Provinzialschulkollegium in Koblenz kam der Bescheid, wir dürften fahren. Groß war der Jubel, als Dr. Steinbrink sagte, er fahre auch mit. Nun schwamm alles in bester Butter. Die nötigen Anweisungen wurden erteilt, der Treffpunkt bestimmt und die Abfahrzeit, und dann ging’s los!
2. Die Fahrt nach Aachen.
Sonntag, den 13. Juni.
Punkt 4 Uhr stand alles am Hauptbahnhof Essen an der großen Uhr, wie es verabredet war, mit Affen, kurzer, schwarzer Hose und ... mit frohem Gesicht. Rudi Kirchhoff hatte seinen „Quetschsack“ mitgebracht, Hans Obiger und Reinhold Sattler – Bör genannt – Klampfen. Als Eggerath und Steinbrink kamen, traten wir an und gingen auf den Bahnsteig. Um 4.15 Uhr fuhr der Zug ab. –
In Aachen kamen wir um ¼ 8 an. Hans ließ vor dem Bahnhof antreten. Dann marschierten wir zur Jugendherberge Brand, die 8 km von Aachen entfernt ist. Hier langten wir um ungefähr ½ 10 Uhr an. Auf dem ersten Blick sahen wir, daß Brand eine große, prächtige Herberge ist. Wir fühlten uns sofort heimisch. Nach der Begrüßung des Herbergsvaters bekamen wir die Räume angewiesen, wuschen uns und futterten bei Pfefferminz-
tee unsre mitgebrachten Stullen auf. – Nachher setzten wir uns unter die große Linde und sangen. – Es war schon spät, als wir zu Bett gingen. Bald schliefen wir unter dem Rauschen der Inde-Mühle ein. –
3. Die alte Kaiserstadt.
Montag, den 14. Juni.
Um 6 Uhr wurden wir von den melodischen Sirenentönen Eggeraths geweckt. Schnell wurde der Schlaf aus den Augen gewaschen. Dann Bettenbauen und Bettenappell. Nach dem Kaffee traten wir an, marschierten zur Straßenbahnhaltestelle und fuhren nach Aachen. – Hier angekommen, gingen wir zum Rathaus. Ein Professor erklärte uns anhand von Bildern die Entwicklung des Baues bis auf die heutige Zeit. Anfangs war er mit dem Karlsmünster verbunden gewesen. Ein Modell des Rathauses, wie es zu Karls Zeiten aussah,
veranschaulicht dieses deutlich. Wir traten in den großen Saal, wo wir die berühmten Fresken Rethels sahen. In der Kleinodienkammer wurden uns die Reichsinsignien gezeigt, die Kaiserkrone, der Reichsapfel, das Schwert des hl. Mauritius, das Prunkschwert Karls des Großen, ein krummer Säbel des Frankenkönigs (ein Geschenk des Kalifen von Bagdad, Harun al Raschid), Szepter, Abbildungen des kaiserlichen Ornats (Albe, Stola, Krönungsmantel, Handschuhe, Goldsporen etc.), die „Heilige Lanze“, ein Modell des Brunnens vor dem Rathaus, und vieles andre. (Vergl. auch Buch XI, „Wir traben in die Weite“, Eifel-Fahrt 1936, S. 24-26.) –
Als wir das Rathaus verließen, empfing uns der Herr Dombaumeister, ein freundlicher Professor, dem man sein Rang garnicht ansah. Er wollte uns den Dom und den Schatz zeigen. Zuerst gab er uns einen Korb voll Erdbeeren, wo jeder ein heraus nehmen durfte; nachher waren noch für jeden zwei übrig. Bevor er uns den
Dom zeigte, lenkte er unsre Aufmerksamkeit auf eine andere Aachener Sehenswürdigkeit: die Marktweiber auf dem Rathausplatz. Er sagte: „Früher hatten ein paar Marktweiber Krach miteinander gekriegt. Da wurden sie so fuchtig, daß sie sich mit Äpfeln bewarfen, schließlich sogar mit Roßäpfeln. Als eine gerade ihr Maul auftun wollte, um wieder ein Schimpfwort fallen zu lassen, flog so ein saftiger Köttel ihr hinein. Da riefen die andern: „Halt ’n im Mund und geh nach ’m Gericht!“ Und so geschah es dann auch.“ Wir lachten alle. Professor Buchkrämer sagte vorher, wir sollten nah ’ran kommen, ihn zu hören, sonst würden die Marktfrauen noch was hören. Ere hatte wohl Angst davor, was wir wohl verstanden, als wir nachher an den Ständen vorbeigingen. – Wir wandten uns dem Dome zu; der Dombaumeister zeigte ihn erst von außen und machte uns auf die Baustile und Besonderheiten aufmerksam. Dann traten wir hinein. Im Vorraum steht rechts auf einem
Sockel ein Wolf, der ein Loch in der Brust hat und innen hohl ist. Gegenüber stand ein kaktusähnliches Ding. Man erzählt darüber folgende Geschichte. Als der Dom gebaut wurde, bekam man ihn nicht mehr fertig. Da versprach der Teufel seine Hilfe, unter der Bedingung, daß er die Seele dessen bekomme, der zuerst den Dom nach seiner Vollendung betrete. Man willigte ein; doch als das Werk fertig war, wollte keiner hinein. Da schickte man einen Wolf ihm durch die Tür. Der Satan stürzte sich darauf und riß den Leib des Tieres auf, um die Seele zu suchen. Als er sie nicht fand, verließ er wütend die Stadt und eilte zum Meer, um einen großen Sack Sand zu holen, die Stadt Aachen zu verschütten. Als er damit kurz vor Aachen angelangt war, traf er eine alte Frau. Die fragte er, wie weit noch bis Aachen sei. Sie erkannte den Teufel und antwortete, da könnte er noch, wer weiß, wie weit, gehen. Da warf er wütend den Sack hin,
denn er war müde. Seitdem will der Teufel keinen Aachener und keinen, der in Aachen war, mehr in der Hölle haben. – Im Chor des Domes wurden uns eine alte Kanzel, die Gobeline an den Wänden und der Hauptaltar gezeigt. Vom Grabe Ottos III. sagte der Professor, die Franzosen hätten das Grab aufgerissen, und mit einer Harke die Gebeine herausgerissen. Sie hätten allerlei Kostbarkeiten aus dem Dom (z. B. einige Säulen aus dem Oktogon) mit nach Paris genommen und sich wie die Wilden in dem Heiligtum Karls des Großen aufgeführt, den doch auch sie für sich in Anspruch nehmen wollen. Und das taten die Franzosen, die das gebildetste Volk sein wollen und sich stolz „Grande nation“ nennen. Als das Grab vor einigen Jahren geöffnet wurde, fand man darin zwischen den Knochen Centimes-Stücke und eine französische Zeitung; man hat sie dringelassen, damit man sieht, wer die Urheber solcher Greuel waren. – Wir be-
wunderten die hohen gotischen Fenster, die eine Flut von Licht in das Chor einströmen ließen. Sie sind, neben denen im Londoner Westminister, mit ihren 27 m Höhe die größten Fenster Europas. Das Chor ist 32 m hoch. – Der Dombaumeister führte uns jetzt zum Krönungsstuhl im Oktogon hinauf. Hier sind 34 deutsche Könige gekrönt worden. Unter dem Sitz ist ein Loch; wenn der neugekrönte König darauf saß, krochen die Fürsten und Edlen zur Huldigung einer nach dem andern dadurch. Man sah deutlich die Vertiefungen im Boden, wo die Hände immer hingegriffen haben, und am Ende die Stelle, wo die Edlen sich den Kopf gestoßen haben. Eine Reihe von uns setzten sich auf den Stuhl, um die prächtige Durchsicht auf den Altar hinab und in das Mosaik der Kuppel hinauf zu genießen. Unser Führer sagte: „Vor kurzem waren mal junge Leute hier, die davon nichts verstanden, und behaupteten, der Dom sei
zuerst heidnisches Heiligtum gewesen. Das ist nicht wahr. Karl der Große hat ihn als Liebfrauendom gebaut. Der beste Beweis dafür ist, das man vom Krönungsstuhl aus den ganzen Bau übersehen kann, die Gläubigen den Kaiser aber nicht sehen konnten. Bei den heidnischen Tempeln zeigte sich der Kaiser immer dem Volke, wie wir das in Italien und Griechenland noch sehen können. Was wahr ist, muß wahr bleiben!“ – Auf eine Merkwürdigkeit machte uns der Professor noch aufmerksam, nämlich daß an der rechten Seite des Stuhles, der aus einfachen Marmorplatten zusammengesetzt ist, ein Mühlchenspiel eingeritzt ist. Daraus läßt sich schließen, daß die Platten früher zum Bodenbelag einer italienischen Kirche gehörten, bevor der Sitz gebaut wurde. In Italien sieht man ja häufig, wie während der Messe gespielt wird, wie die Meßdiener sich am Altare balgen und man sich nicht scheut, Eisbonbons zu lutschen. –
Der Dombaumeister sagte uns, das Oktogon sei – außer der Kuppel und zwei Säulen – noch in demselben Zustand, wie Karl es gebaut hatte. Es sei noch nichts daran renoviert worden. Die Kuppel sei im Laufe der Jahrhunderte mehreremale abgebrannt und wieder aufgebaut worden. Die Säulen waren einst von den Franzosen geraubt und im Louvre-Museum untergebracht worden. Als die Deutschen die geraubten Säulen, die aus antiker Zeit stammen, 1871 wieder nach Aachen brachten, ließen sie zwei in Paris, die in ein Haus eingebaut waren. Die Säulen wurden im Oktogon wieder in derselben Weise angebracht, wie sie vorher waren. – Nun gingen wir in die Schatzkammer, die den größten Schatz Deutschlands und einer der größten Schätze überhaupt beherbergt. Bevor wir eintraten, sagte der Dombaumeister, wenn die drei Wächter in der Kammer überrumpelt würden oder ein Glasschrank eingeschla-
gen würde, schließe sich die dicke Tür automatisch zu und bei der Polizei würde eine Alarmglocke in Tätigkeit gesetzt. Es sei unmöglich, aus der Kammer etwas zu stehlen. – In dem Gewölbe strotzte alles nur von Gold und Edelstein. Ich kann garnicht alle die Millionenwerte hier aufzählen, die wir dort sahen. Das wertvolle an den Schreinen und Reliquiaren, den Monstranzen und Kelchen, den Gewändern und Kronen ist nicht nur das kostbare Material, sondern vor allem die feine Arbeit, die daran verwendet worden ist. – Zum Schluß führte uns der Professor auf die Galerie um den Westturm hinauf. Wir mußten eine lange Wendeltreppe hinaufsteigen; einer hat die Stufen gezählt, ich glaub’, es waren über 170. Vom Balkon aus konnten wir die ganze Stadt überblicken. Wir sahen bis zum höchsten Punkt Hollands, der nicht weit hinter der Grenze liegt. Die Dächer der Häuser um dem Dom herum
[Fotos]
Der Dom.
(Aufn. Hagenbr.)
Rathausturm
(Aufn. Schemien)
Rathaus, vom Dom aus gesehen.
(Aufn. Hagenbruch)
waren meist flach. Wenn bei den Heiligtumsfahrten, die alle sieben Jahre stattfinden (die nächste einige Wochen nach unsrem Aachen-Besuch), von der Galerie die Heiligtümer gezeigt werden, sind auf diesen Dächern Zelte aufgeschlagen, weil man von hieraus natürlich die Sache am besten sehen kann. – Wir gingen über den Steg, der vom Westturm zum Oktogon hinüberführt, in die Kuppel des Oktogons. Diese ist gegen Einsturz bei Brand durch Stahlkonstruktionen gesichert. – Wir gingen noch mal über die Galerie um das Dach des gotischen Schiffes herum und stiegen dann wieder hinab. Zum Schluß sagte der Dombaumeister, er hoffe, daß wir etwas von der Liebe mitbekommen hätten, die er zu diesem Bauwerk habe. Dann verabschiedete er sich von uns. – (Über den Aachener Dom siehe auch Buch XI, Seite 19-22. „Wir traben in die Weite.“) –
Wir marschierten zur N.S.V. Küche, wo wir eine prächtige Erbsensuppe bekamen. Es war schon
2 Uhr durch; die Dombesichtigung hatte solange gedauert. – Nachmittags war Freizeit. Um ¼ 5 Uhr trafen wir uns wieder am Burtscheider Markt. Wir marschierten zum Ehrenfriedhof und dem Bismarck Turm. Der Friedhof liegt mitten im Wald. Es liegen dort Tausende von gefallenen Russen und Deutschen. Herr Eggerath machte uns auf den Unterschied dieses Friedhofes mit den flandrischen Gräberfeldern. Hier war alles in einzelne Parzellen aufgeteilt, jede hatte eine andere Lage, war anders angeordnet und alles war vom Wald umgeben; dort ein weites Feld mit endlosen Gräberreihen, ein Wald von Kreuzen. Bei dieser Gelegenheit erzählte uns Herr Eggerath, der in Flandern war, daß die Bauern dort jedes Jahr noch beim Pflügen Leichname von Gefallenen fänden. Dort sei jeder Quadratmeter Boden mit Blut getränkt. – Gegen acht Uhr kamen wir wieder in Brand an. Wir aßen zu Abend und setzten uns
dann zu einem Sing- und Erzählkreis zusammen.
4. Noch einmal Aachen, aber – Regen.
Dienstag, den 15. Juni.
Heute morgen machten wir Frühsport. Nach dem Kaffee – nein, nach der Grütze (Es gab Grütze, von der wenig gegessen wurde.) traten wir zu einem Ausmarsch an. Es waren schwere Regenwolken aufgezogen, und die ersten Tropfen fielen. Dennoch zogen wir ab. Wir wollten zum Dreiländereck. Doch soweit kamen wir nicht. Es regnete heftig, und schon nach zwei Kilometern stellten wir uns unter. Als wir nach einer Stunde weitermarschierten, hatten wir alle rote Farbe auf dem Rücken, da die Wand, an die wir uns angelehnt hatten, abfärbte. Es regnete noch fester als vorher. Doch wir zogen weiter. Heinz Hecker hob wieder die gedrückte Stimmung, und als
Eggerath uns sagte, wer den ersten Grenzstein finde, bekomme eine Tafel Schokolade oder einen Schnaps, da waren alle dabei. Die Tafel bekam Horst Rosenbaum, „Fletsch“ genannt. Gegen Mittag setzten wir uns in ein Lokal. Alle tranken zur „Aufwärmung“ Schnaps. Dann wurde gefuttert. Zappel Weise und Minna Korstik spielten am Klavier, Minna die neusten Schlager, Zappel klassische Musik. Als wir weitergingen, nach einer guten Stunde, hatte der Regen nachgelassen. Arm in Arm marschierten wir nach Aachen. Hier suchten wir wieder die N.S.V.-Küche auf, wo wir Frühlingssuppe, Kartoffeln, Spinat, Frikadellen und Sose und zum Schluß noch Preiselbeeren aßen. Nach dem Essen gingen wir ins Couven-Museum, in dem Rokoko-Zimmer zu sehen waren. Nach einem Bummel durch die Stadt – es hatte aufgehört zu regnen – gingen wir zum Elisenbrunnen, dem berühmten Kurbrunnen mit dem „Faule-Eier-Wasser“. Als um 6 Uhr
das Tor zur Quelle geöffnet wurde, gingen wir auch mal hin. Von allen Seiten strömten die Menschen, jung und alt, reich und arm, mit Bechern, Tassen, Flaschen und Eimern, um das warme Wasser zu trinken und auch nach Hause zu nehmen. Wir hatten keine Becher; die Leute boten uns jedesmal ihren Becher an, trotzdem auf einem Schild stand: „Das Verleihen von Trinkgefäßen ist nicht gestattet“. Jeder, der kam, hielt uns seinen Becher entgegen, ob wir auch trinken wollten. – Um 10 vor 7 traten wir am Elisenbrunnen an. Drei fehlten. Diese schloß Herr Eggerath von der Überraschung aus, die er mit uns vorhatte. Jeder von uns mußte 10 % von seinem Taschengeld, was unter 3 M war, 20 % von dem was darüber war, abgeben, damit er uns diese „Überraschung“ machen konnte. Wir wußten allerdings noch nicht, was er vorhatte. – Wir marschierten an der Oper („Musagetae heliconia-
dumque choro“. Schrift über dem Portal.) und der Post vorbei zum Bahnhof „Rothe Erde“. Von hier aus fuhr ein Teil von uns mit der Straßenbahn, ein Teil ging zu Fuß. Steinbrink und Eggerath fuhren ein Stück mit. Dann überlegten sie es sich und stiegen wieder aus, ohne bezahlt zu haben. Als wir vor Brand schon aussteigen und 25 Pfennig für eine so kurze Strecke blechen mußten, spuckten wir vor Zorn. Da wären wir doch lieber ganz zu Fuß gegangen. Jetzt mußten wir noch ein ganzes Stück gehen. – Als alles in Brand war, putzten wir die Schuhe und traten dann zum Stiefelappell an. Dann aßen wir das Abendessen, wuschen uns und nahmen Pillen ein, damit wir uns nicht erkälteten. Dann war Bettruhe. – Nachts rumorte es auf dem Schlafsaal. Ich wurde ein paar Mal wach. Einmal sah ich jemand am Bette stehn. Morgens erzählte man mir, sie wollten mich aus dem Saal tragen. Einige sollten den
„Heiligen Geist“ bekommen. Doch da der „Hl. Geist“ zu viel Krach machte, wurden alle wach. Der nächtliche Spektakel wurde noch dadurch erhöht, daß „Bör“ ziemlich laut träumte. –
5. Lichtenbusch.
Mittwoch, den 16. Juni.
Morgens rappelte wie immer um 6 Uhr der Wecker unter Eggeraths Decke. Doch das „Sirenentuten“ blieb aus und alles pennte weiter. Um 7 Uhr rappelte der Wecker nochmal, doch kein Signal folgte. Erst um ½ 9 standen wir auf. – Nach dem Kaffee tagte der „Volksgerichtshof“. In langen Decken eingehüllt, traten einige von uns auf die Bühne, geführt von „Fletsch“, der einen langen Bart angeklebt hatte, und setzten sich an den Tisch. Zum Schluß kam „Arbeitsdienst“, der Rudi Stricker gefesselt mit sich führte. Der Staatsanwalt „Fletsch“ eröffnete die Sitzung. Dann machte
er den Tatbestand bekannt. Rudi hatte am Morgen beim Waschen „Zeuge Eggerath“ naßgespritzt. Deswegen war er angeklagt. Zeuge Eggerath und Zeuge Hagenbruch wurden aufgerufen, die Reden gingen hin und her und die Verhandlung wurde sehr in die Länge gezogen, so daß der Vorsitzende mehrmals zur Flasche greifen und sich stärken mußte. Schließlich wurde das Urteil gefällt: Angeklagter Stricker wurde zum Tode durch den Strang verurteilt, wegen Mißhandlung etc. und versuchter Flucht aus dem Gerichtssaal. Der Strick war schon vor dem Theater feierlich an der Decke festgemacht worden. Nun wurde der Angeklagte zum Blutgerüst geführt und gefesselt. Willy Lohne wurde mehrmals aufgefordert, als Geistlicher dem Verurteilten die Absolution zu geben. Doch dieser weigerte sich, und beinahe wäre der Deliquent ohne Buße gestorben, wenn er nicht durch einen Tränenausbruch die Henker in letzter Minu-
te gerührt und von ihrem Vorhaben abgebracht hätte. –
Nach dem Mittagessen traten wir an zum Ausmarsch nach Lichtenbusch. Eggerath sagte, welche Kameradschaft zuerst da sein werde, bekomme eine Tafel Schokolade. Nun ging ein Gewaltmarsch los ohnegleichen. Jede Kameradschaft wollte zuerst da sein. Als alle da waren, gingen wir zuerst in die deutsche Schule. Ich sagte „deutsche“, denn in Lichtenbusch gibt es auch noch eine belgische Schule. Das Dorf ist nämlich halb belgisch – halb deutsch. Mitten durch führt eine neutrale Straße; der rechte Straßengraben bildet die belgische, der linke die deutsche Grenze. – In der Schule war nur ein Klassenraum. Dieser sah genau so aus, wie die anderen Schulräume in Deutschland. An der Wand hingen die Bilder Hitlers und Hindenburgs und das Hoheitsabzeichen. Die Rückwand der Klasse kann man hochziehen; man sieht dann in die Kapelle, die mit der Schule unter einem Dach steht.
Sonntags wird die Wand zwischen Klasse und Kapelle hochgezogen, damit alle Platz haben. Die belgischen Kinder des Dorfes gehen, wie gesagt, in die belgische Schule. Hier lernen sie französisch und deutsch. Wie wir erfuhren, ist der Lehrer aus dieser Schule ein Deutscher, der natürlich mehr Gewicht auf den Deutsch-Unterricht als auf den französischen legt. Die Kinder können kaum französisch. Gewöhnlich sind die Beamte in Neubelgien Altbelgier. Wir gingen in ein Geschäft, das auf belgischer Seite lag. Über dem Ladeneingang hing ein Schild: „Hier erlaubter Grenzübertritt mit Visum“. Wir hatten kein Visum, wagten es aber doch hineinzugehn, um uns von dem Inhaber des Ladens etwas über ihr Los in Belgien erzählen zu lassen. Wir hörten hier viel Interessantes. Natürlich haben die Leute in Neu-Belgien den festen Willen, nach Deutschland zurückzukehren, trotzdem sie sich wirtschaftlich in Belgien besser stehn. Der Mann erzählte uns,
er brauche nur Hauszinssteuer zu bezahlen, sonst garkeine Steuern. Deswegen sind in Belgien auch die Zigaretten so billig. Viele kauften sich eine 10 Stück-Packung zu 15 Pfennig. Auch Schokolade, ein Riegel zu 15 Pfennig, gefüllt, kauften viele. Alles war sehr billig. Die Waren aus Deutschland, wie Persil, Ata etc. sind natürlich teurer als bei uns. – Auf unsre Frage, ob sie denn viel von den belgischen Beamten schikaniert würden, antwortete er, das sei nicht der Fall. Wohl in den ersten Jahren nach der Abtrennung hatten sie viel ausstehen müßen. – Jetzt kamen auch Eggerath und Steinbrink, die solange woanders waren, in den Laden. Der Mann sagte, wir könnten alle für 20 Pfennig Kaffee und Brot bekommen. Damit waren wir einverstanden, und wir setzten uns in ein Zimmer. Erst jetzt erfuhren wir von Eggerath, daß jeder nur drei Zigaretten über die Grenze nehmen dürfe. Die nun sich 10 Stück-Packungen
gekauft hatten, gaben den andern, die keine hatten, drei mit, die sie nachher hinter der Grenze wieder zurückbekamen; die anderen Zigaretten, die übrigblieben, wurden mit aller Gewalt aufgeraucht, sodaß mancher sich beinah die Hose vollgemacht hätte. Der belgische Tabak ist ein Zeug, ganz scheußlich, ein schwarzer Knaster. Die Bude war klein, wir saßen mit 30 Mann darin und alle rauchten. Die Fenster konnten wir nicht öffnen, weil uns sonst belgische Grenzbeamte hätten bemerken können. Dann wär „Zacken duster“ gewesen. So war ein Qualm in der Bude, daß einem die Tränen die Backe runterliefen. – Steinbrink fragte uns alle ehrenwörtlich, ob keiner mehr als drei Zigaretten bei sich habe. Dann brachen wir auf, nachdem wir kurz vorher noch Karten nach Hause geschickt hatten. Als wir den Zoll überschritten, wurden die ersten drei bis auf die Haut geprüft; dann konnten wir ’rüber. – Herr Eggerath sagte, er
habe für 5 Uhr Besuch bestellt. Wer das sei, sagte er noch nicht. Es waren schon ½ 6. Wir hatten noch 10 km zu laufen. In einem Gewaltmarsch, bei dem es manchem im Magen rumorte, legten wir die Strecke in einer Stunde zurück.
6. Unsre deutschen Brüder in Neubelgien.
Mit einem zackigen Lied marschierten wir über die Brücke auf den Hof der Herberge ein. Wir traten weg und gingen in das Eupen-Malmedy Zimmer. Dieses ist an den Wänden prächtig mit Städtewappen Neubelgiens bemalt: Eupen, Malmedy, St. Vith, Eynatten, Hansen, Raeren, Herbesthal. – Dr. Pütz von der Aachener Regierung hielt uns einen Vortrag über die Lage der Deutschen in Belgien. „Das Königreich Belgien“, so sagte er, „ist eine Mißgeburt. Es besteht seit 1850, also gerade 100 Jahre. Wie ihr wißt, gibt es nämlich kein Belgischer Volkstamm, sondern Belgien besteht
aus drei Volksgruppen: Die Flamen im Süden und Osten, die Wallonen im Norden und seit 1920 auch noch die Deutschen. Jeder dieser Stämme hat auch seine eigene Sprache; dazu kommt noch Französisch als Amtssprache. Das Flämische ist mit dem Deutschen verwandt, die Wallonen sind völkisch und sprachlich mit den Franzosen verwandt. Ständig leben Flamen und Wallonen im Kampfe gegeneinander. Jede hat auch ihre Partei. Dazu kommen die Rexisten, die eine Zusammenfassung aller Belgier erstreben, was aber auf die Dauer nicht möglich ist. Rex ist garnicht deutschfreundlich eingestellt, wie die deutsche Presse meint, wenn die Partei sich auch so an die Deutschen heranmacht. Viele Deutsche sind uns auf diese Weise schon verloren gegangen, die glaubten, etwas für Deutschland zu tun. – Mit der Neutralität Belgiens,“ so fuhr Dr. Pütz fort, „ist auch nicht viel mit los. Wenn schon die Verhandlungen darüber nur mit Frankreich und Eng-
land geführt wurden ohne Deutschland, das doch als Nachbarstaat ebenso gut mit einbegriffen werden müßte, dann kann von Neutralität keine Rede mehr sein. Belgien ist ganz im Schlepptau Frankreichs und Englands geraten, wie es ja auch vor dem Kriege ein Mittel in Frankreichs Hand war. – Die Deutschen haben natürlich auch ihre Parteien, die „Christliche Volkspartei“, die eine rein katholische ist, und die „Heimattreue Front“. Anfangs war die „Christl. Volkspartei“ die einzig maßgebende für die Deutschen. Anfangs war sie auch deutschfreundlich. Aber später wandte sie sich gegen Deutschland, und heute hetzt sie in maßloser Weise gegen Deutschland und die „Heimattreue Front“. Ich weise nur auf das letzte Hirtenschreiben des Fürstbischofs von Lüttich über die Rede des Dr. Göbbels. Ihre Zeitung „Das Grenzecho“ kennt nichts anderes als diese Hetze. Es ist auch nicht zu verwundern, daß der Schriftleiter dieses Blattes ein emigrierter
Jude ist, der vor 1933 Museumsdirektor in Aachen war. Ein anderer Mitarbeiter wurde zum Lohn für seine Deutschhetze vom Papst mit dem Orden „Bien mérité“ (!) ausgezeichnet. Man kennt diesen Mann in ganz Eupen-Malmedy als „De Spinne“. Die Heimattreuen kämpfen natürlich sehr gegen solche Elemente an. Die Hauptfeinde des Deutschtums in Belgien sind der politische Katholizismus, die „Christliche Volkspartei“ und „Rex“. Der Kampf der Heimattreuen ist natürlich verschieden. Während man in Eupen und Malmedy mit Hakenkreuzpapierschnitzel etc. zu Werke geht, ist man in St. Vith besonnener. Der Patriotismus mit diesen netten Sachen ist aber nicht soviel wert, wie das andere.“ Dr. Pütz schilderte uns einige Einzelheiten über den Kampf der Auslandsdeutschen. Auch von der Volksbefragung 1920 erzählte er uns. „Wer für Deutschland war“, so sagte er,
mußte sich in öffentliche Listen eintragen. Wer das nicht tat, galt als Belgien-Freund. Der Umstand, daß fast nie ein Beamter anwesend war, wenn sich jemand in diese Listen eintragen wollte, und die Drohungen ausgewiesen und von Haus und Hof vertrieben zu werden, bewirkte, daß von 60 000 Wahlberechtigten nur 261 für Deutschland stimmten. Davon waren 240 Beamte, die auch ohnedem ausgewiesen worden wären. Man hätte die Abstimmung ganz boykottieren sollen. Den Hof verlassen konnte die ländliche Bevölkerung nicht.“ Zum Schluß sagte Dr. Pütz: „Und wenn ihr nach Lüttich kommt, so bedenkt, daß ihr Repräsentanten Deutschlands seid. Die Leute sehen auf euch und beurteilen nach eurem Verhalten die Deutsche Nation. – Vor allem zeigt den Eupen-Malmedyern, daß wir an sie denken, daß wir sie nicht vergessen. Stärkt die Leute in ihrem Kampfe, den sie gegen unzählige Feinde zu führen haben. Denn ihr seid
Deutschland!“ – So schloß Dr. Pütz seinen Vortrag über Eupen-Malmedy. Er hatte jetzt allerdings die Überraschung verraten, die Herr Eggerath uns mit der Fahrt nach Lüttich usw. machen wollte. Wir freuten uns natürlich riesig, doch waren wir auch der Verantwortung bewußt, die auf uns lag. Nach dem Abendessen schärfte Eggerath uns noch mal gründlich ein, wie wir uns in Belgien zu verhalten hätten, daß jeder Befehl auf das genaueste durchgeführt werden müsse.
7. Die Himmelsleiter.
Wir trempen!
Donnerstag, den 17. Juni.
Am nächsten Morgen standen wir schon um 5 Uhr auf. Wir packten unsre Affen, machten die Betten fertig und kehrten das Haus aus. Denn wir wollten nach Monschau, unsrem zweiten Standquartier. Nachdem wir Grütze gegessen hatten, marschierten wir los. Wir wa-
ren noch keine 300 m marschiert, da löste sich die Kolonne schon auf. Und wie es dann so geht, vorne eilen in großen Schritten die „Unentwegten“ (wobei ich auch war), in der Mitte die langsameren und am Schluß, ganz hinten, die Schnecken, die sagen: „Kommste heut nicht, kommste morgen.“ Eggerath und Steinbrink waren nicht mehr zu sehn. Man munkelte wieder etwas von „kalte Bierchen saufen“. Heinz Hecker, Ferdi Rosiepe („Arbeitsdienst“), Rudi Kirchhoff, Fritz Badde, sogar der Middelmann und ich, marschierten vorne weg. Wir waren schon hinter Kornelimünster. Wir dachten, wo Eggerath und Steinbrink wohl seien. Willy Lohne, Herbert Weise und Heinz Vedder, die immer am Schluß gingen und sich über die Unsterblichkeit des Maikäfers und die Gegensätze von konvex und konkret, abstrakt und konkav, und über die Unterschiede von relativ und absolut sich stritten, waren schon kilometerweit
hinter uns. Auf einmal fuhren die drei quietschvergnügt und wild gestikulierend an uns vorbei, hinten auf einem Lastwagen sitzend. „Au, wir trempen!“ sagte einer; „Au, wir trempen!“ riefen alle. Und schon saßen alle im Straßengraben und winkten. Immer wieder fuhren welche vom „Nachtrupp“ an uns vorbei. Wir trempen auch! Aber nicht alle. Die „Unentwegten“ marschierten weiter. Jetzt war ich nicht mehr dabei. Mit Karl Heinz Schemien, Fletsch Rosenbaum und Willy Groß standen wir an der Straße und winkten, ließen die andern hinter uns an uns vorbeigehen, damit wir am Schluß kamen. Vorläufig bekamen wir kein Auto, weil die andern hinter uns zuerst mitgenommen wurden. – Vor uns lag die Himmelsleiter endlos lang und schnurgerade. Die Autos, die mit 80 km an uns vorbeirasten, krochen nachher langsam die Straße wieder rauf; jedenfalls schien es so. Und eine Stunde dauerte es, bis die „Unent-
wegten“ hinter dem Horizont waren und wir sie nicht mehr sehen konnten. Eine Viertelstunde lang kam kein Auto; dicke Regenwolken zogen auf; es wurde bedenklich. Doch nachher schien wieder die Sonne. Dafür kam etwas anderes. Hinter uns sahen wir anstatt den Kühler eines sehnlichst erwarteten Autos die Köpfe Eggeraths und Steinbrinks auftauchen. Fluchend kamen sie näher. „Ist doch ’ne verd... Schw...! trempt da die ganze Bande, wenn wir mal nicht dabei sind!“ Fletsch verstrich sich vor Angst in den Busch. Das war sein Pech. Denn höret, was nun folgte! Als Eggerath schnaufend mit Steinbrink bei uns angelangte, sagte er: „Wo sind die andern?“ Das war der Anfang folgenden Wortwechsels. „Trempen!“ antwortete ich, als ob nichts dabei wäre. „So, ist das Kameradschaft, wenn die andern trempen und ihr müßt gehen?“ fragte Steinbrink. „Ja, wir wollen auch trempen. Wir trempen alle. Umsoeher sind wir dann da.“ –
„Das ist doch kein Gemeinschaftsgeist. Der eine bekommt sofort ein Auto, der andere nicht. Einzeln kommt die ganze Bande in Monschau an!“ – „Ja...“ sagte ich und fand keine weiteren Worte. (Mir war es schon klar, daß es jetzt mit dem Trempen aus sei und wir die 20 km gehen müßten.) „Wir wollten in Rötgen Mittagessen. Die andern, die bis Monschau getrempt sind, kriegen natürlich keins!“ – „In Rötgen wollten wir Mittagessen?“ Wir fielen aus allen Himmeln. „Ja, und unterwegs wollte ich euch noch allerlei zeigen! Die andern, die getrempt haben, müßen heute nachmittag mit Affen von Monschau nach Rötgen zum Zollhaus und hier sich eine Bescheinigung holen, daß sie dagewesen sind. Außerdem werde ich noch telefonieren. So holen die die 30 km nach!“ Uns schien das brutal. Doch nach und nach kam doch Schadenfreude in uns auf und wir waren schon gespannt darauf, die belämmerten Gesichter der andern zu sehen. „So, nun
los!“ kommandierte Eggerath. Mit einem Seufzer nahmen wir die Affen wieder auf und tippelten los. Mühsam krochen wir die Himmelsleiter rauf. „Was habt ihr denn euch gedacht, daß wir nicht dawaren?“ – „Och, Sie wären mit dem Zug gefahren!“ – „So, das glaub ich. Nee,“ sagte Eggerath und steckte sich die Pfeife an, „sowas ist doch keine Disziplin mehr.“ Und er hielt uns einen langen Vortrag über Disziplin, Zucht, Ordnung und Kameradschaft. Dann malte er uns aus, wie die andern bestraft würden, und er sagte: „Ihr könnt von Glück reden, daß wir euch geschnappt haben.“ Er riet, wer von den andern bis Monschau gehe: Heinz Hecker, „Arbeitsdienst“, Badde usw. Und er riet recht. –
Die verrückte Grenze.
Rötgen. Eine weitausgestreute Siedlung. Halb deutsch, halb belgisch. Der Bahnhof auf deutschem Gebiet ist belgisch. Wir stehen am Schlagbaum. Drüben
ein Schild: „Royaume Belgique. Belgische Hoheitsrechte.“ Im Zickzack – ganz willkürlich – geht die Grenze weiter. Nach kurzem Aufenthalt setzen wir unsern Weg fort. Ich muß im Auftrage Eggeraths nach Lennartz, einer Wirtschaft an der Himmelsleiter, wo wir zu Mittagessen wollten, anrufen, ob Jungen aus Essen daseien. Sie sollten dableiben und warten, bis wir angekommen wären. Als ich die Nummer gewählt hatte, dauerte es noch eine ganze Weile, bis sich jemand meldete. Warum das, erfuhr ich später. Von unsrer Klasse war keiner da. – Wir tippelten weiter, vor uns die endlose Himmelsleiter. Wir überquerten einen Bahnübergang. Die Bahn war belgisch! Mitten im deutschen Gebiet. Ein paar Kilometer weiter springt aufeinmal die Grenze über die Straße. Die Straße geht durch belgisches Gebiet! Aber die Straße ist deutsch! Die Grenze springt im wahrsten Sinne des Wortes über. An dieser Stelle steht der einzigste Grenzstein der
Welt, der auf seiner Oberseite drei Striche, anstatt zwei – wie sonst -, eingemeißelt hat. Die Striche zeigen die Richtung zum nächsten Grenzstein an. Hier zeigt der dritte Strich, daß auf der anderen Seite der Straße auch noch belgischer Boden ist. Wir gehen auf die andere Seite und sehen, daß hier auch Grenzsteine stehen. Rechts und links belgisches Gebiet, in der Mitte eine deutsche Straße! Aber – am Waldrand steht ein Schild: „Betreten des Waldes verboten!“ – Ich frage Eggerath: „Wie kommt das denn? Ein deutsches Schild auf belgischem Boden?“ – „Ja“, sagt er, „der Boden ist zwar belgisch, aber der Wald ist deutsch!“ Uns bleiben die Mäuler offen stehn. „Wie ist das denn möglich?“ – „Ich will euch mal die Geschichte dieser verrückten Grenzziehung erzählen. Als 1920 Eupen-Malmedy annektiert wurden, kam auch das Wasserwerk von Aachen zu Belgien. Da man im
Kriegsfalle die Stadt so zur Übergabe zwingen könnte, protestierte Deutschland, und das Wasserwerk wurde wieder deutsch. Dafür verloren wir aber dieses Stück an der Himmelsleiter. Die Grenze wurde von einer internationalen Kommission festgelegt. Ein Japaner war auch dabei. Bei der Grenzziehung spielten nur strategische Gründe eine Rolle; deswegen hat man hier alle Höhen fein herausgeschnitten. Die Eisenbahn Malmedy – Monschau – Lammersdorf – Rötgen – Eupen, die zum Teil durch deutsches Gebiet führt, ist belgisch mit den Bahnhöfen. So war der Stadt Monschau jede Verbindung zur Regierungsstadt genommen. Deshalb ließ man die Straße Aachen – Monschau, auf der wir jetzt marschieren, deutsch. Ebenso die Straße von Neufringshaus nach Lammersdorf (Düren). So besteht der Zustand, daß ein Teil des Kreises Monschau und ein Teil des Kreises Aachen deutsche
Enklaven sind, wie der Teil des Distrikts Eupen östlich der Himmelsleiter eine belgische Enklave bildet, die wiederum durch die deutsche Straße Neufringshaus – Lammersdorf geteilt ist. Daß ein Teil des Waldes hier deutsch ist, trotzdem er auf belgischem Boden steht, kommt daher, weil der Wald Privateigentum der Gemeinde Rötgen ist; über das darf nach belgischem Recht der Staat nicht verfügen.“ – Wir waren kräftig weitergeschritten und hatten bereits den Höhepunkt der Himmelsleiter erreicht (550 m). Hier liegt die Wirtschaft (Neufringshaus) Lennartz. Von hier biegt die Straße nach Lammersdorf ab. Von der andren Seite her wird der Zipfel abgeschnitten von einer zweiten Zufahrtsstraße, sodaß hier ein dreieckiges, belgisches Wiesenstück liegt, das von deutschen Straßen umgeben ist. Dieses Grundstück ist nicht groß; ein paar Kühe weiden
darauf. Will der Besitzer die Tiere in den Stall bringen oder Heu in seine Scheune einfahren, muß er die Straße überqueren. Dazu braucht er ein Visum. Lachend schauen wir uns die Wiese an. Eine Wiese, wie jede andere, und doch eine Kuriosität, wie es keine mehr gibt. – Wir wollten in dem Gasthaus zu Mittag essen. Als wir eintreten wollen, fällt mein Blick auf ein Schild über der Tür. „Hier erlaubter Grenzübergang mit gültigem Visum unter Berücksichtigung der Zoll- und Devisenvorschriften.“ Richtig, das Haus steht ja in Belgien! Wir bleiben solange draußen. Eggerath geht alleine ’rein. Dann kommt er wieder raus, geht zu einem Telegraphen-Mast im Straßengraben und öffnet einen Metall-Kasten. Erst jetzt sehen wir, daß dort ein Schild „Telefon“ hängt. „Wollen Sie telefonieren?“ frage ich Eggerath. „Nein; ich darf doch nicht das viele Geld mit über die
[Foto]
Auf der Himmelsleiter.
(Aufn. Schemien.)
Fletsch Rosenbaum und ich suchen vergebens ein Auto anzuhalten. Man besehe sich die Bärte! Nach einer Viertelstunde hielt... kein Auto, sondern... Vergl. Seite 186!
Grenze nehmen, das Geld von der Lagerkasse. Ich schließe es einfach in diesen Kasten ein, der hängt ja noch in Deutschland.“ – „Warum hängt denn das Telefon nicht im Haus?“ – „Weil es Herrn Lennartz nicht erlaubt wurde, ein deutsches Telefon im Haus zu haben. Da stellte er es eben hier auf. Die Telefonleitung des Amtes Monschau geht ja hier die Straße entlang. Die Schelle des Apparates befindet sich natürlich im Hause.“ – Jetzt wurde mir auch klar, warum ich in Rötgen solange warten mußte, bis sich jemand meldete, als ich telefonierte. – Wir traten in die Wirtschaft ein und stärkten uns. Nach dem Essen schenkte uns Eggerath Schokolade. Steinbrink kaufte sich weiße belgische Schokolade, wovon er uns traktierte. Herr Lennartz erzählte uns, daß das Lokal sehr berühmt sei. Manche Schmuggler sei hier schon geschnappt worden. In der Nähe seien viele
Schmugglerbuden. Als 1933 ein Kommunistenhäuptling nach Paris fliehen wollte, hielt er sich eine Weile in diesem Lokal auf, bevor er nach Belgien reinging. Als er telefonieren wollte, mußte er auf die Straße gehen, und er dachte nicht daran, daß er auf deutschem Boden Stand. Die Gestapo aber stand auf der Lauer und schnappte den Kerl. Er wollte nach Paris anrufen, um sich von seinen Spießgesellen Geld schicken zu lassen. – Herr Lennartz erzählte uns auch, welchen Weg der Belgische Briefträger machen muß, ihm die Post zu bringen. Von Eupen fährt er mit der Bahn zur Grenze, überschreitet sie und fährt mit der belgischen Bahn durch deutsches Gebiet nach Rötgen; hier geht er auf der deutschen Straße nach Monschau, die nachher durch belgisches Gebiet geht und übertritt schließlich wieder die Grenze, wenn er in die Wirtschaft hineingeht. – Schließlich tippelten wir weiter. Jetzt gings sanft bergab. Das
Landschaftsbild hatte sich ganz verändert. Rechts von uns erstreckte sich das Hohe Venn. Wohin wir nur sahen, alles war Moorlandschaft, von kleinen Sträuchern und Büschen bewachsen. An den Stellen, wo es besonders feucht war, wuchs Wollgras. Als wir eine Siedlung durchquerten, fiel uns die Bauart der Häuser auf. Nach Westen reichten die Dächer fiel tiefer herunter als auf der andren Seite. Dazu waren die Häuser von hohen Hecken umgeben, die meist höher als die Dächer waren und das Haus gegen die Vennstürme schützen sollen. Diese Stürme reißen zuweilen trotz dieser Maßnahmen Dächer von den Gebäuden herab. – Wir überquerten einen Bahnübergang. Ich fragte Eggerath: „Was ist denn das Stück zwischen den Schranken, deutsch oder belgisch?“ Karlheinz meinte: „Die Schienen mit den Bohlen sind belgisch, die Pflastersteine sind deutsch.“ Eggerath sagte: „ Das ist noch nicht entschie-
den. Wenn auf dieser Stelle ein Unglück oder ein Mord passiert, das würde dicke Akten nach Brüssel und Berlin geben.“ Nicht weit hinter dem Bahnübergang traten (wir) die Straße wieder aus Belgien heraus. –
8. Der Knalleffekt.
Wir näherten uns Monschau. Schadenfroh malten wir uns schon die Gesichter aus, die die andern machen würden, wenn Eggerath ihnen verkündete, daß sie noch dreißig Km gehen „dürften“. – Als wir zur Burg hinaufstiegen und die andern uns bemerkten, kamen sie mit lautem Gelächter und Schreien auf uns zu. „Wat seid ihr doch Idioten!“ In diesen und ähnlichen Tönen gings. Wir ließen uns nichts anmerken. Eggerath ließ antreten. „Wer war zu Fuß von Brand bis hierhin gegangen? Vortreten!“ Wir fünf und die andern „Unentwegten“, die Eggerath schon geraten
hatte, traten vor. „Die andern nehmen ihre Affen und marschieren bis zur Wirtschaft da und da zurück. Ich hatte zuerst vor, euch bis nach Rötgen gehen zu lassen; fragt die andern, die mit mir gegangen waren; es ist so. Von dem dortigen Zollbeamten solltet ihr euch eine Bescheinigung geben lassen, daß ihr dagewesen seid. Da es schon spät ist, habt ihr jetzt nur noch 12 km zu gehen. Aber wehe, wenn es nicht durchgeführt wird, oder wenn ihr wieder trempt! Ich rufe zur Wirtschaft an, ob ihr alle dagewesen seid. Ihr marschiert geschlossen hin mit Affen! Jetzt keine Widerreden! ...“ Die Gesichter...! Einige versuchten zu meckern und schimpfen, es nützte ihnen nichts. Durch den strömenden Regen mußten sie ihren Marsch machen. Inzwischen war es nämlich tüchtig zu gießen angefangen. Die „Unentwegten“, die kein Mittagessen bekommen hatten, bekamen es jetzt nach. –
Nach dem Abendessen, Griesbrei mit Rosinen (keiner
hatte davon etwas gegessen; Bör, der Koch, hatte nach dem Kochbuch gekocht und eine viel größere Menge Reis gebraucht, wie angegeben war, doch genau so viel Zucker!), setzten wir uns zu einem Singkreis zusammen. Dann gab Eggerath uns noch die letzten Anweisungen für den morgigen Tag.
9. Ein Tag in Belgien.
Freitag, den 18. Juni.
Um ½ 6 standen wir auf. Nach dem Frühstück – Kaffee und Leberwurstbrote – fuhren wir mit einem Omnibus ab. Bald waren wir am deutschen Zoll angelangt. Nach längerem Aufenthalt fuhren wir durch. Doch hatten wir die Grenze noch nicht überschritten. Diese liegt einige hundert Meter weiter. Herr Pützinger, der Fahrer des Wagens, erzählte uns, die Zollstationen seien deshalb von der Grenze etwas entfernt, weil man dann noch die Möglichkeit hat, durchgebrochene Schmuggelautos noch eine
Strecke zu verfolgen. Bald waren wir auch am belgischen Zoll angelangt. Hier versperrte keine Schranke den Weg, sondern sogenannte „spanische Reiter“. Darüber kann ein Auto niemals hinwegfahren, doch einen Schlagbaum vermag es zu durchbrechen. Ein junger Flame, dem die oliv-graue Uniform der Zollbeamten gut stand, öffnete den Wagen und sah hinein. Als er die Papiere des Fahrers gesehen hatte, konnten wir passieren. Nun gings in schneller Fahrt auf Eupen zu. Hier hielten wir und schlenderten ein wenig durch den Ort. Auch in die Kirche gingen wir hinein. Was uns auffiel, waren die Ladenschilder und Plakate, die alle in Deutscher und Französischer Sprache gehalten waren. Über die Uniformen der Polizei- und Straßenbahnbeamten waren wir sehr belustigt. Jeder einfache Straßenbahnschaffner oder Briefträger hatte eine Uniform wie ein General. –
Schließlich fuhren wir weiter. Kurz hinter Eupen, an der ehemaligen Grenze, standen belgische
Militärposten an der Straße mit Stahlhelm und Bajonett. Hier war ein Sprengloch. Im Kriegsfalle braucht man nur auf einen Knopf zu drücken, und die ganze Straße fliegt in die Luft. So könnte der Vormarsch der Feine lang aufgehalten werden. – Jetzt fuhren wir auf der deutschen Einfallstraße, wo 1914 unsre Regimenter siegreich vordrangen. Wir sahen das Denkmal des ersten belgischen gefallenen Soldaten, der auch der erste Gefallene des Krieges ist. Neben der Reiterstatue wehte die belgische Trikolore: schwarz-rot-gold. Wir kamen an vielen Franktireurdenkmälern vorbei. Hier lagen die Leute, die den deutschen Vormarsch aufgehalten hatten, in dem sie aus den Fenstern auf die deutschen Truppen geschossen hatten, und die dann sofort erschossen wurden. Alle Spuren des Vormarsches erlebten wir vor unsrem Geiste noch einmal. –
Jetzt hatten wir eine prächtige Aussicht. Rechts von uns dehnte sich weit das belgische Land
hin. Ein wundervoller Anblick! Links stieg der dunkle Rücken des Hohen Venns auf. In der Ferne vor uns bemerkten wir einen großen hellen Fleck, inmitten der grünen Landschaft. „Das ist das stärkste Fort der Welt, die Batisse vor Lüttich.“ sagte unser Fahrer. „Dessen Kanonen können bis Köln schiessen.“ Die Straße führte nahe dran vorbei. Wir sahen einen Sandhügel, aus dem die Panzertürme hervorlugten, von einem Drahtverhau umgeben. Hoch oben stand, wie eine Silhouette, der belgische Posten. – Ein Soldat, der über die Straße ging, grüßte uns mit „Heil Hitler!“. Ein Deutscher. – Jetzt fuhren wir in Lüttich ein. Ein Trupp Militär kam uns entgegen. – Wir hielten und betraten den Friedhof. Welch ein ganz andrer Ge[sch]mack als der Deutsche hat der Belgier! Bei uns schmückt man die Gräber mit Blumen, hier lagen große, mächtige Steinblöcke auf den Gräbern, Girlanden und Blumen, Herzen mit Aufschriften usw. – alles mit Stein. Auf den meisten Gräbern waren die Bilder
der Toten angebracht in Stein oder Emaille oder Fotos. Manchmal war eine ganze Ahnengalerie beisammen. Wir gingen auch auf den deutschen Ehrenfriedhof, der nach internationalem Recht Deutsches Hoheitsgebiet ist, und auf den Friedhof der Interallierten, auf dem Belgier, Italiener, Russen, Serben und Franzosen liegen. Wir verließen wieder den Friedhof und machten eine Rundfahrt durch die Stadt an der Maas. Herr Pützinger zeigte uns die Kathedrale, das Chalemagne Denkmal, das Denkmal des Erfinders des Gramms, die deutsche Botschaft, die berühmte Zitadelle mit ihren 500 Stufen usw. Dem Verkehr gibt die schienenlose Straßenbahn, Trolleybus genannt, eine besondere Note. Sie sehen ähnlich aus wie Omnibusse, sind aber mit der elektrischen Leitung verbunden. Sie können nach jeder Seite 2 m ausweichen und durchfahren mit großer Geschwindigkeit die Straßen Lüttichs. Als wir durch eine berühmte Geschäftsstraße fuhren, war aufeinmal der Weg
durch zwei auf beiden Seiten parkende Autos versperrt. Trotz lautem Gehupe und Geschimpfe unsres Fahrers und der vielen Wagen, die sich hinter uns angestaut hatten, kam keiner und fuhr den Wagen fort. Es dauerte wohl 10 Minuten, als endlich der Besitzer des einen Wagens kam und ihn ein Stück vorfuhr, damit der Weg frei wurde. Herr Pützinger rief ihm aus dem Fenster auf Deutsch zu: „Sie ha’m ’ne weiche Birne!“ – Wir gingen in ein Warenhaus. Dann aßen wir zu Mittag. Jeder mußte sich selbst versorgen. Wir hatten alle 10 Franken von Eggerath bekommen, in deutschem Geld 80 Pfennig. Die meisten aßen in einem Restaurant „pommes frites“ und tranken Bier, alles für 2 fr. Die Preise waren sehr billig. – Gegen 1 Uhr trafen wir wieder zusammen und fuhren weiter. An einer Hauswand war mit Kalk angeschrieben: „Aider l’éspagne!“ Auch sahen wir oft „Rex“ angeschrieben. Hinter Lüttich stiegen wir wieder aus und besichtigten das von den Deut-
schen 1914 zerschossene Fort Loncin. Der Belgier, der uns führte, war selbst in dem Fort gewesen, als es zerstört wurde und über 300 Soldaten den Tod fanden. Er sprach kein Deutsch und wir mußten unser Schulfranzösisch zusammenraffen, um den Herrn zu verstehn. Doch wir bekamen alles mit. Mächtige Betonstücke lagen umher, ganze Unterstände waren aufgerissen, Panzertürme lagen auf dem Kopf, alles war zerstört. In einem Panzerturm war eine Krupp’sche Kanone. Nachher gingen wir in die Gänge des Forts in dem die geborgenen Leichen der Soldaten beigesetzt worden waren. Ein Grab war noch frei. In diesem will der ehem. Kommandant des Forts, der jetzt noch lebende General Leman, beigesetzt werden. So hält der von deutschen Eltern geborene General (Lehmann) seinen Soldaten über den Tod hinaus die Treue. Wir standen vor der Tafel, auf dem die Lebenden und Toten eingemeißelt waren, die bei der Beschießung des Forts verteidigt hatten. Auch unser Führer stand darauf. – Tief erschüttert verließen wir die
[Foto]
Ein Teil der Klasse vor dem Charle-Magne-Denkmal in Lüttich.
V.l.n.r.: J. Belke, W. Middelmann, H. Weise, R. Mintrop, (verdeckt:) W. Groß, R. Sattler, R. Kirchhoff, Th. Paganetty, L. Schempershofe, H. Hecker, ego, F. Rosiepe (Arbeitsdienst), R. Stricker, K. H. Schemien, F. Badde.
(Aufn. Hagenbruch.)
Stätte des Todes. So hatten deutsche Kanonen gesprochen! – Wir fuhren weiter. In Chaudfontaine machten wir Halt. Wir tranken im „Kursaal“ Kaffee. Dann gingen wir ins Kasino. Luxuriöse Pracht strahlte uns entgegen. Schwere Kronleuchter hingen von der Decke; dicke Teppiche lagen auf dem Boden. Im Spielsaal standen befrackte Menschen um den Roulet-Tisch und ließen den Kreisel laufen. Berauscht von Duft und Schönheit traten wir wieder ins Freie. Wir setzten unsre Fahrt fort. Es ging über Theux nach Spa. Hier war im Kriege das deutsche Generalstabsquartier. Wir sahen den Bahnhof, wo der Kaiser den Zug nach Holland genommen hatte, die Tür, wo er das letzte Mal heraustrat und den Unterstand, worin sich der Kaiser bei Fliegerangriffen aufhielt. Ein paar Säbel und Stahlhelme standen in der Ecke und an der Wand hing eine Fotografie des Generalstabs. Darunter stand: „Aus großer Zeit.“ – Wir schrieben vom Hotel Britannique
aus Karten nach Hause. Dann gings weiter nach Malmedy. Hier hielten wir kurze Rast; dann gingen wir zur alten Abtei und zum Kriegerdenkmal. Ein wuchtiges Kreuz, an dem ein Christus hängt mit eingeknickten Knien und muskulösen Armen, als müsse er im nächsten Augenblick emporschnellen und sich losreißen vom Kreuz. Symbolisch kommt in diesem aus Stein gehauenen Mal der Volkswille zum Ausdruck: „Zurück zum Reich!“ Wir gehen in einen Bäckerladen, kaufen etwas und unterhalten uns mit der Frau. Die Behörden seien nicht mehr so scharf gegen die Deutschen wie anfangs. Die Kinder lernten in der Schule Französisch, Wallonisch und Deutsch. Deutsch haben sie nur eine Stunde in der Woche. In der Schule sprechen sie Französisch, auf der Straße Wallonisch und zu Hause Deutsch. Ganz von selbst sagte uns die Frau: „Wir glauben fest, daß wir bald
nach Deutschland kommen. Als die Saar wieder deutsch wurde, dachten wir schon, wir würden nun auch an die Reihe kommen, doch es geschah nichts. Jetzt richtet alles die Augen auf Spanien, und so müssen wir uns gedulden, bis die Kämpfe dort abgeflaut und die Zeiten ruhiger geworden sind. Dann werden wir wohl auch drankommen.“ Trotzdem sich die Eupen Malmedier in Belgien wirtschaftlich besser stehn, haben sie doch alle den Willen und die Hoffnung, daß sie bald nach Deutschland zurückkehren. – Weiter geht die Fahrt. Wir singen, was das Zeug hält; die Sonne lacht vom Himmel. Die Leute am Wege grüßen mit „Heil Hitler!“ In St. Vith halten wir. Das Kriegerehrenmal mit dem hl. Sebastian, macht denselben Eindruck, wie das Kreuz in Malmedy. In diesem gefesselten Mann steckt der Wille: Los! – Wir kaufen ein und essen zu Abend. Dann sitzen wir noch lange mit den Führern der Heimattreuen Front zusammen. Sie erzählen von ihrem Kampf, von ihren Nöten und Erfolgen. Wir hören, daß die deutsche Jugend in Turnvereinen zusammengeschlossen ist. Wir hören von dem Hirtenschreiben des Lütticher Bischofs und von
der Geistlichkeit. Sie hätten dort den Abschaum des Klerus. Alle Geistlichen, die von Deutschland ausgewiesen sind, sitzen hier. Doch es gäben auch feine Herren, wie der alte, schon vor dem Krieg hier ansässige Dechant, der sich für sein Deutschtum an die Wand stellen ließe, wie uns der eine Herr erzählt. Wir hören auch von der „Spinne“, von den Beamten und den Zeitungen. – Lange sitzen wir beisammen. Als wir endlich spät in der Nacht aufbrechen, verabschieden wir uns herzlich: „Auf Wiedersehn im Reich!“
Singend fuhren wir durch das Dunkel der Nacht der Heimat zu...“ (Fritz Schlanstein.)
10. Monschau.
Samstag, den 19. Juni.
Um ¼ vor 8 standen wir erst auf. Nach dem Kaffeetrinken marschierten wir zum Heimatdichter Dr. Ludwig Mathar. Er ging mit uns auf die Höhe
hinauf und erzählte uns von Land und Leuten, aus seiner Jugendzeit und von der Geschichte Monschaus. Vom Berge aus sahen wir das feine Städtchen mit seinen Schieferdächern vor uns liegen. Hier war einst große Färbereiindustrie. Davon erzählte uns Lud. Mathar in humorvoller Weise. Auch von der Geschichte der Burg, worin sich die Jugendherberge befindet, erzählte er uns. Nach dem Interview gingen wir durch Monschau spazieren und bewunderten die schönen Winkel und Gäßchen an der Rur. – Nach dem Mittagessen (Erbsewurst) bekamen wir noch Besuch. Dr. Pütz war noch einmal gekommen. Wir bekamen alle Gebäck zur Feier des Besuches. Nachher gingen wir nochmal in ein Lokal und tranken Kaffee oder Kakau und futterten Gebäck. Dann brachte uns Herr Pützinger mit seinem Autobus über die Himmelsleiter nach Aachen. Bei Lennartz hielten wir nochmal. In Aachen bekamen wir vor der Abfahrt noch „Futteragen“ verteilt. – Froh, voll
Erlebnissen des Grenzlandes, kehrten wir in die Heimat zurück. –
Schlußwort.
Das war unsre Grenzlandfahrt. Viel hatten wir gesehn und erlebt, sehr viel. Das war ein Erlebnis für’s Leben. Doch nicht nur zum Vergnügen war die Fahrt, sondern um unsre Brüder im Ausland kennenzulernen und sie in ihrem Kampf zu stärken, ihnen neuen Mut zu geben. Wir vergessen unsre Brüder jenseits der Grenze nicht! –
4 Wochen nach Antritt unsrer Fahrt verkündete uns Dr. Steinbrink, daß wir Bescheid von Koblenz erhalten hätten, die Fahrt könnte nicht stattfinden, weil sie ins Ausland ging. Wie haben wir gelacht...!