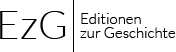Gisbert Kranz: "Gedanken über Zeit und Menschen" (1940-1944)
Gedanken über Zeit und Menchen.
1940
Torheiten und Irrtümer eines Neunzehnjährigen.
Weisheit und Güte Gottes.
15. April.
Wieder in Bonn. Wie lange noch? Sicher ist heute nur noch die Unsicherheit.
24. April.
Ein kleines Begebnis, das unsereins nicht selten erlebt: Während wir heute, an unserm freien Nachmittag, durch Godesberg spazieren, läßt einer von den Soldaten, die uns dauernd begegnen, im Vorbeigehn die Bemerkung fallen, laut genug, daß wir es hören können: „Die – damit waren wir gemeint – werden sie auch noch holen.“ –
[Gestrichen]
25. April.
Heute zu Besuch bei D. in Siegburg. Es waren noch einige andere Herren zugegen. Die Nöte der Zeit lasten schwer auf allen, nicht die materiellen, sondern die geistigen und religiösen. D. meinte: „Die erste und die letzte Bitte des Vaterunsers wollen wir heutzutage besonders kräftig beten.“
28. April.
Herr! Komme Dein Reich! Das Reich der Wahrheit, der Liebe, der Freiheit und des Friedens!
30. April.
Wieder sind einige eingezogen. A. ist auch dabei. Es war mir zunächst unfaßbar. Seit einem Jahr kannten wir uns. Im Arbeitsdienst Freud und Leid geteilt. Im Oktober zogen wir beide nach Paderborn, unser Studium aufzunehmen. Während der froh-ernsten Studienzeit in Pader-
born und Bonn habe ich ihn immer mehr schätzen gelernt. War mir an ihm so sympatisch war: Seine natürliche Anmut des Körpers und der Seele, seine frohe, ruhige Art, sein ganzes feinfühliges Wesen, sein musikalisches Empfinden. Er hatte etwas Mädchenhaftes an sich, doch es war nicht das, was andere Jungen schleimig und zwittrig, unentschlossen und halb und deshalb unausstehlich macht. Es war seine feine, liebe Art, mit der er verständnisvoll auf alles einging, wie man sie sonst nur bei Frauen findet. Zielstrebiges Wollen und kluge Vorsicht waren in ihm glücklich vereint.
Heute nachmittag war er noch einmal da. Von Wehmut und kopfhängerischer Unzufriedenheit war bei ihm nicht die Spur. Er schien lustiger als sonst, doch glaube ich, seine Heiterkeit war anderes als Galgenhumor. – Um 6 Uhr brachten wir ihn zum Gestellungsort. – Abends, die Komplet war schon vorbei,
erschien er zum letztenmal auf meinem Zimmer; er hatte noch ein paar Stunden Urlaub bekommen. Ich teilte mit ihm die letzten Zigaretten, die ich hatte. Was wir in den wenigen Minuten sprachen, war ohne Belang. Was wir dachten, wußten wir gegenseitig.
1. Mai
Ich fuhr mit dem Rad die Ahr hinauf. Auf meinen Fahrten sah ich viele Täler, vor zwei Jahren das Ötztal, das als das schönste der Alpen gilt, doch keins gefiel mir so wie dieses herrliche Tal: Die Ahr hat alle übertroffen.
4. Mai.
Eben traf ich auf der Straße R. Der alte Herr war früher auf dem Pennat mein Direktor. Ein alter, kerniger Preuße. Sonntag für Sonntag ging er uns Schülern voran an die Kommunionbank. Nach dem Umsturz 33 machte man ihm
das Leben schwer. Es ging bei ihm nicht so, wie bei andern Lehrern und Beamten, die nicht schnell genug den Anschluß finden konnten. Bei einer Heldengedenkfeier in der Schulaula erwähnte er den Heldentod eines Soldaten, der in seiner unmittelbaren Nähe fiel. Und – vor der ganzen Schülerschaft – fügte er hinzu: „Und dieser Soldat war ein Jude!“ Diese Begebenheit war für uns Quartaner damals, wie für die ganze Schule, Sensation. Protestkundgebungen, in unflätigster Weise von den Schülern auf dem Schulhof inszeniert, wurden von gewissen Studienräten durch stillschweigende Duldung geschürt, ja es kam sogar soweit, daß eines Tages, als der Unterricht beendet war und die Jungen aus dem Gelände strömten, vor dem Portal eine Abteilung SA. aufzog, sich im Karree aufstellte und durch dieses ungewohnte Verhalten die Neugier der Schüler auf sich zog, die sich dann rundherum herandrängten. Der Führer
der Abteilung hielt eine Schmährede auf den Direktor, die auf die urteilslosen Schüler geradezu verhetzend wirkte. Gekrönt wurde diese Rüpelei durch das Absingen des Horst Wessel-Liedes, bei dem die Jungen begeistert mitschrieen. Ich muß zu meiner Scham gestehen, daß ich damals selbst dabei war. – Wenige Tag darauf wurde der Direx „abgesägt“ und verschwand für immer. – Eben traf ich ihn also auf der Straße; seit sieben Jahren hatte ich ihn nicht mehr gesehn. Steele hat er gemieden wie die Pest, aus Furcht und Ressentiment. Jetzt erzählt er mir, er sei auf Drängen seiner Frau hin doch endlich einmal nach Steele gefahren u. habe auch das Gymnasium besucht.
8. Mai
Gestern abend hatten wir alle ein entsetzliches Erlebnis. Die Komplet war vorbei: Ich bin gerade im Begriffe, einen Brief zu schreiben, da dringt ein durch-
schütterndes Geschrei aus der Ferne an mein Ohr, ein monotones, gleichmäßig wiederkehrendes, aber unheimlich lautes Rufen. Im ersten Augenblick glaube ich, es sei eine Menge auf der Straße, die aus irgendeinem Grunde Heilrufe ausstößt, werde aber gleich darauf eines besseren belehrt, als aus allen Türen des Flures meine Kommilitonen herausstürzen und in den Gang des anstoßenden Flügels, unter uns „Sibirien“ genannt, eilen und ich ebenfalls hinlaufe, denn von dort kamen die Schreie, die von M. waren, einem achten Semester: Der Arme ist plötzlich wahnsinnig geworden. – Ich gehe gleich zu Bett, die Lust zum Briefschreiben ist mir vergangen. Doch zum Schlaf komme ich bis Mitternacht nicht, da das Schreien des Wahnsinnigen immer wieder durchs Haus schallt, zuweilen von unheimlichem Gepolter begleitet. – Heute morgen erfahre ich Einzelheiten. Gestern abend – es waren noch einige in der Kapelle – ging M. in die Sakristei und bittet den Küster um
eine geweihte Kerze. Trotz des dabei zur Schau getragen merkwürdigen Benehmens und des überhaupt sonderbaren Wunsches merkte der Küster nichts und gibt ihm eine Kerze, die M. sich anzünden ließ. Mit dem Licht zog er durch die ganze Kirche und machte, vor dem Altar angekommen, hier gymnastische Übungen. Dann ging er mit der Kerze auf sein Zimmer, wo er kurz darauf den Anfall bekam. Der herbeigerufene Arzt gab ihm zwei Morphiumspritzen und konnte ihn erst dann in die Irrenanstalt bringen. Es ist entsetzlich! Nach dem Urteil des Arztes soll die Sache bald wieder behoben sein; hoffen wir das beste.
9. Mai.
Es gibt Menschen, die, indem sie bestrebt sind, den Eindruck eines selbstlosen u. bescheidenen Charakters zu erwecken und, um nur ja nicht als eitel zu gelten, sich möglichst salopp geben, nichts weniger als eitel
sind, denn sie suchen die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu lenken u. in dieser aparten Saloppheit zu gefallen.
10. Mai.
Soeben beim Frühstück die Nachricht, deutsche Truppen seien in Holland u. Belgien einmarschiert. Gott, wie wird das enden?
11. Mai (Steele)
Was die Leute nicht alles erzählen! Zur Bekräftigung fügen sie dann hinzu: „Mein Schwager ist auf dem Bezirkskommando“, - er ist nämlich Oberschütze und hat die Post abzustempeln! – „der hat’s gesagt“. Oder: „Der Vetter meines Freundes, von dem ich das weiß, ist in führender Stellung an dem und dem Flugplatz beschäftigt“, - er ist nämlich Monteur. – Wie eitel die Menschen sind!
12. Mai, Pfingsten 1940.
Die letzten beiden Nächte kamen feindl. Flieger über Essen und warfen Bomben.
13. Mai.
Die letzten Worte, mit denen Wagners „Meistersinger“ endigt, gelten heute mehr denn je:
Zerging’ in Dunst das
Heil’ge Röm’sche Reich,
uns bliebe gleich
die heil’ge deutsche Kunst!
...wenn wir statt des Römischen das heutige dritte Deutsche Reich setzen.
[Gestrichen]
Zülpich, den 20. Mai.
Von Zeit zu Zeit bemächtigt sich meiner ein namenloser Drang, eine Sehnsucht in die Ferne befällt mich, und wenn für mich die Ferne greifbare Nähe geworden ist, ahne ich wieder neue Fernen. – Ob ich noch mal nach Italien komme?
Ebenso stark ist mein Drang, die Orte, die Zeugen der schönsten Erlebnisse meiner Kindheit und Reifejahre sind, wiederaufzusuchen. Diese Orte voll lieber Erinnerungen ziehen mich jedesmal unwiderstehlich an, sobald ich in ihre Nähe komme: Rheindahlen, Rheine, Neuharlingersiel, Wangerooge, Gehrden, Zülpich. Dann gehe ich in Gedanken versunken durch ihre alten Bauten und Kirchen, durch ihre Straßen und Gassen, und sie sind nicht erhaben und groß, aber sie enttäuschen mich nicht, wenn ich sie nach Jahren wiedersehe, während
derer ich weit herrlichere Baukunst und mächtigere Städte sah, denn sie sind mir ans Herz gewachsen durch die Erinnerung, die aus jedem Winkel zu mir spricht.
Brief an einen Frontsoldaten.
Bonn, den 21.V.1940.
Lieber ...
Da sitze ich nun im friedlichen Bonn und will Dir schreiben, und es fällt mir schwer, Worte zu finden für einen, der mitten im Krieg steht. Was sollte ich Dir auch sagen? Nachdem der Sturm der Ereignisse unsere geplante Zusammenkunft in den Ferien zunichte gemacht hat, werden alle Dinge, die für uns vorher Wichtigkeit hatten, klein und nichtig vor den großen Dingen, die wir nun erleben, die Du selbst mitmachen kannst, von deren schicksalentscheidender Bedeutung wir wissen.
Ich weiß nicht, welche Gedanken Dich in diesen Tagen bewegen, doch hoffe ich, es sind mutige und gläubige. Mögen die Schrecken und das Grauen des Krieges Dir dazu dienen, Dich Gott näher zu bringen. Dein Gleichmut und Deine Gelassenheit seien unerschütterlich! Die Gelassenheit des Christen wurzelt tiefer, als die ........... des Griechen: nämlich in dem festen Glauben an Gottes Vatergüte, der seine Kinder nicht verläßt, und in dem Wissen um die Geborgenheit in des Allmächtigen Hand. „Nichts soll Dich ängstigen, nichts Dich erschrecken. Alles vergeht, Gott bleibt derselbe. Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem kann nicht fehlen. Gott allein genügt.“ (Theresia v. Avila).
„Sobald das Leben anfängt eine Last zu werden, ist es kein Heroismus mehr, die-
selbe abzuwerfen. Heroismus ist, dieselbe noch länger fortzutragen. Je drückender der Druck, desto mutiger der Mut, der ihn aushalten kann.“ Michael Sailer.
Wenn feindliche Flieger uns nächtlichen Besuch abstatten und die Sirenen uns aus den Betten in die Keller jagen, dann denken wir daran, daß Ihr an der Front es tausendmal schwerer habt. Unsere Gebete sind stets bei Euch.
Gott möge unsern Waffen den Sieg verleihen. Deutschland darf nicht zugrunde gehen. Was nachher kommt, belassen wir seiner Vorsehung.
Immer Dein
GK
23. Mai. Fronleichnam.
Der Herrgott muß vor den Fliegerbomben von der Straße flüchten...
26. Mai
Einige behaupten heute: Der Christ muß mit dem deutschen Regime auch den Krieg ablehnen, den dieses Regime führt. Denn da das Regime antichristlich sei, sei auch der Krieg ein Kampf um den Sieg des Antichrist. „Was kommt nachher?“ Hitler-Stalin. Rosenberg, Himmler, Heß. Vogelsang, Crossinsee usw. – Ich bin anderer Meinung. Tertullian, Apologetikum 31: „Wenn das Reich erschüttert wird, so werden mit der Erschütterung seiner übrigen Glieder natürlicherweise auch wir, obwohl wir uns von der Menge fernhalten, an irgendeinem Flecke vom Unglück getroffen.“ Ferner: Röm. 13.
Ferner: Die Haltung der altchristl. Martyrersoldaten.
Wenn Deutschland siegt, nahen für die Kirche schwere Zeiten. Aber wenn Deutschland nicht siegt? Ist es dann anders?
Vorbedingung für eine gute Stellung der deutschen Kirche ist die Einheit und Fertigkeit des Bodens auf dem sie steht: Deutschland. Gratia non destruit naturam, sed perficit eam... Die gesunde Stellung einer Nation u. der Nationen untereinander ist natürliche Vorbedingung, auf die die Gnade das Reich Gottes baut. Die Kirchengeschichte kann uns das lehren. (Kirche nach 1648, nach 1919!)
29. Mai.
Für dieses Sommertrimester habe ich mir vorgenommen, außer den Kollegs und Seminaren noch folgende Dinge besonders u. eingehend zu studieren:
1. Russische Literatur (Dostojewski, Tolstoi, Puschkin).
2. Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn.
3. Kirchengeschichte des Mittelalters.
4. Kunst des Mittelalters.
5. Frühchristl. Apologeten.
6. Die paulinischen Briefe.
7. Carossa, Le Fort, Nietzsche, Stefan George.
Das ist viel. Ich habe noch 9 Wochen Zeit. Das ist wenig. Nur durch äußerste Konzentration komme ich zum Ziel. Wer weiß, wie lange ich noch studieren darf?
31. Mai.
Laut gedacht habe ich, als mir gestern jemand einzureden versuchte, ich arbeite zuviel, ließe mich durch keinen auf meinem Bau stören, würfe jeden hinaus und erregte durch meine „Arbeitswut“ Spott u. Ärger meiner Kommilitonen. Ich habe dem guten Mann geantwortet (wir sprachen übrigens unter vier Augen), daß es rührend von ihm sei, so um die richtige Verteilung meiner Arbeits- und Freizeit besorgt zu sein, daß es mir im übrigen völlig gleichgültig sei, was andere über meine Art zu arbeiten zu denken geruhn, und daß er sich über das Quantum meiner „Arbeit“ sehr irrige Meinungen mache. Ich bewies ihm dann sehr schnell, daß ich zwar regelmäßig, aber verhältnismäßig wenig arbeite; der Ausdruck „Arbeitsfanatiker“ sei völlig fehl am Platze, da weder von Fanatismus noch von „Arbeit“
die Rede sein kann. Ich fasse das Studium eben nicht als „Arbeit“ auf, die man nur aus Pflichtbewußtsein tut, weil man muß, sondern als eine Sache, die ich mit Freude und Begeisterung betreibe. Zwar hätte ich mir ein Ziel gesteckt, doch ohne Rücksicht auf Prüfungen usw. Ich beschäftigte mich eingehender nur mit Dingen, die für mich besonderes Interesse haben. Außerdem sei unser erstes Ziel (ich sagte nicht „Pflicht“!), uns in die Wissenschaft zu vertiefen. Das Vergnügen kommt erst in zweiter Linie, soll aber ebensogut zu seinem Recht kommen. Weder Diogenes noch Epikur.
1. Juni.
Noch einmal: „Ich lerne nicht etwas, weil das in der Prüfung verlangt wird (meist ist das bei dem Stoff, den ich bearbeite, garnicht der
Fall), sondern weil ich Freude daran habe, weil mir dieses Thema besonders reizvoll u. wichtig erscheint. – Ferner: Ich habe mir einen Beruf erwählt, der von seinen Trägern viel verlangt. Ich lerne nicht, um Introitus, Presbyterial- u. Pfarrexamen noch eben knapp bestehen zu können, sondern weiß ich weiß, wie nötig dem Priester gerade heutzutage im Kampf der Weltanschauungen eine gründliche Fachausbildung und eine universale weithorizontige Allgemeinbildung ist. Ich will mehr als Durchschnitt, ich will Leistung. Es kommt mir nicht auf gute Zensuren an, ich weiß ohne diese, was ich weiß, ich weiß (trotz einer schlechten Note), was ich weiß, und ich weiß (trotz einer guten Note), was ich nicht weiß.
1. Juni
A. schrieb mir neulich:
„Jawohl, ich habe meinen Frohsinn behalten und werde ihn wohl kaum verlieren. Ich lasse mich eben durch garnichts unterkriegen...
So eine unerschütterliche Gelassenheit, über die Du so sein schriebst, habe ich mir zu eigen gemacht. Wenn da so einer vor der Front schreit, dann führt mein Körper irgendwelche Bewegungen aus, aber meinen Geist bekümmert das wenig; er wird erst am Feierabend wach; nicht daß ich unbewußt lebte den Tag über, man macht sich schon seine Gedanken über alles, Dienst, Führer usw...
Aber was kann uns Christen erschüttern!“
4. Juni.
Der arme M., der vor vier Wochen verrückt geworden ist, hat nun nach seiner Genesung wieder einen Rückfall gehabt. Sonderbar ist der Fall vor allem dadurch, daß M. vor seinen theologischen Studien Psychologie (!) studiert und in diesem Fache sogar eine Doktordissertation geschrieben hat.
[Gestrichen]
6. Juni.
In der überfüllten Straßenbahn: Einige Frauen kommen herein. Alle Plätze sind besetzt. Ein alter Mann sagt, sich entschuldigend: „Ich bin 90 Jahre alt u. kann Damen keinen Platz mehr machen.“ Daneben sitzt ein junger Mann
von etwa 25 Jahren; der blieb schön warm sitzen.
7. Juni.
Gestern besuchte ich E. in Kirchheim. –
Der Hauptmann, den er wochenlang in Quartier hatte und den ich bei meinem ersten Besuch in Kirchheim kennenlernte – ein prächtiger blonder Fale aus Münster, ein noch junger Offizier – ist am 10. Mai mitgezogen, hat bereits die ganze Flandernschlacht mitgemacht und sich das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz verdient. –
E. hatte einige Wochen mit einer schweren Grippe liegen müssen und ist knapp an einer Lungenentzündung vorbeigekommen. Jetzt ist er wieder auf und tut Dienst. – Nachdem er mir die Kirche gezeigt hatte und mit mir den Turm hinaufgeklettert war, um von hier die herrliche Aussicht zu genießen, setzten wir uns in
seinen Garten. Das Gespräch kam auf den Krieg. Ich legte ihm meinen Standpunkt dar (ob man als Christ den Sieg Deutschlands wünschen müsse und könne), wie ich ihn am 26. Mai niederschrieb. Er meinte:
„Es sei ein ziemlich passives Verhalten des Volkes zu beobachten. Dem Volke fehle es durch seine Entmündigung an Aktivität, an begeisterter Teilnahme an den Ereignissen. Es fürchte das, was nachher kommt. Auf jeden Fall würde der Sieg als Triumph der Weltanschauung gelten. Der Erfolg gäbe ihnen recht. Und diese Weltanschauung streife bewußt jede Bindung an Übernatur u. jenseits ab, um von Menschen nurmehr das Tier übrig zu behalten. Dieses Tier werde vergöttlicht. Dem Volke wird diktiert von wenigen Männern, und die Masse folgt: Denn ohne Gott und Jenseits läßt es sich
leichter leben. Das Christentum ist keine bequeme Religion, die es dem Menschen leicht macht. Übrig bleibt nur ein kleines Häuflein der andern, das entmündigt ist wie die Masse und sich nicht durchsetzt: die geistige Aristokratie des Volkes.“ – Ich entgegnete: „Warum sollte aus diesem pusillus grex nicht ein Mann aufstehen, der den Führenden der andern Seite zumindest ebenbürtig sei an Macht des Geistes und an Tatkraft – ich bin überzeugt, daß wir nicht weniger solcher Männer haben -, und das Volk wecken? Aber vielleicht ist es schon zu spät. Wir haben alle Gelegenheiten und Chancen der letzten 10 Jahre versäumt, immer nur auf Defensive beschränkt, nie in der Offensive vorwärtsdrängend. Nachdem wir uns so nach und nach jeglichen Einfluß haben
nehmen lassen, bleibt uns heute nichts anders übrig, als gelassen den kommenden Dingen entgegen zu sehen.“
E. stimmte mir bei und fügte hinzu: „Daß der Endsieg Gottes ist, steht fest, aber wie es der deutschen Kirche gehen wird, ist eine Frage, die eher negativ als positiv zu beantworten ist. Das einzige Große, was die Entwicklung gebracht hat und dessen Vollendung sie noch bringen wird, ist, daß die Glaubenspaltung von 1517 beseitigt ist. Die Fronten haben sich verschoben: Es handelt sich nicht mehr um Protestantismus u. Katholizismus, sondern um das Christentum.“
Wir sprechen noch von manchen anderen Symptomen unserer Zeit und berührten auch die Bevölkerungspolitik des Staates. E. meinte, die Organisation des Staates sei groß, und es dauerte nicht mehr lange,
[Gestrichen]
Profanum vulgus auch unter den Theologen! Geistiges Proletariertum anstatt Aristokratie! Doch allmählich habe ich mich in diese Realität hineingefunden. Ich suchte vornehme Gesinnung u. hochherzige Geisteshaltung: ich fand Anstandsformen u. Etikette, hohl u. leer von Feingefühl, Burschikosität – um nicht zu sagen Frechheit – in der Haltung der einzelnen zueinander.
[Gestrichen]
15. Juni.
Nicht alle sind so: Gott sei Dank! Und einer ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen, der angenehm absticht von diesen
Schleichern u. Pharisäern. Auch er sagt mir seine Meinung über meine Fehler offen und klar, doch ganz anders, als jene! Und gibt mir das Recht, auch ihn auf Schwächen aufmerksam zu machen. Es verging die letzten Wochen kaum ein Abend, an dem wir beide nicht hinausgingen und uns gegenseitig unser Herz ausschütteten. Ich liebe seinen treuen u. ehrlichen Charakter, seine offene und gerade Art, wie er konsequent seine einmal als richtig befundene Meinung verteidigt, seinen Gerechtigkeitssinn, sein leidenschaftliches, sprühendes Temperament, seine Unbekümmertheit und unverdorbene Naivität. – Ich glaube, wir müssen Freunde werden. Solch einen suchte ich schon lange. –
[Gestrichen]
18. Juni.
Diogenes mit der Laterne.
-
29. Juni
Die Festreden zum silbernen Priesterjubiläum Dr. Reckers’.
Am Vorabend von Peter und Paul: Feierstunde der Kommunität.
Der Haussenior. Er redete frei und zl. gut, ohne Gestus, wie es für ihn schicklich, in ruhigem Stil, kurz und bündig.
Dr. Steinberg, anfangs befangen, faßte sich schnell u. schlug bald einen herzl. familiären Ton an (der von manchen nachher als wurstig bezeichnet wurde). Seine Rede mit Humor gewürzt. Thema: Sein persönl. Verhältnis zum Jubilar (einige Minuten später, er habe sich dabei in den Mittelpunkt gestellt) und
die Wirksamkeit Reckers im Leoninum. –
Prälat Kiel bot „Gedanken zum Fest“. Seine Eigenart trat heute besonders deutlich zutage. Mit gedämpfter Stimme (der eines alten Mannes) u. müdem Gestus...
Reckers selbst: Sein eigener Werdegang, Erlebnisse u. Dank. In seiner sonst nüchternen Redeweise klangen diesmal einige herzliche Seiten an.
Die Festakademie in der Roten Aula.
Begann ½ 11, bis 1 Uhr.
Steinberg begrüßte in herzl. Weise die erschien. Gäste. Die Mängel des Stils wurden durch den herzl. Ton der Rede wettgemacht.
Exzellenz Dr. Stockums, ruhig und sicher.
Prof. Barion als Vertreter der Fakultät, in seiner saloppen Art redend, doch diesmal seine sonst so üppigen Gesten auf ein
Mindestmaß mimischen Pathos’ einschränkend. (B. ist übrigens noch keine 40 Jahre alt u. schon ord. Prof. (des Kirchenrechts). Ein ganz fähiger Kopf mit ungeheuerem Wissen.) Betonte u. a. sein Bemühen um ein gesundes Verhältnis von Fakultät u. Universität zueinander, das einer Vernunftehe gleiche (der Diplomat!), u. das Entgegenkommen Reckers’, diese seine Bestrebungen zu unterstützen. –
Nach ihm trat mit gemessenen u. bedächtigen Schritten Lieser ans Rednerpult, um mit seiner harten Stimme – Wort für Wort getrennt, langsam u. unaffektiert aussprechend – das harmon. Verhältnis der beiden Konvikte zu rühmen, insbesondere die Vorzüge R.s’ über den grünen Klee zu loben in dem ihm eigenen aesthetischen Idealismus. Ich glaube, er war selbst überzeugt von dem, was er aussprach. Nach seiner Rede
überreichte er dem Jubilar ein Fotoalbum mit Bildern aus dem Albertinum: Mit langsamen, würdevollen Schritten, seine Birne leicht hin und herwiegend, näherte er sich dem Chef, während dieser schnell einige Schritte ihm entgegenging, freudestrahlend das Geschenk entgegennahm u. ihm mit beiden Händen die Rechte schüttelte. Körperliche u. geistige Gegensätze! R.s’ Glatze strahlte nur so vor Wonne.
Mit energischen Schritten trat nun Dr. Frings vor, ein etwas untersetzter Mann, aber kraftvoll u. feinnervig, mit scharfen, fast aristokratischen Gesichtszügen. (Er war übrigens der einzige von den Rednern des Tages, der nicht das Katheder betrat, sondern sich daneben stellte.) Er sprach mit angenehmer Stimme, rasch u. mit musikal. Tonfall, trug seine gutgewählten Gedanken in mustergültigem Stil vor. Die kurze u. bündige Art
seiner Rede hinterließ einen sympathischen Eindruck.
Msgr. Hinsenkamp. Anfangs zeigte er eine nervöse Unruhe, steigerte dann aber sein Pathos schnell u. trug seine langen Tiraden in übertriebener Stärke u. in sich überstürzendem Tempo vor. Man merkte ihm sein Bemühen an, rhetorisch zu glänzen; gefiel sich im Gebrauch von Metonymien, konnte aber dabei grotesk u. lächerlich wirkende Katachresen nicht vermeiden. Er kam vom Krieg („unter dem Gesichtswinkel der donnernden Kanonen betrachtet“) auf die soziale Frage, vom Dogma auf die Priestererziehung, von der finanziell ungesicherten Position des Geistlichen auf die Physiognomie, die persönl. Charakteristik u. die zukünftige Kononisation (!) Rs’, „von’t Hölzken auf’t Stöcksken“ zu sprechen. Als er mit ernster Miene von
der einstigen Heiligsprechung des Jubilars redete, war die schon lange wahrzunehmende Heiterkeit des Auditoriums nicht mehr zurückzuhalten, u. der ganze Saal brach in schallendes Gelächter aus – wie mir scheint, weniger über den gehörten Witz, sondern mehr über die komische Figur, die der alte H. abgab. Sein Pathos, das in keinem Verhältnis zu der Trivialität seiner Gedanken stand, steigerte sich zu einer Stimmstärke, die garnicht angebracht war, u. mit ihm wuchs die Heiterkeit des Publikums, bis er plötzlich u. überraschend – an einer Stelle, wo alle noch etwas erwarteten – zum Schluß kam. –
Die Festkorona atmete auf, u. auch H. wischte sich den Schweiß von der Stirne, als er sich an seinen Platz zurückbegab. Da öffnete sich der Flügel der hohen Eingangstür, und unter lebhaftem Beifalltrampeln trat der
alte Geheimrat Prof. Dyroff ein. Er begrüßte Exzellenz, die sich auch erhoben hatte, durch Handschlag u. nahm dann Platz.
Festansprache. Prälat Serres.
Redete warm u. herzlich, um nicht zu sagen väterlich – ähnlich wie Kiel, nur mit vollerer Stimme, die man sogar als wohltönend bezeichnen kann. Schöpfte tiefe Gedanken über den Endsieg Christi über das geschichtl. Werden unserer heutigen geist. u. rel. Situation u. unsere Aufgabe an dieser.
Reckers sprach seinen Dank aus, in gutem Stil u. sogar warmherzig, wie ich diesen sonst so nüchternen Mann noch nie hörte.
7. Juli.
Dies war die erste Nacht seit drei Wochen, in der kein Fliegeralarm gegeben wurde.
Da hatte ich einen Traum, an dem ich mich mit seltener Deutlichkeit zurückerinnere. Die Kommunität sitzt morgens beim Frühstück im Speisesaal. Da kommt der Repetent herein. Als ihm aus einer Ecke des Saales Beifallgetrampel entgegenlärmt, setzt er eine wütende u. beleidigte Miene auf u. kommt drohend auf die Seite zu, wo ich meinen Platz habe, die an dem Getrampel aber nicht teilgenommen hatte. Er geht geradewegs auf mich los u. versetzt mir eine schallende Ohrfeige mit den Worten: „Sie sind natürlich wieder dabei“. Merkwürdigerweise bleibt meine Brille dabei unverbogen auf meiner Nase sitzen. Ich stehe von meinem Stuhl auf, nehme meine Brille ab und sage – dem Repetenten
direkt in die Augen blickend: „So können Sie mich besser schlagen, Herr Doktor!“ Worauf er auch tatsächlich mir noch ein Dutzend Maulschellen verabreicht, bei denen ich – wiederum merkwürdigerweise – nicht den geringsten Schmerz verspüre. –
27. Juli.
Wir werden zur Verantwortung gezogen nicht nur für das Böse, was wir gewollt taten, sondern auch für das, was wir ungewollt verschuldeten, aber mit unserem Willen hätten vermeiden können.
10. September.
„Zwischen zwei Trimestern“
- denn „Ferien“ konnte man das nicht nennen.
Die Menschen, mit denen ich zusammenkam.
An einem der ersten Tage besuchte ich Kaplan H. Er steht mitten in der Arbeit für das Pfarrexamen, was ihm viel Kummer macht. Für einen Tag mußte er aber aussetzen, denn da bevölkerte sich seine Bude mit Leuten, die ihm zum Namenstag gratulieren wollten. Es kamen u. a. Vikar L., Rektor M. u. Vikar H. So lernte ich den Klerus unserer Pfarre einmal von echt menschlicher Seite kennen. Ich saß als Jüngster in der Korona von etwa 10 Herren, fühlte mich dort aber sehr wohl. Vor allem der ungezwungene und fröhliche Ton der Unterhaltung, das ganz
ungezierte und unmaskierte Benehmen eines jeden, was man gerade in der Gesellschaft so selten findet, das alles nahm ich als angenehmen Eindruck mit nach Hause.
Meinen alten, kranken Lehrer August Böhmer, dessen einstmalige vitale Aktivität unter einem schweren Anfall zusammenbrechen mußte und der nun recht einsam auf den Tod wartet, suchte ich ebenfalls auf. Sein Gesicht glich dem eines Toten. Die erloschenen Augen blickten mich aus tiefen Höhlen an. Von Zeit zu Zeit schüttelte ihn heftiger Husten. Ich bewundere sein unerschüttertes Gottvertrauen. Hier sitzt ein Mensch, den man früher nie anders als lachend sah, der heute als ein Gebrochener dasitzt, und der doch – wie [.?.] – sich an Gott aufrichtet. Seine Kinder mußten nachher kommen und mir das Lied „Lobt froh den Herrn“ vorsingen.
Bei Studienrat Sp. verbrachte ich wieder einen netten Abend. Der Mann ist wissenschaftlich noch sehr rege. In der Schule hat er sehr wenig Erfolg. Bei den Schülern kann er sich nicht durchsetzen. Die Zukunft sieht er sehr schwarz, allzuschwarz. – Ein wie feiner Mensch Sp. ist, ging mir erst in den letzten Jahren auf, als ich ihm persönlich näherkam.
Mein Freund Ferdi war bei mir, immer noch der alte, entschlossene Kerl. Was soll ich noch viel über ihn schreiben?
Wie ganz anders H. W., den wir schon als Sextaner „Zappel“ nannten! Weltanschaulich mir diametral entgegen, dabei eingebildet und von affektiertem Benehmen. Er ist vielseitig gebildet u. hat tatsächlich was los, könnte viel mehr leisten, wenn seine menschliche Persön-
lichkeit nicht so zerrissen u. unharmonisch wäre. Er hat keine Freundschaft, keine Liebe, ist ein hartnäckiger Einzelgänger, will von andern unabhängig sein, selbst von seinen Eltern. Die Hybris sieht man ihm vom Wirbel bis zum Zeh an. Er kennt Gott nicht, kennt sich selbst nicht, kennt seine Mitmenschen nicht. Ich glaube, ihn mit dem Kopf auf die Fragwürdigkeit seiner Existenz gestoßen zu haben. Er ist unruhig bis in den letzten Winkel seiner Seele; mag er unruhig bleiben, bis er die Ruhe gefunden hat. –
Hans e. erzählte mir „Polnische Zustände“. Er ist seit einiger Zeit Lehrer in Dombie bei Litzmannstadt im Generalgouvernement – der einzige deutsche Katholik in der ganzen Gegend, ganz auf sich allein gestellt. Die polnischen Geistlichen stehen auf einem ganz entsetzlich niedrigen Niveau.
Seit langer Zeit traf ich wieder Fritz H. Seitdem er in Wien Staatswissenschaften studiert, hat er mächtig an Reife gewonnen. Aber seine Nachlässigkeit und Wurstigkeit ist die alte geblieben.
Drei Wochen Arbeit auf der Union-Rheinische Braunkohlen-Kraftstoff AG. als Werkstudent. Mehr als die Hälfte der Belegschaft des Werkes bestand aus Holländern, z. T. Kriegsgefangenen. Die andern: Slowaken, Juden u. eine Anzahl Studenten aller Fakultäten. Sehr interessant u. aufschlußreich!! Die drei Wochen brachten mir viele Erkenntnisse politischer u. sozialer Art.
Ich halte die Einteilung der Arbeiter in solche der Stirn u. solche der Faust sehr vernünftig. Nur sollte man dabei bleiben und die Konsequenzen ziehen. Einem Bergmann würde man nie zutrauen, sich in seinem
Urlaub in einen Hörsaal zu setzen und Geschichte der Philosophie zu hören; aber von einem Studenten erwartet man mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit, daß er sich in den Ferien in eine Fabrik stellt. Als ob die geistige Arbeit den Menschen nicht voll in Beschlag nehme! Als ob die geistige Tätigkeit nur ein Attribut sei. Ich halte dafür: Der Mensch ist entweder für Geistesarbeit oder für Körperarbeit veranlagt. Ein Mittelding gibt es nicht. Das sagt auch Schopenhauer (Aphorism 10.).
Ich beobachtete, daß ein regulärer Arbeiter das Doppelte, wenn nicht dreimal soviel schafft wie ein Student, selbst wenn dieser einen kräftigen Körper und guten Willen hat. Merkwürdig, welcher Krampf heute zur Belebung der Volks“gemeinschaft“ versucht wird. Mit großmütiger Geste führt man in Bayreuth Tausende Arbeiter ins Theater,
und die Studenten schickt man in die Fabrik. Kunst und Wissenschaft gehen quantitativ in die Breite, und das ist bis zu einem gewissen Grade gut so. Aber die Tiefen menschlichen Geistes haben wir verlassen. Die Kunst und die Wissenschaft werden popularisiert – was würden Nietzsche oder Schopenhauer dazu sagen? – Es lebe das Kollektiv! – Wie lange noch?
Am 2. Sept.: In der Ludgeruskirche fiel ein 70 jähr. Lehrer beim Singen des Requiems plötzlich tot um –
13.IX.
Fachschaftssitzung. So (siehe oben) hatten nicht nur wir, sd auch Prof. Barion sich die „Erntehilfe“ nicht vorgestellt. Man habe ihm gesagt, mehr als die Hälfte der deutschen Ernte gehe verloren, wenn die Studenten nicht
bei ihrer Einbringung mithelfen würden. Daraufhin habe er natürlich usw. –
Das war nur einmal u. kommt nicht wieder. Wir möchten ihm einen Bericht über unsern „Ernteeinsatz“ in Wesseling abliefern, den er zweckentsprechend verwerten wolle.
Ich habe einen solchen abgefaßt. –
15.IX.
Ins Kino gehe ich, wenigstens bis Weihnachten, nicht mehr. Davon hatte ich in den Ferien genug. Es genügte wirklich...
Ich brauche nur meine Mitmenschen anzusehen, dann habe ich Kino genug.
23.IX.
Man sieht heute allenthalben auf den Rockkragen der Männer Bändchen und Nadeln. Hinter diesen Schleifchen wollen sie ihre wirkliche Unbedeutendheit verbergen. Vor sich selbst u. vor andern.
Und merkwürdig: Die meisten fallen darauf herein und beurteilen einen Menschen, den sie zum erstenmal sehen, sofort nach der Anzahl der Farben, die er im Knopfloch trägt, obwohl er selbst den Schwindel kennt usw. Der Mensch kann sich selbst u. andern allerhand vormachen.
Ich unterhalte mich oft lieber mit dem Volk, das wir als verkommen u. verdorben bezeichnen, als mit den sog. Gebildeten, die in ihrer Einbildung nicht wissen, wie korrupt sie selbst sind.
„Das Volk hat sehr gesunde Ansichten usw.“ Pascal 264 ff.
26.IX.
Über den Kalk.
27. Sept. ff.
Das wahre Gottesbild: „Vater unser, der Du bist im Himmel“. Vater; Du; Himmel. – Der Weg zum wahren Gottesbild: Bibel; Messopfer; Gebet;
Ignatius: Gebrauch der Welt. Wir dürfen u. müssen die Welt so viel gebrauchen, wie viel sie uns (negative) von Gott nicht fernhält, u. wie viel sie uns (positive) zu Gott hinführt. Tantum – Quantum. Also nicht Weltflucht. sondern Weltgebrauch! Technik, Natur, Kunst... Alles kann zum Guten u. zum Schlechten gebraucht werden. Die Technik im Kriege.
Kein immanenter Gott, sd. persönlicher.
Kein immanenter Mensch, sd. persönlicher.
Von falscher Demut. Leute, die ihre Fehler vergrößern u. insgeheim dabei denken: Wie demütig bist du doch! Denen möchte man sagen: Du bist wirklich so ein erbärmlich-jämmerlicher Schlamper, wie du sagst.
Die Selbstgerechtigkeit des älteren Sohnes. – Verwerfung des Pharisäers. Rechtfertigung des Zöllners.
M. Schuler: „Der größte Feind einer Weltanschauung ist der größere Enthusiasmus einer gegnerischen Weltanschauung.“
Fortschreitende Bewährung des Glaubens: Maria.
„Gott allein genügt.“
15. Oktober (22.I.41)
Heute sangen wir zum ersten Mal die Komplet deutsch: ein Ereignis von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Man hat das Anliegen der Zeit u. des Volkes verstanden: Das Volk will in seiner Sprache zu Gott reden. Und man geht weitmöglichst auf dieses Anliegen ein. Der seit einigen Jahren in verschiedenen Gemeinden übliche Brauch, die Komplet deutsch zu singen, hat jetzt auch in einem Theologenkonvikt Eingang gefunden, und das will etwas heißen. Von hier aus wird die Erneuerungsbewegung ihre entscheidenden Kräfte erhalten. Man hat endlich erkannt, daß ein Gottesdienst (das Wort im weiten Sinne, nicht nur auf das Meßopfer beschränkt) in deutscher Sprache an Würde u. erhabener Feierlichkeit
einem lateinischen nicht nachzustehen braucht. Deutscher Choral – man erwäge die säkulare Bedeutung dieser Tatsache! Es ist zwar nicht der erste Versuch. Schon im 15. Jh. haben wir deutsche Lieder in Choralmelodien oder lateinische Hymnen in deutscher Übersetzung (Christ ist erstanden). Schon vor Luther! Dieser gab dem Gemeindegottesdienst durch seine Erneuerung (nicht durch die Schöpfung!) des deutschen Kirchengesanges einen Auftrieb, insoweit die Gemeinden durch die Emanzipation der deutschen Sprache im Kirchenraum wieder angeleitet wurde, aktiv am Gottesdienst u. gemeinsam teilzunehmen. Leider fiel mit der lateinischen Sprache nach und nach auch der ganze Kanon weg, sodaß von einer Osterfeier nichts mehr übrigblieb. – Man sucht heute wieder auf die reinen Formen der Urkirche zurückzu-
kommen, in Liturgie u. kirchl. Kunst. Man muß dabei allerdings berücksichtigen, daß die ältesten u. ursprünglichsten Formen durchaus nicht die reifsten zu sein brauchen, daß in späteren Jahrhunderten die Formen meist eine Vervollkommnung erfuhren, freilich auch oft eine Entartung. Insofern diese Entartungen abstrahiert werden, sodaß wir wieder auf einen klassischen liturgischen „Stil“ kommen, kann diese Renaissance der Urkirche gesund sein. Man muß sich zwar vor Übertreibungen hüten. (Übrigens leistet im Bereich der kirchl. Textilkunst nach dieser Tendenz hin Ella Broesch Außerordentliches.) Auf eins muß man aber hinweisen: Die Teilnahme an der Liturgie war für die alten stadtrömischen Christen schon deshalb ganz anderer Art als die unsrige, weil die Sprache der Liturgie zugleich die Sprache des Volkes
war. So konnte der Gottesdienst wirklich Gemeinschaftsgottesdienst sein, denn der Priester betete mit dem Volk zusammen u. abwechselnd mit dem Volke. Daraus erhellt, wie wenig unsere „Gemeinschaftsmessen“, bei denen das Volk die Meßtexte deutsch, der Priester lat. betet, solche sind. Die Divergenz zwischen liturgischer u. volklicher Sprache hat zugleich eine gewisse Divergenz in der Feier der Liturgie zur Folge. Könnte es nicht möglich sein, unter Beibehaltung der einheitlichen Form der stadtrömischen Liturgie an Stelle der latein. Kultsprache die jeweilige Volkssprache zu setzen? Vielleicht kommt diese Zeit noch mal. Die einheitliche Sprache der röm. Liturgie ist ja nur ein Symbol der Einheit der Kirche, gehört aber nicht zu ihrem Wesen. Man könnte sie aufgeben, ohne damit die Einheit der Kirche aufzulösen oder auch nur zu gefährden. Heute haben wir ja schon tatsächlich innerhalb der röm. Kirche zehn
verschiedene Riten mit eigener Sprache. Welche Teilnahme am Opfer wäre möglich, wenn dieses in der Volkssprache gefeiert würde! Wie ganz anders würde der Gemeinde der Sinn der Messe aufgehen! Es würde von selbst jede individualistische Gebetshaltung u. Frömmigkeit ein Ende haben. Denn diese separatistische, partikularistische, private Frömmigkeit hat doch ihren hauptsächl. Grund darin, daß das Volk mit der fremdsprachigen Liturgie nichts anzufangen wußte. Es gäbe keine Probleme mehr über das rechte Verhältnis von Liturgie u. Volksfrömmigkeit. Sind alle diese Motive nicht ausschlaggebender als das Motiv des Symbols kirchlicher Einheit? Diese kann ja weiter symbolisiert bleiben in der bleibenden einheitlichen Form der liturgischen Handlung, der Zeremonien u. des Inhalts der Gebete. Wir müssen hier
katholisch denken, frei und unvoreingenommen. Und schließlich kann auch hier der Grundsatz gelten: Gratia supponit naturam. –
Diese Postulate in die Wirklichkeit umzusetzen, ist eine lange Entwicklung nötig. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, daß wir am Beginn eines historischen Umwandlungsprozesses stehen, der nach dieser Richtung tendiert. –
Ich rede nicht einer vollständigen Abschaffung des Lateins das Wort. (Als Sprache der theologischen Wissenschaft wird es ohnehin nie außer Mode geraten.) Als Sprache der klösterlichen Liturgie könnte es seine Bedeutung behalten. Aber das Volk verlangt darnach, in seiner Sprache mit Gott zu reden. Und wenn man ihm das vorenthält, bleibt die Liturgie ihm fremd, wie die Erfahrung zeigt. Bei unseren Gemein-
schaftsmessen betet das Volk die Meßtexte entweder deutsch – dann kann von einer Gemeinschaft mit dem Priester, der lateinisch betet, nicht die Rede sein, wie ich schon zeigte, oder das Volk betet die Meßtexte in der ihm zum großen Teil unverständlichen, im ganzen fremden Sprache. Beides befriedigt nicht.
16.X.
Wichtig ist nicht nur die Sprache, sd. auch das Sprechen. Der Priester strapaziert seine Stimme wie kein anderer. Niemand braucht seine Stimme so oft u. vielseitig wie er: Predigt, Unterricht, Singen beim Hochamt, Beichtstuhl, usw. Und keiner tut so wenig daran wie er. Die Nationalsozialisten bilden Stoßtruppredner aus. Sie haben die ungeheuere Wichtigkeit der gesprochenen Rede erkannt. (Hitler: „Alle großen Revolutionen der Mensch-
heit sind nicht durch das geschriebene, sondern durch das gesprochene Wort herbeigeführt worden.“) In der Theorie ist innerhalb der Kirche schon seit 1860 auf die notwendige Erneuerung unserer Rhetorik hingewiesen worden. In die Praxis umgesetzt hat diese Erkenntnisse u. Forderungen erst das Dritte Reich. Heute gibt es kaum eine Hochschule, an der nicht ein Lehrstuhl für Sprecherziehung errichtet ist. In Berlin ist es Dovifat (Führer der K.A.), der als ordentl. Prof. für unsere Sache arbeitet. Eine ungeheuer wichtige Aufgabe! –
Heute nachm. waren wir bei den Dominikanern in Walberberg. Dort waren wir eine ganze Stunde allein im Phonetischen Institut. Mit Hilfe der feinsten techn. Apparate bemüht man sich hier um ein
gutes Sprechen. Ein ähnliches Institut ist in Tübingen unter Sedlmair. Gott sei Dank, es geschieht etwas! Nicht alle schlafen. Die Wichtigkeit der Sprecherziehung für den Verkündiger des Wortes Gottes ist erkannt worden! –
Einige Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe:
Demosthenes antwortet auf die Frage nach dem Geheimnis der Rede dreimal: Der Vortrag! – Die Rede ist nicht Monolog, sondern Dialog!! – Auf das richtige Atmen kommt es an! – Man muß aus der Fülle des Stoffes schöpfen. Der Redner muß über das Thema noch zehnmal soviel sagen können, als er schon sagt. Das Ringen um den Stoff. Die Form kommt von selbst. –
Tonus rectus od. tonus objectivus. Der tonus rectus ist eine Eselsbrücke. Man kam
auf ihn, als man weder aus noch ein wußte. Er verdirbt das ganze Sprechen. Das einzige Daseinsrecht hat er im monastischen Chorgebet. Das Wesen der Sprache ist der Rhythmus, der durch den Tonfall bedingt ist. Man soll in der Predigt nicht anders sprechen, als man es sonst tut. –
Die rhetorischen Regeln müssen zum Habitus werden, in Fleisch und Blut übergehn. Wer seine Rede noch nach Regeln bauen muß, ist kein Redner.
Der Kommißton. –
Wie kommt man zur guten Rede? Durch Arbeit! Nicht in 6 wöchigem Kursus. Sondern in mehrsemestriger zielbewußter Arbeit.
Walberberg. Imposanter Geländekomplex. Erbaut 1934. Dominikanerschule. 40 Patres. Kirche katastrophal verbaut. Denn man mußte Grundmauern eines alten Gebäudes
mitverwenden. Im einzelnen gut durchgearbeitet, handwerklich echt! Fein die metallgetriebenen Portale u. die bronzegetriebene Kommunionbank. Herrlich der Kreuzweg! Diese Farben- u. Körpergruppierung, diese Gesten! Die Hinterglasmalerei bringt die Farben mit ihrer ganzen Glut heraus. Davor kann man beten, davor kann man betrachten!
18.X.
Voriges Jahr: Entlassung aus dem RAD.
23.X.
Dölger-Ehrhard.
Der eine (ältere) ein Historiker, der in umfassender Synthese genetisch die großen Zusammenhänge u. Entwicklungslinien im Zeitgeschehen aufzeigte. Der andere mehr ein Kulturgeschichtsschreiber, u. zwar
einer, dem es nicht auf den Hintergrund ankam, sondern darauf, zu wissen, ob man im 3. Jh. mit oder ohne Löffel gegessen hat. – Das ist das was sie unterscheidet. Gemeinsam haben sie ihre Ausbildung, die ausgesprochen autodidaktischer Natur ist; gemeinsam haben sie diesen immensen Arbeitseifer. Sie waren beide „Asketen der Arbeit“ (Klauser). Beide arbeiteten nach festem Tagesplan. Nur ein ganz geringer Teil ihrer Zeit war der Erholung gewidmet. So verschieden ihre Arbeitsmethode war (die riesige Zettelkarthothek des einen, das kleine Studierstübchen des andern mit den wenigen Büchern), eins haben sie gemeinsam – und das begründete ihren Weltruhm - : Die Treue u. Beharrlichkeit in der Arbeit. - - „Otiosis est hic non locus!“
24. Okt.
Rafael Marquis de Valentin.
26. Okt.
Rafael Marquis de Valentin.
29.X.
Dicit Dominus: ego exandiam vos, et reducam captivitatem vestram. – ut a peccatorum nexibus, quae pro nostra fragilitate contraximus, tua beniquitate liberemur. –
De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exandi orationem meam. –
„Fides tua te salvam fecit.“ –
Domine, si vis, potes me mundare! –
Domine, non sum dignus, et intrus sub tectum meum, sed fantum die verto, et sanabitur anima mea!
„Amen, dico vobis, quidquid orantes pe-
titis, credite, quia accipietis et fiet vobis.“
4.XI.
„Was steht auf Ihrem Koppelschloß?“ –
„Gott mit uns!“ -
„Glauben Sie daran?“ –
-
„Wenn wir nicht daran glauben, werden wir nicht siegen!“ -
„Sie sind kein Soldat. Sie können das leicht und schön sagen.“ -
„Ich bin Soldat.“ –
4.XI.
„Ich vergesse das, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt.“
11.XI.
Karl Adam vertritt ebenfalls diese Ansicht...
11.XI.
Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, Begierde nach Weisheit.
14.XI.
Die Gestapo bestimmt die Gottesdienstordnung. – Der Josefinismus. Das 16. u. 17. Jahrhundert: Die englische Kirche.
19.XI.
I. Wahrhaftigkeit.
II. Flaps hat auf seinem Tisch den Spruch stehn: „Deine Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Alles andere ist Mist.“
III. Das Pfuschen in Prüfungen.
IV. Der Mann, neben dem ich zufällig
auf der Bank an der Haltestelle saß, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, mit dem ich zufällig ins Gespräch kam: Nach fünf Minuten holte er Fotografien aus seiner Tasche heraus u. erzählte seine ganze Lebensgeschichte, von Kriegsgefangenschaft in Afrika u. auf der Krim usw. Dann mußte ich ihm helfen, einen Splitter aus dem Handballen zu drücken. Dann kam die Bahn. Das war in Wesseling. –
22.XI.
Schwatzhaftigkeit.
Perlen vor die Schweine.
25.XI.
Schopenhauer sagt einmal, man dürfe in der Konversation nicht sein Wissen glänzen lassen, denn dadurch fordere man nicht die Achtung u. Bewunderung, sondern immer den Haß u. den Neid der Mitmenschen heraus. –
Warum tue ich das überhaupt? Eitelkeit. Es gibt Menschen, die fabelhafte Schauspieler sind, und sie selbst sind sich Zuschauer. Sie sind Schauspieler u. Zuschauer in einer Person. Wenn die andern keine Anerkennung zollen, so gefällt man sich doch selbst. Erstens steht man turmhoch über die andern und zweitens hat man sie nicht nötig. Aber warum tust du es trotzdem?
Der Spiegel: Man meint wunders, was man sei und könne, und sieht nicht, was
für ein armer Krüppel man ist. –
Es gibt welche, die bilden sich darauf etwas ein, das und das zu haben, dieses Buch, jenen Anzug. Andere bilden sich etwas auf die Freundschaften ein, die sie mit „großen“ Männern haben (besser „Bekanntschaften“; Freundschaften nennen sie es nur.) Wieder andere etwas auf ihr (vermeintliches) Wissen. Das können sie aber nur, wenn sie es von sich geben. Was nutzt das umfassendste Wissen, wenn man es den andern nicht mitteilt, um von diesen bewundert zu werden.
Und warum schreibe ich dies alles? Damit ich, wenn ich es später einmal lesen werde, mich selbst bewundere, oder damit ich an den anderen, die es einmal lesen werden, meine Bewunderer habe. Ich setzte dabei schon voraus, daß es der Bewunderung überhaupt wert ist.
Man muß das alles bei Schopenhauer
gelesen haben. Oder bei Pascal, der das aber etwas anders sieht. Etwa die Aphorismen 147 u. 770 (Pensies).
Das Erste handelt davon, wie die Menschen sich u. andern etwas vortäuschen, das nicht da, ihnen aber angenehm ist. Das Zweite, wie die Menschen vor sich u. andern etwas verbergen, das da ist, das sie aber nicht sehen wollen oder von andern gesehen lassen wollen.
„Der Mensch ist also nur Verstellung, Lüge und Heuchelei, sich selbst u. auch andern gegenüber.“
26. Nov.
Man müßte einmal darüber schreiben, welch mächtige Triebkraft im Menschen der Ehrgeiz, die Ehrsucht ist.
27. Nov.
An das Generalvikariat: „Wir brauchen für den Bezirk X. einen hauptamtlich angestellten Jugendseelsorger.“ Oder: „Es ist für die Münsterkanzel unbedingt ein hauptamtlich angestellter Prediger notwendig.“ Antwort O.P.s: „Woher nehmen wir das Geld dazu? Es war doch früher nicht anders! Es hat doch auch früher ohne dem gegangen.“
Wenn Kaller von Ermland sagt: „In meiner Diözese gibt es keine Finanzprobleme, wie kann dann der Kardinal von Köln darauf eine solche Antwort geben! – Ist das Reich Gottes vom Geld abhängig?
29. Nov.
Ideal u. Wirklichkeit.
30.XI.
Ich sah noch nie einen Menschen, der völlig unabhängig war von der Meinung anderer Leute; der sich also nicht darum bemühte, nach Ansehn, Ehre, Hochachtung selbst Macht (sei sie noch so gering) zu streben. Die Menschen sind so. Und es ist gut, wenn man weiß, daß es so ist u. daß man selbst auch so ist; es ist gut, das einzusehen, selbst wenn doch nichts daran zu ändern ist.
5.XII.
„Warum werden denn diese Archive nicht auch geöffnet?“ -
„Weil in ihnen Material über noch Lebende liegt.“ -
„Darauf nimmt man Rücksicht? Das Höchste ist doch die Wahrheit!“ -
„Nein“, sagte der Kardinal, „das Höchste ist die Liebe!“ –
VI. Dezember.
[.........] – fürchtet euch nicht, ihr kleinen lieben Englein, daß ihr nicht vom Sockel fallt!
-
1941. 22. Januar.
Giovanni Rosmini: Delle cinque piaghe della santa Chiesa: Im Gottesdienst ein Mangel an Zusammenhang zw. Klerus u. Volk, bedingt durch den Gebrauch einer nicht mehr lebenden Sprache. Das Volk kann dem Gottesdienst nicht folgen, es steht starr da wie die Säulen eines Tempels, die die Stimme Gottes nicht vernehmen...
26. Jan.
Was mir im Weinhaus einfiel:
Die Gäste sprechen sehr leise. Warum? Nicht etwa, damit sie nicht von andern gehört werden, sondern damit sie die Gäste am Nachbartisch besser hören können. – Man könnte sagen, ich schließe das von mir auf andere. Das ist nicht so. Denn ich sprach sogar ziemlich laut, und man machte mich darauf aufmerksam (man hat mich überhaupt schon öfters gebeten, meine Stimme zu dämpfen. Ich weiß nicht, ob meine laute Stimme vom Organ herkommt oder daher, daß ich die Menschen nicht fürchte). Da fiel mir das ein.
[Torheit]
noch 26.
Wenn jemand einen Witz erzählt, eine Scherzfrage, so sucht er seinen Zuhörer durch völlig belanglose Einzelheiten von der Hauptsache abzulenken. Und so findet dieser nicht die Antwort, die meist die einfachste der Welt ist. – So ist es auch oft mit Fragen, die alles andere als scherzhaft, sd im Gegenteil sehr ernst sind, von deren Lösung für den Menschen sehr viel abhängt. Die Kleinigkeiten halten ihn davon ab, die Lösung zu finden, die für den einfach u. natürlich denkenden Menschen auf der Hand liegt. Und oft liegt es nicht einmal an suggerierenden „Kleinigkeiten“.
2.II.
Relation:
1. Polarität: Gott-Sohn – Gott-Vater
2. Polarität: Mensch – Gott
3. Polarität: Mensch – Mensch od. Mann – Frau.
Die dritte Relation ist Gleichnis der zweiten, die zweite Relation Gleichnis der ersten.
Vgl. dazu: Christus selbst, Pauli Lehre u. Dostojewski. –
- Das könnte übrigens viel Stoff zu einem Buch geben. Unter anderm: Gottesliebe ist Nächstenliebe. Ich liebe Gott in meinem Nächsten; Nächstenliebe ist Sinnbild der Gottesliebe. – Die Ehe ist ein Geheimnis in Bezug auf Christus. usw. usw.
23:II.
Ich bin in die Höhle des Löwen gegangen, und habe festgestellt, daß der Löwe – doch kein Löwe war.
Unverblümte Wahrheit.
Hätte ein 20-Jähriger mit einem 50jährigen, der dazu sein Vorgesetzter ist, offener reden können?
Ich Myschkin, ich „Idiot“!
Gut schreiben kann ich auch, Kunstschrift.
1941
13:I. Trimesterbeginn. Dostojewski-Arbeit.
10.III.-9.VI. Rekrutenzeit in Hamm i. W.
9.VI.-19.VII. Ula Elberfeld
22.VI. Krieg mit Rußland.
19.VII.-14.VIII. Lingen-Ems
14.-31.VIII. Rheine
31.VIII. Ab nach Rußland
19.IX. Zum IR. 120 mot. (60. J.D.) Dnjepropetrowsk
28.IX.-23.X. Alexandria
23.X.-25.XI. Poltawa
25.XI. Vormarsch. Stalino
1.XII.-8.XII. Einsatz u. Feuertaufe bei Prokopskoje
20.XII. Abtransport ins Lazarett.
23.-30.XII. in Mariupol. – Fahrt über Stalino – Dnjepropetrowsk nach Lemberg.
1942
7.I.-19.I. Universitätsklinik Lemberg.
22.I.-21.IV. Lazarett Neuruppin
21.IV. Nach Danzig
11.-31.V. Urlaub: Essen u. Bonn
26.VII. Beförderung zum Gefreiten. Ausbilder in Danzig.
27.VII.-11.VIII. Erholungsurlaub.
1.VIII. Mit Fritz Fahrt nach Burg a. d. Wupper.
9.IX.-9.X. Lehrgang: Danzig
11.-14.X. Sonderurlaub.
3.XII. Studienurlaub: Bonn
13.XII. bei Dresen in Siegburg
18.XII.-5.I. Semesterferien.
1943
5.-9.II. Exerzitien (Schräder OFM) Bonn
7.III. bei Dresen in Siegburg
23.III. Schloß Brühl
29.III. Semesterschluß.
29.III.-16.IV. Urlaub in Steele
10.-11.IV. Rheindahlen u. Gladbach
Rückblick und Ausblick
13.XII.1942.
Die heutige Lehrtheologie: auf Flaschen gezogene Wissenschaft. Ehrfurcht – Professorenarroganz. Was wir brauchen: lebendige Theologie (Guardini, Adam, Schmaus, Soiron ). Wissenschaft nicht Selbstzweck... Das Ziel ist Weisheit. Jungmanns Anliegen: Lehrverkündigung. Das gärende, schöpferische Element in der Theologie des 19. Jh.: Döllinger, Schuben, Deutinger, Möhler: Stagnation oder lebendige Fortentwicklung? Laros, Das christliche Gewissen in der Entscheidung, und Koepgen, Die Gnosis des Christentums sind indiziert worden!
Der Klerikalismus das Hauptübel der Zeit. – Zur Lage des deutschen Katholizismus hat Karl Adam in Aachen mannhafte und klare Worte gesprochen.
4.II.1943
Man muß in die Wüste gehen, man muß sich lösen...
9.II.
Die Lebensmitte des Priesters ist Christus. Er offenbart sich ihm in der Eucharistie u. in der hl. Schrift. Der Priester kommt ihm nahe im Gebet und im Opfer. Durch diese vier Elemente: Eucharistie und Schrift, Gebet und Opfer wird seine communio mit Christus vollzogen, die ihre höchste Verwirklichung im Meßopfer findet. Denn in der hl. Messe sind diese vier Elemente formal und wesentlich vereinigt.
26.II.
„Ich lüge, weil ich ja selbst weiß..., daß der Untergrund keineswegs besser ist, sondern etwas ganz anderes, wonach ich mich sehne,
über die Maßen sehne, und das ich doch auf keine Weise finden kann!“
Der Kellerlochmensch. Dostojewski, Aus dem Dunkel der Großstadt (Band XX, 1906, S. 53).
9.III. „Memento homo, quia pulvis es et ad pulverem reverteris.“ Früher lachte man darüber. Und heute? Essen, ein rauchender Trümmerhaufen, der Tausend Menschen begraben hat und auf dem die Überlebenden weinend hin- und herlaufen, ist ein gewaltiges „Memento homo“.
Aber darüber leuchtet die Hoffnung, daß auch unser schwacher, vergänglicher Leib einmal zur vollen Herrlichkeit auferstehen wird... „Seht, ich mache alles neu, und ich werde jede Träne von ihren Augen löschen.“
10.III. Vergangenen Sonntag las ich meine „Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ vor. Erregte Diskussion. – Ich habe versucht, in dem scheinbaren Wahnsinn des gegenwärtigen Geschehens einen Sinn zu finden, einmal von der Geschichte her, dann von der Religion her.
13.III.
Nikodemus war der erste Generalvikariatsrat. Er hat den Leichnam Christi begraben...
27.III.
„Sei getrost, Du würdest mich nicht suchen, wenn Du mich nicht schon gefunden hättest.“
„Ich kann nur in die offene Hand meines Heilands fallen.“
29.III.
Colloquium im Kolleg von Prof. Schöllgen. Ich stellte die Frage: „Wie ist ein Tyrannenmord zu beurteilen? Und zwar in dem ganz konkreten Fall Wilhelm Tells, wie ihn Schiller mit allen Motiven und circumstantiae geradezu klassisch geschildert hat? Das ist zwar seit Untersekunda ein Gemeinplatz, scheint mir aber doch gerade heute sehr aktuell zu sein. Laros gibt darauf eine klare Antwort, doch sein Buch ist indiziert worden.“ – Unter den Hörern Faxen und Räuspern. Bei Schöllgen Überraschung und betretendes Schweigen. Dann redet er eine halbe Stunde über alles mögliche, nur nicht zur Sache. Erst gegen Schluß kommt er darauf, daß Tell eine „Idee“, aber keine historische Gestalt ist. Ist das denn ausschlaggebend?
Angenommen... Der Fall liegt doch klar, man muß doch ein Urteil fällen können! Natürlich: Grenzen der Moralphilosophie; Grenzfälle... – Richtig, Herr Professor! Die subjektive Meinung Tells ist schwer zu beurteilen. Aber er handelt nach seinem Gewissen, ist von der Richtigkeit seines Gewissens überzeugt (Notwehr! usw.); seine Tat ist also schuldlos. – Aber ist die Tat objektiv zu billigen? Das ist die Frage! Sie haben sie nicht beantworten können.
Rheindahlen, den 11.IV.
Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam.
15.IV.
Mein Tagebuch. Gedanken über Zeit und Menschen. Nur selten etwas Persönliches, „Autobiografisches“.
Verstreute Notizen
aus den Jahren 1941 bis 1947.
Wenn man von einem Toten sagt, er habe keinen Gegner gehabt, so ist er ein Trottel oder ein Speichellecker ohne eigene Meinung gewesen. Ich liebe die Menschen mit vielen Feinden, denn bei ihnen kann man ziemlich gewiß sein, daß sie Charakter und Haltung haben. Beides ist in der Welt verpönt. Bismarck war nicht „höflich“; deshalb hatte er viele Feinde.
Kalender 1942
Wenn man das Glück hat, eine Meisteroper in ausgezeichneter Inszenierung u. stilvoller Ausstattung zu hören, und wenn dabei Ensemble wie Orchester gleich vollkommen sind, so wird man sich keinen erhabeneren Kunstgenuß denken können als diesen. Denn hier ist Dichtung, Malerei, Musik u. Gesang, Schauspiel- und Tanzkunst zu harmonischer Einheit verschmolzen; alle Künste geben ein Fest zu Ehren der Schönheit und des Wohlklangs.
Kalender 42
Ein feierliches Hochamt in einem Dom: Hier ist der Brennpunkt, in dem sich die Strahlen aller Künste zu einem einzigen rauschenden Hymnus sammeln. Architektur, Malerei, Plastik, Musik und Gesang, der dichterische Schwung der liturgischen Texte und die erhabenen Gebärden der Zeremonien, der Glanz der Kerzen und der
Wohlgeruch des Weihrauchs und der Faltenwurf der Gewänder – alles vereinigt sich zu einem jubelnden Sursum corda, zu einem einzigen Lobe Gottes.
Kalender 42
„Wie kommt es, daß man sich unter dem entsetzlichsten Despotism noch zur Fortpflanzung entschließt? Weil die Natur sanftere, aber gebieterische Gesetze hat als die Tyrannen, und das Kind lächelt der Mutter zu unter Domitian wie unter Titus.“ -
Dieser Satz Chamforts half mir einige Rätsel lösen, die mir die russischen Verhältnisse aufgaben.
Kalender 42
Freiheit von bösen Leidenschaften? Ein Mensch ohne böse Leidenschaften wird auch keine guten haben, denn beide Arten entspringen derselben Wurzel.
Kalender 42
An vielerlei Orten und mit vielerlei Menschen habe ich Gespräche geführt, im Salon und auf der Straße, im D-Zug und in Waldeinsamkeit, auf der Baustelle und in der Fabrik, am Krankenbett und auf dem Sportplatz, am Gestade des Meeres und in den Steppen Rußlands, im Luftschutzkeller und im Kaffeehaus, zu nächtlicher Stunde oder in der Sonnenhitze des Tages, mit Arbeitern und Bauern, Soldaten und Knabe, Klugen und Narren, Künstlern und Dilettanten, Frauen und Kindern, mit Schweinen und Heiligen, Betrunkenen und Nüchternen, mit Armen und Reichen, Alten und Jungen – jedesmal habe ich
mehr über den menschlichen Charakter erfahren als je aus allen Büchern zusammen, einmal aus dem, was sich hinter hohlen Worten verbarg, einmal aus dem, was den Lippen unfreiwillig entfuhr und so blitzartig die wirkliche Situation der Seele beleuchtete.
Kalender 42
Ein Urteil gibt oft mehr Aufschlüsse über den, der das Urteil spricht, als über die beurteilte Sache selbst.
Subjektivität des Urteils.
Wenn jemand sich zu irgendeiner Person oder Sache kritisch äußert, so kann man sicher sein, daß diese Kritik mehr das Wesen des Kritikers offenbart, als das der kritisierten Sache. Und wenn ich über diesen Kritiker meine Meinung darlege, so werden andere Kritiker sagen, daß ich zu scharf oder zu milde, zu tolerant oder zu fanatisch, gerecht oder ungerecht, voreingenommen oder unbeeinflußt urteilte. So gibt mein Urteil andern Anlaß, über mich und meine Weltansch. ein Urteil zu bilden. Daraus erhellt die Fragwürdigkeit aller Doktrinen der Geschichtswissenschaft. Der antike Kulturkritiker wird von seinem Kollegen der Renaissance gewürdigt oder verurteilt, und der Humanist hin wiederum findet von Späteren sein Urteil anerkannt oder abgelehnt.
Kalender 42
Mk. 8, 31-38. Lk 9, 22-26. Mt 16, 21-26. Dies sind sehr wichtige Stellen! Der Menschensohn muß leiden. „Mußte Christus das alles nicht leiden, um in seine Herrlichkeit einzugehn?“ (Lk 24, 26). Petrus hat noch keinen Sinn dafür, der Teufel spricht aus ihm. Er zieht das Schwert, doch Christus verweist es ihm (Mt 26, 52-54). Denn das ist nicht die rechte Tapferkeit. Sie besteht im geduldigen Ertragen des Leidens (Mk 8, 34) und im Bekenntnis Christi (Mk 8, 38). Hierin versagt Petrus (Mk 14, 66 ff). Und die übrigen Jünger flohen (Mt 26, 56). Maria u. Johannes aber leiden unter dem Kreuze mit und zeigen so wahre christliche Tapferkeit. – Das gleiche gilt auch für die Kirche, das Reich Gottes. Sie ist der fortleidende Corpus Christi.
Kalender 42
Landschaftsmalerei:
Morgen: Claude Lorrain – taufrischer Glanz – Glück.
Mittag: Vincent van Gogh – Flimmern u. Hitze – Krise.
Abend: C. D. Friedrich – Klarheit – Reife.
Nacht: Rembrandt – Licht im Dunkel – Gnade.
Kalender 42
Es ist etwas Wunderbares, etwas Heiliges ums Brot; wir wollen Gott dafür danken!
Kalender 42
Es ist gut für uns, in der Wirrsal unserer Tage, in denen alles wankt und stürzt und nichts Bleibendes uns auf dieser Erde hält, die Augen zu den Sternen zu erheben und uns auf das zu besinnen, was unvergänglich und ewig über allem schwebt. In dieser Haltung wird die Verzweiflung nicht Macht über uns gewinnen. Vielmehr werden wir Kraft schöpfen, die Gegenwart zu meistern und für die Zukunft zu hoffen.
März 43: Einige Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Wir haben gewiß keinen Grund, mit apodiktischer Gewißheit an einen Sieg zu glauben. Es gibt eine Kollektivschuld, und es gibt auch eine Kollektivsühne, und ich weiß nicht, was aus uns wird, wenn wir der Millionen in diesem Krieg unschuldig Gemordeter wegen einmal zur Rechenschaft gezogen werden und das Blut eines zusammengeschossenen Volkes über uns und unsere Kinder kommt.
März 43: Einige Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ernst Jünger: In diesem heroischen Geiste hat sich der hochfliegende Schwung des Idealisten mit der Scharfsichtigkeit und Unbestechlichkeit des Realisten verbrüdert.
Der Idealism einer jugendlichen Zeit verpufft, wenn ihm nicht ein gesundes Maß Realism beigemischt ist. Der Realist betrügt sich selbst, wenn er nur seinen Sinnen traut und allein das Gegenwärtige gelten läßt, ohne an die mög-
liche Verwirklichung des Idealen zu glauben.
Kalender 1943
Hamlet, Faust, Don Quichotte, Don Juan, Iwan Karamasoff – Symbole des Menschen, vor allem des europäischen Menschen im 20. Jh.
Kalender 43.
Memorandum 1947.
Das Leben liegt vor mir als eine Aufgabe, die zur größeren Ehre Gottes und zu meiner eigenen Vollendung zu meistern ist.
Ich habe den Herrn zu bitten, daß er mir soviel Freiheit gebe, diesen Auftrag erfüllen zu können. Jede Entscheidung ist zugunsten dieser Aufgabe zu treffen. Alles Tun, was mich von dieser Aufgabe abhält, ist Sünde.
Das Wichtigste für mich ist Gott. Das Zweitwichtigste meine unsterbliche Seele.
A. Das Ziel: Das Reich Gottes.
B. Ort und Mittel seiner Verwirklichung:
1. Ich selbst.
2. Meine Familie.
3. Mein Beruf.
I. Ich selbst.
A. Ich will in meinem Leben das christliche Ethos vereint mit dem humanistischen Bildungsideal verwirklichen.
Klugheit
Rechte Einsicht in den wahren Wert der Dinge.
Rechte Erkenntnis des Ziels.
Rechte Wahl der Mittel.
Schnell zum Hören, langsam zum Reden.
Keine Vertraulichkeit.
Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem.
Gerechtigkeit
Nicht allen das Gleiche, sondern jedem
das Seine.
Tapferkeit
Starkmütiges Festhalten am Ziel.
Streben allen Widerständern zum Trotz.
Geduld.
Wagnis und Opfer.
Maß
Nichts übertreiben.
Sich selbst zügeln: Vornehmheit.
Herr über die Affekte werden, doch nicht durch Abtötung, sondern durch Bändigung und Zügelung. Die Affekte nicht auslöschen, sondern auf Höchstes richten.
Glaube. Hoffnung. Liebe.
B. Mittel
Die natürlichen Mittel gebrauchen, als ob es keine göttlichen, die göttlichen gebrauchen, als ob es keine natürlichen gäbe.
Übernatürliche Mittel:
Eucharistie. Hl. Schrift.
Natürliche Mittel:
Körper, Seele, Geist in ihren Kräften harmonisch entfalten.
Tätigkeit, Beschaulichkeit.
1. Körper
A. Mein Körper soll Ausdruck der Seele und Werkzeug des Geistes sein. Darum will ich ihn leistungsfähig erhalten durch:
B. Tätigkeit und Übung,
Gesundheitspflege,
zweckmäßige Kleidung und Nahrung,
Haushalt der Kräfte,
ausreichenden Schlaf und Erholung,
Enthaltsamkeit und Zucht.
2. Seele
A. Die Zucht des Körpers soll die Liebeskraft der Seele nicht verhärten, sondern durch Bindung sichern und ordnen. Adel der Seele durch:
B. Selbstachtung,
Ehrfurcht vor dem Anderen,
Verschwiegenheit,
Gelassenheit,
Geduld,
Entsagung.
3. Geist
A. Offenheit zur Welt und zur Ewigkeit.
B. Nüchternheit,
Gesammeltheit,
Gewissenhaftigkeit,
Wahrhaftigkeit,
Warten können.
II. Meine Familie
1. Die Existenz meiner Eltern.
2. Gründung eines Hauses.
3. Erziehung meiner Kinder.
III. Beruf
A. Mein Beruf ist, die Werte der abendländischen Kultur an die nächste Generation zu überliefern und einen eigenen Beitrag zu ihr zu leisten.
B. Dies kann ich am besten wirken als Lehrer an einer höheren Schule und als Schriftsteller.
Studiengebiete:
Theologie (Kirchenväter. Thomas)
Philosophie
Griechische Literatur (Homer, Plato, Sophokles)
Lateinische Literatur (Virgil, Cicero, Horaz)
Deutsche Literatur
Englische Literatur
Geschichte
Kunst
Volkswirtschaft
Geographie
Botanik
Astronomie
Studienmittel
Bibliothek
Kommunikation
Reisen (England, Frankreich, Italien, Griechenl.)
Produktion
Das Ziel meiner schriftstellerischen Tätigkeit ist nicht, das Bestehende zu richten, sondern das Kommende vorzubereiten; nicht dem Geist der Zeit, sondern dem Geist der Ewigkeit Gehör zu verschaffen.
Grundidee: Christliche Humanitas. Zurückhaltung von Kritik, Polemik und Apologetik.
Die Freiheitsidee Dostojewskis
Das Menschliche (Essays):
Zur Symbolik der Farben
Vom Schreiben und von Schriften
Vom Kunstwerk
Vom Gespräch
Homo ridens
Über das Gottmenschentum
Ernst Jüngers Symbolik
Engl. Lyrik
Dramen:
Savonarola
Joh. Chrysostomus
Zu diesen Zielen drängt mein Wille. Möglich, daß Unvorhergesehenes in mein Leben eingreift und mich zu einem Umweg zwingt. Das Ziel bleibt dasselbe: Gloria Dei.
Ich unterstelle meinen Willen dem Willen Gottes. Ich werfe mich in seine Arme. Seine Gnade zieht mich. Mit ihr begann ich, mit ihr werde ich das Begonnene vollenden. Den Augenblick nutzend, will ich jeden Tag einen Schritt dem Ziele näher kommen: in dieser Zeit der Mensch zu werden, den Gott von Anfang an gedacht hat, um in der Ewigkeit der Gottheit teilhaftig zu werden.
-
Ich sterbe nicht, ich werde leben und künden die Werke des Herrn.
Ps 117
Zur Zeit, die Mir gefällt, erhör Ich dich, und am Tage des Heiles helf Ich dir. Ich rette dich und mache dich zum Unterpfand des Bundes mit Meinem Volke, damit du das Land wiederaufbaust und die verödeten Erbteile in Besitz nehmest; damit du den Gefangenen verkündest: Ihr seid frei! Und denen, die in Finsternis schmachten: Kommt ans Licht!
Js 49
Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist Mein!
Herr, öffne meine Lippen! und mein Mund wird Dein Lob verkünden!
Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, ...
Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt ...
Maximen
Sei höflich ohne unwahrhaftig, wahrhaftig ohne unhöflich zu sein.
Freundlich, doch nicht vertraulich.
Nicht von sich reden.
Über sein Vorhaben in Ungewißheit lassen.
Mit Urteilen zurückhalten.
Sich an die Stelle des andern versetzen.
Niemals lästig sein.
Niemandem Schmerz zufügen.
Statt Entrüstung Ironie
Sich nicht mit den Gemeinen Gemein machen
Ich habe einmal versucht, mir vorzustellen, wie es eigentlich sei, wenn ich nicht mehr bin, völlig vernichtet und ausgelöscht, ohne jedes Bewußtsein meiner selbst und ohne jede Erinnerung, daß ich war. Die Erkenntnis, daß mein Körper der Verwesung verfallen ist, hatte für mich niemals etwas Grauenhaftes, aber der Gedanke an die
Möglichkeit, daß auch mein Geist, mein persönliches Sein mit dem Tode zu Ende sei, war mir furchtbar und voll unerträglicher Schauer: Ich vermochte nicht, ihn zu Ende zu denken, und ich hatte das Gefühl, als ob der reine Gedanke daran schon Kraft besäße, mich zu töten: machte doch die bloße Vorstellung eines Nichts mich schon schwindeln. – Und doch gibt es Leute, die mit der ruhigsten Miene behaupten, mit dem Tode sei „alles aus“. Ich habe nie begreifen können, daß es Menschen gibt, die an ein persönliches Weiterleben der Seele zweifeln. Andere sagen, der Mensch sei in seinen Nachkommen unsterblich: Dies ist für mich ein elender Trost, und die Millionen junger Soldaten, die ohne Kinder gezeugt zu haben gefallen sind, werden ihre Richter sein. Ich glaube nicht an die Ewig-
keit des Blutes, denn auch ein Geschlecht, ein Volk geht einmal zugrunde, aber ich glaube an die Ewigkeit des Geistes. Der Tod ist nicht das Ende des Menschen, sondern seine Vollendung und das Tor zur wahren Freiheit. In diesem Glauben besteht der Geist den Schmerz. Er weiß ja, daß alle Leiden dieser Erde vergänglich sind, und er ahnt, daß ihn jenseits des Todes eine Freude erwartet, die nie mehr aufhört.
[geschrieben in Knokke August 1944]
Gott, lehre mich die Hindernisse kennen, die das Wirken Deiner Gnaden in mir hemmen. Stärke mich, sie zu meiden. Oder beseitige sie selbst, wenn ich zu schwach dazu bin.
Gott, ich will nur Dir, nicht den Menschen gefallen.
Gott, laß mich schnell sein zum Hören, langsam zum Reden. Gib, daß ich meine Konversation mit Dir nie unterbreche.
Gott, gib mir Geduld, das Unvermeidliche zu ertragen, Mut das zu Verändernde zu ändern und Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden.
[Geschrieben von Gisbert Kranz
Steele, im Sommer 1947]
Gott, Du liebst mich. Alles, was Du mir schickst, offenbart Deine Güte. Laß mich Dir immerfort danken für jede Freude und jedes Leid.
Gott, entzünde in mir Deine Liebe, daß ich Dich um Deiner selbst willen liebe in Treue und vollkommener Hingabe.
Gott, laß mich beständig Deiner hl. Gegenwart inne sein und nichts tun ohne Dich, alles in Dir!
Gott, gib mir den wahren Geist der Demut! Nicht mir, sondern Deinem Namen die Ehre. Ohne Dich bin ich nichts.