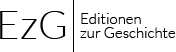Marga Ortmann an August Broil, 8. August 1943
58. Köln, den 8. August 1943.
Du mein lieber August.
Es ist gut, daß eben das Fenster zuschlug, sonst hätte ich vielleicht den ganzen Sonntagnachmittag, den ich mit Dir in Gedanken verbringen wollte, verschlafen. Dazu ist aber die Zeit zu schade, ich will lieber ein wenig mit Dir plaudern, die Woche gibt ohnehin kaum eine Stunde dafür frei.
Ich bin ganz allein. Vater haben wir endlich bereden können, daß er gestern für 8 Tage nach Wittlich gefahren ist; die Ruhe dort wird ihm gut tu. Mutter ist eben zu Domvikar Kleff nach Köln gefahren, so kann ich die letzten Stunden des Sonntages so gestalten, wie es mir am allerliebsten ist: indem ich im Briefe zu Dir komme.
Draußen ist der Himmel mit grauen Regenwolken verhangen. Der leichte Sprühregen, der mir heute morgen auf dem Kirchweg so wohltuend die schmerzende Stirn unter der Kapuze kühlte, hat den ganzen Tag angehalten. Schon als Kind konnte ich stundenlang am Fenster sitzen und in den Regen schauen, so erzählt mir die Mutter. So geht auch jetzt beim Briefschreiben mein Blick hinaus und dabei läßt sich so schön sinnen und träumen.
Heute muß ich Dir zuerst von einer schwachen Stunde sagen, die mir am Freitagabend ordentlich zugesetzt hat. Weißt Du, daran habe ich gespürt, daß der Weg zu dem „Über den Dingen Stehen“, was wir als Christen doch erreichen müßten, noch recht weit ist. Die Arbeit im Büro war mehr als sonst gewesen, ich war redlich müde und der Kopf schmerzte sehr. Als ich um ½ 9 bei den Eltern ankam war alles verschlossen. Durch den Keller kam ich in den Hausflur und setzte mich naß, kalt, müde u. hungrig auf die Treppe. Da packte es mich mit solcher Gewalt, daß ich ja kein zu Hause mehr habe, daß mir die hellen Tränen über die Backen liefen. Ich weiß nicht wie lange ich so da gesessen habe, aber ich habe mich nachher vor mir selbst geschämt, daß mir so etwas passieren konnte und ich mußte denken was Du wohl sagtest, wenn Du mich so gesehen hättest. Sieh‘ Du sollst aber auch um solch eine armselige Stunde wissen, genau so wie Dir all die feinen, hellen Stunden mitgehören.
Du, August, ich muß Dir einmal sagen, wie schwer ich an dem trage, was man Beruf nennt und für uns den Namen doch garnicht verdient. Wir haben schon einmal davon gesprochen, daß wir Mädchen und Frauen gerade im Büro so ganz fehl am Platze sind. Ich spüre das an mir selbst
- 2 -
immer stärker und vielleicht wird es umso schwerer, je mehr das Mädchen dem Frausein entgegenreift. Ich kann heute garnicht mehr verstehen, daß mir die Arbeit, die mir heute so schwer ist, vor noch nicht langer Zeit eine Freude war. Der Umbruch, der sich damit vollzog daß Du in mein Leben tratest, ist ein so gewaltiger, daß er in alles eingreift, was zu meinem Leben gehört, so auch hier. Vielleicht ist die Entwicklung so eine ganz natürliche, vielleicht muß durch die „Berufsnot“ – es ist wirklich eine Not – erst die letzte Tiefe für den eigentlichen Beruf geweckt werden. Die Hingabe, die ich früher auch der Arbeit im Büro – wohl fälschlicher Weise – entgegenbrachte, hat nun ihre eigentliche Erfüllung in der Liebe zu Dir gefunden. Für eine Frau ist aber ein Tun ohne Hingabe, ja ein Tun, das dem Herzen nicht entspricht, dem inneren Wollen widerstrebt, unsagbar schwer. Und dann dennoch täglich seine Pflicht voll und ganz tun, stundenlang über Zahlen sitzen, wenn das Herz nach so ganz anderem verlangt, das erfordert jeden Tag ganze Bereitschaft und läßt sich nur dann erfüllen, wenn man auch das Tun der Berufsarbeit, und mag es noch so nüchtern sein, in den Dienst des eigentlichen Berufes stellt, den wir einmal zu erfüllen hoffen. Dann kann das Ja, das heute jeder
Tag im Büro von mir fordert, eine Vorschule sein für das große Ja, daß ich zu sprechen gewillt bin zu Dir und unserem gemeinsamen Leben. Eines bleibt sich gleich und wird hier und dort von mir gefordert werden: der Mut zum Dienen. Das ist es aber, was uns Menschen von heute ganz besonders mangelt: das Beugen des eigenen Willens, der Verzicht auf die eigenen Wünsche, der Mut zum Kleinsein. Gewiß, auch der Mann müßte sich um diese Dinge bemühen, die Frau aber in besonderem Maße, weil sie wesensgemäß zum fraulichen Sein gehören. Liebster, ich werde da noch viel tun müssen, um wirklich ganz Frau zu sein, so wie Du mich brauchst. Die Schwierigkeiten, die das Berufsleben mir machen, sollen mir Weg dazu sein. So gesehen wird dann letztlich auch das Tun im Büro aus Hingabe geschehen, nicht aus der Hingabe an das Tun an sich – das sind die Dinge nicht wert – sondern aus der Hingabe an Dich und an das volle Ja zum Willen des Vaters, durch das jedes noch so nüchterne Tun eine Sache des Herzens werden kann. Du, da ich Dir nun davon gesagt habe, erscheint mir das alles garnicht mehr so schwer, als in den letzten Tagen. Ich werde morgen die neue Woche besonders froh beginnen, mit den Gedanken, die ich Dir jetzt geschrieben habe. Denn
- 3 -
nicht mit Worten und auf dem Papier werden die Probleme des Lebens gelöst, sondern durch die lebendige Tat, indem wir das Erkannte praktisch zu verwerten wissen. –
Du, gestern hatte ich einen feinen Tag, wovon Du noch wissen mußt. Ich bin ins Vorgebirge gefahren um Obst und Gemüse für die Familie zu holen. Es war eine gute Fahrt: Der Blick ging über die weiten Felder, auf denen die Garben des Heimholens harrten; reichbeladen wankte ein Erntewagen über den holprigen Weg. Auf dem Kartoffelfeld beugen sich Frauen und Kinder, um den Schoß der Erde die Frucht zu entnehmen. Wie wird am Abend der Rücken schmerzen. Die Mühe der Ernte ruht ganz auf den Schultern der Frau, doch Dienst an der Erde ist Dienst am Leben: letzte, eigentliche Berufung der Frau. Auch der Mann auf dem Lande trägt die Berufung, doch er mußte den Dienst am Boden austauschen gegen den Dienst der Waffe, zum Dienst an Leben und Tod zugleich. Als so das sommerliche Land an mir vorüberzog, wurden die Worte Deines Briefes in mir wach, in denen Du mir gesagt, wie sehr Dein Herz sich unserem Land verbunden weiß. Ich hätte die Arme ausbreiten mögen und es hinausrufen in das traute Bild der Wälder und Felder, der stillen Dörfer mit ihren trutzigen Kirchlein: Wie sehr wir es lieben unser Land, unsere Heimat, unser
Vaterland! Daß wir es doch immerfort nur so schauen könnten, in dem friedlichen Antlitz, das es mir auf der Fahrt bot. Ich wollte dieses Antlitz mit den Augen in mich hineinholen, um damit seine Wunden zuzudecken, die sich wie ein Schmerz tief in meine Seele gefressen haben. Wie in Dir die Sehnsucht nach den Schönheiten unseres Landes lebt, so ist sie auch in mir aufgebrochen; fast wie eine Angst etwas zu versäumen, das heute oder morgen verloren gehen kann. Diese Sehnsucht klang mit in dem Wunsche zu gemeinsamer Fahrt, den ich Dir bei unserem letzten Zusammensein äußerte. Weißt Du wie tief es mich beeindruckt hat, daß Du das gleiche in Dir verspürst; daß Du das, was nun mit unserem lieben Vaterland geschieht, mit sorgendem Blick verfolgst, nicht nur um der Auswirkungen auf unser persönliches Leben willen, sondern auch um seiner selbst willen. Denn das eine kann und darf uns als Christen ebenso wenig gleichgültig sein wie das andere – auch jetzt in der großen Not und gerade jetzt. Es hat mich empört und mir weh getan, als neulich jemand die Ansicht vertrat, der Ausgang des Krieges und der jetzigen Entwicklung könne uns gleich sein, wenn wir nur wieder ein geruhsames Leben mit „friedensmäßiger“ Ernährung wiederbekämen. Wie traurig, daß nach allem Geschehen noch einen solche Einstellung möglich ist, dazu nicht einmal verein-
- 4 -
zelt. Nei, wir müssen die Dinge tiefer sehen und ich weiß, daß Du sie ernst nimmst bis zum letzten, und dieses Wissen ist mir ein Trost und eine Freude. Das was wir in Aachen damals besprochen haben, wird in der heutigen Entwicklung seine Bestätigung finden. Woran wir uns nur heranzutasten wagten, das hat Gertrud von Le Fort in ihren Hymnen an Deutschland, die ich so gerne nochmal zur Hand nehmen möchte, gültig fomuliert:
„Volk, nicht am Ufer des Feines harrt jetzt Dein Schicksal:
Vom Menschen ab stieß dein Nachen
Ins Meer des einsamen Gottes,
Und einsam
Reckt dich der Einsame aus wie ein Schwert:
Gerichtet wirst du zum Richter;
Erstickt wirst du Flamme,
Und in die Nacht gestoßen erweckst du den Stern!“
Daß dem erstickten Feuer der Funke glüht, daraus die Flamme lodern kann: das wird unsere Aufgabe sein, die uns gestellt ist zum Heil unseres Volkes und zur Verherrlichung Gottes.
Mein lieber August, es ist so schön, daß uns auch darin die Einheit gleichen Denkens und Fühlens umschließt und wir dadurch wie in den Dingen des persönlichen Lebens, so auch in
denen, die über diesen Bereich – unser „Reich“ – hinausgehen in das größere Reich des Volkes und der Kirche, nicht mehr allein zu stehen brauchen. Im Hinüber und Herüber der Gedanken wird der Blick geweitet und in die Tiefe geführt. Die Gedanken, die Du Dir über Vorsehung und Leid gemacht hast, möchte ich so manchem Menschen in die Seele schreiben, aus dessen Gesicht Verzweiflung oder Abgestumpftheit, Leidensunfähigkeit, spricht. Heute durfte ich noch einem schwergeprüften Mann, der beim Angriff die Mutter seiner 5 Kinder verloren hat, durch ein teilnehmendes Wort helfen. Meistens fehlt mir dazu aber die Freiheit des Wortes, wenn auch das seelische Mitleiden noch so groß ist.
Deine Briefe brauchen jetzt 7 Tage bis zu mir. Den letzten, den Du vorigen Sonntag geschrieben hast, bekam ich gestern abend, als ich von der Komplet nach Hause kam. Mit ihm hat mir der Sonntag begonnen und mit diesem Brief an Dich will ich ihn beenden, mit der Freude und Hoffnung im Herzen, daß uns bald ein Wiedersehen geschenkt werde. Du, mein Liebster, ich grüße Dich und bin bei Dir in allen hellen und dunklen Stunden dieser Tage
Deine Marga.