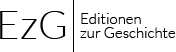Marga Ortmann an August Broil, 28. Oktober 1943
Köln, den 28. Oktober 1943.
Mein lieber August,
seitdem ich in meinem letzten Brief den Versuch gemacht habe, etwas über meine Stellung zum Gebet zu sagen – es ist wirklich nur ein Versuch gewesen – kreisen meine Gedanken fortwährend um das, was unser Beten bestimmt, um unsere Stellung zu Gott. Es ist garnicht möglich, alles auszusagen, was in den Gedanken darüber umgeht, und doch glaube ich, daß das Wenige, das wir einander davon sagen konnten, für unsere Gemeinsamkeit wertvoll ist.
Du gingst von der Bemerkung aus, daß zwischen Deinem und meinem Beten ein ziemlicher Unterschied bestände und nachdem wir nun versucht haben, die Eigenart unseres persönlichen Betens einander gegenüberzustellen, möchte ich Dir noch etwas dazu sagen.
Wie jeder Mensch in seiner Einmaligkeit vor Gott steht, ist auch sein Sprechen mit Gott etwas einmaliges, vielleicht so einzigartig, daß es zunächst jedem anderen Menschen ganz fremd erscheinen muß. Wie oft ergeht uns das bei Gebeten, die aus einer anderen Zeit und einer anderen Lebenshaltung heraus geformt wurden. Es tut sich uns da eine ganz andere Welt auf, in der wir uns nicht zurechtfinden können genau so kann es uns ergehen, wenn wir einen Blick tun dürfen in das Beten eines anderen Menschen, und nur mit liebevoller Ehrfurcht vor der Eigenart des anderen kann
es in gemeinsamen Bemühen gelingen, die Verschiedenheit der Einzelnen einander anzugleichen, so daß keiner dabei verliert, sondern beide darin eine Bereicherung erfahren.
Mein lieber August, je mehr wir einander näher kommen umso mehr vertieft sich auch die Einheit des Denkens und Fühlens. Es drängt uns hin zum völligen Einssein vor Gott. Wir wissen nicht wie weit der Weg noch ist bis zu dem Ziel, wenn es uns aber einmal vergönnt sein sollte wie ein einziges Gemeinsames, der eine des anderen zweites Ich, vor Gott zu stehen und dieses Einssein im Gebet seinen Ausdruck findet, dann wäre damit die höchstmögliche Gemeinsamkeit erreicht, die, weil sie eine geistig-seelische ist, das körperliche Einswerden in der Ehe weit überragt. Dieses körperliche Einssein erhält vielleicht im Willen und Bemühen um das seelische Einswerden seine Berechtigung.
Die Erkenntnis der Verschiedenheit unserer Eigenart ist bei allem, so auch hier, Vorbedingung für das Werden des Gemeinsamen. Der Unterschied, den wir in unserem Beten festgestellt haben, scheint mir vor allem in der Entfernung, in dem Abstand zu liegen, in dem wir vor Gott stehen. (Ob ich da ganz richtig sehe, weiß ich nicht, ich will es Dir aber so sagen, wie ich es empfinde.)
Während bei Dir die Anerkennung der Größe Gottes stärker ist, weil Du sie vielleicht mehr mit dem Verstand zu
ergründen vermagst, steht bei mir die Güte des Vaters ganz im Vordergrund. Du sprichst zuweilen vom Göttlichen, von der Größe des göttlichen, ewigen Waltens und es liegt darin so viel ehrfürchtige Bewunderung, aber auch das Erzittern der eigenen Kleinheit, die den weiten Abstand erkennen läßt. Bei mir ist dieser Abstand etwas mehr überbrück, weil ich nicht so sehr das große „Es“ sehe, vor dem wir als Menschen, den Schöpfer, vor dem wir als Geschöpfe erschauern müssen, sondern vielmehr die personale Nähe des gütigen „Du“ spüre. Er der Vater spannt die Brücke aus der unendlichen Weite seines göttlichen Seins herüber zu unserer Menschlichkeit und weil es sein Wille ist – von uns aus wäre es Vermessenheit – können wir es wagen, ihm auf dieser Brücke entgegenzugehen. Dies geschieht aber dadurch, daß wir Ihm Seine Liebe so viel in unseren Kräften steht erwiedern.
Dieser Unterschied in unserer Beziehung zu Gott liegt vielleicht mehr noch als in der persönlichen Eigenart des Einzelnen in dem allgemeinen Anderssein der Veranlagung von Mann und Frau. Wie die Frau die engere Bindung, die nähere Beziehung zum Leben hat, zu allem Lebendigen, so ist ihr vielleicht auch eine nähere Beziehung zu Gott geschenkt, schon durch ihre natürliche Veranlagung. Religion d. i. die Verbindung mit Gott, gehört einfach zum Wesen der
Frau und darum betrachte ich vieles, was dem Mann als Verdienst anzurechnen ist, bei der Frau als Selbstverständlichkeit. – So gilt es also für uns, die Verschiedenheit unserer Eigenart auch in diesem so entscheidenden Punkt zu einem fruchtbaren Ausgleich und einer glücklichen Ergänzung zu bringen. Wir wollen den Herrn bitten, daß Er uns seine Gnade dazu gibt und wenn wir beide das Unsrige dazu tun, wird uns das Werk gelingen. Du, wir sehen immer mehr ein, wieviel dazu gehört, wenn wir in der Gemeinsamkeit der Ehe als der ganze Mensch vor Gott stehen wollen, so, daß wir vor Ihm bestehen können.
Mein lieber August, da wir uns über unsere Haltung vor Gott und über das Beten Gedanken gemacht haben, müßten wir auch einmal über das Gebet sprechen, das mich jetzt im Oktober besonders beschäftigt hat: den Rosenkranz. Ich habe Dir schon mal gesagt, daß ich diesem Gebet lange Zeit ganz ablehnend gegenüberstand, bis ich es auf Anraten von Herrn Raskop dann doch einmal versucht habe. Der Oktobermonat neigt sich seinem Ende zu und ich muß sagen, daß ich in diesen Tagen das Rosenkranzgebet recht lieb gewonnen habe. Es gibt uns die Möglichkeit die Geheimnisse unseres Glaubens zu betrachten und dabei kann ich so manches erschließen, daß das Maß der zehn Ave für ein Gesetz garnicht ausreicht. Ich habe den Rosenkranz während der Bahnfahrt, auf dem Wege und wenn
ich irgendwo warten mußte zu beten versucht und jetzt ist es mir schon fast eine gute Gewohnheit geworden. Wie manche Zeit wird damit wirklich wertvoll genutzt, die äußerlich als verlorene Zeit gilt. Es ist auch eine gute Schule zur Konzentrierung der Gedanken, die sonst so gerne „spazierengehen“. In unserer Zeit, in der die Tat und der Erfolg alles bedeuten, tut es not, daß wir uns darauf besinnen, daß die höchste Tat das Gebet ist und das aus dem rechten Beten geformte Leben. Aus den Trümmern menschlicher Untaten werden nur die Betenden einst ein Neues bauen – wie Reinhold Schneider sagt – und zu diesem Neubauen wollen auch wir unseren bescheidenen Beitrag geben.
Gestern abend kam Dein Brief vom Samstag bei mir an. Wie fein hast Du die äußere Aufzeichnung des Staates in einen inneren Zusammenhang mit dem Eigentlichen und Wesentlichen zu bringen gewußt. Als Du die Sache im Urlaub so mit einer Handbewegung abgetan hast, war ich garnicht so recht damit einverstanden. Da Du nun davon schreibst wurde mir das wieder so recht bewußt und es war wohl nicht richtig, daß ich das damals nicht gleich geäußert habe. Umso größer war meine Freude, als ich nun Deine Gedanken dazu las. Ja, wir dürfen die Bedeutung dieses Geschehens nicht unterschätzen. Ich glaube das liegt deshalb nahe, weil
allgemein die Werte des Natürlichen, die Werte des Volkes – wir müssen sie als wirkliche Werte betrachten – auf Kosten des Übernatürlichen übersteigert werden in unserer Zeit und daß die allgemeine Unordnung in der Maßlosigkeit beim Abwägen der Werte auch auf uns übergegangen ist. Nur daß wir den Schwerpunkt vielleicht zu sehr auf die entgegengesetzte Seite verlagern.
Ja, es geschieht schon etwas Großes, wenn wir vor dem Volke unseren Willen zum gemeinsamen Weg kundtun. Wenn wir nur denken, welch tiefer Sinn dahintersteht, daß die Frau bei dieser Handlung ihren Namen ablegt, den Namen, der sie bisher als Glied ihrer Familie, als Glied in einer langen Kette von Geschlechtern kennzeichnet, und den Namen des Mannes annimmt, mit dem sie so eins wird, daß auch nach außen hin eine Verschiedenheit des Namens unmöglich erscheint.
Du, mein August, es ist fein, daß wir vorher noch einmal zusammen sein können, um all die Dinge miteinander zu besprechen. Gestern, Donnerstagabend, kam Dein Brief bei mir an, mit Du mir Dein Kommen für Samstag-Sonntag schon in Aussicht stellst. Dann wirst Du also noch eher bei mir sein, als Dich dieser Brief erreichen kann. Und dennoch will ich ein Wenig weiterschreiben, denn ich muß Dir noch sagen, wieviel Freude Du mir mit dem Erzählen über Deinen feinen Sonntag gemacht
hast. Es ist doch etwas Schönes, daß wir uns damit so einander in unsere Erlebnisse mit hineinnehmen können. Dein Brief war mir wie eine Melodie, an deren Klarheit und einfacher Schönheit man sich erfreuen muß. Weißt Du, gerade weil wir uns in den letzten Briefen mit so ernsten wesentlichen Dingen auseinandergesetzt haben – von diesem Brief wirst Du sicher wieder sagen, daß man ihn „durcharbeiten“ müsse – hat mir Dein Brief so recht wieder zum Bewußtsein gebracht, daß unsere Gemeinsamkeit für alles Raum biete: für das Ernste und Schwere, die tiefen Fragen unseres Mensch- und Christseins, und für das Hohe und Schöne, Frohe und Beglückende, für alles Erleben, ob es uns nun aus dem Reich der Gedanken oder dem Reich der Natur und der Menschen geschenkt wird.
Ja, und es ist so beglückend zu wissen, daß man mit nichts mehr allein zu stehen braucht, daß ich alles zu Dir hintragen darf, das Erhebende und Bedrückende, mit der gleichen Offenheit und Ehrlichkeit, mit der Du das Deinige zu mir bringst.
Komm, nun brauche ich Dir nicht mehr zu sagen, denn bald werden wir beeinander sein und dann ist alles noch viel viel schöner, als das Wort und der Brief es erahnen lassen können.
Ich freue mich so sehr auf Dich
Deine Marga.