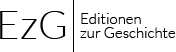August Broil an Marga Ortmann, 16. November 1943
Bremen, den 16. November 1943.
Meine liebe Marga,
über die Sonntage, wie sie mir hier in Bremen geschenkt werden, bin ich immer ganz froh. Ich habe jetzt mit dem Sonntagmorgen eine gewisse Taktik heraus, die es mir ermöglicht, auch wenn ich Dienst habe zur Meßfeier zu kommen. In der Morgenstunde, wenn so allerlei herumgekramt wird, kann ich mich ganz gut aus dem Staube machen. Um 9 Uhr, wenn ich zurückkomme, hat sich alles soweit eingespielt, daß ich mich nur frisch und froh in den Kasernenbetrieb einzuordnen brauche. So kann mir niemand einen Vorwurf machen, daß ich meinen „Dienst“ versäume. Bis mittag wird dann das eine oder andere noch getan – es ist ja nur, daß jemand auf der Dienststelle ist – und dann ist der ganze schöne Sonntag für eigenen Gestaltung frei. Das ist die moderne Kriegstaktik, von der
man jetzt so häufig hört: auch in der Verteidigung das Gesetz des Handelns in der Hand behalten. Siehst Du, und so verteidige ich mich gegen die starke Übermacht „Kommis“, in dem ich doch den Tag so gestaltete, wie ich es unter den gegebenen Verhältnissen selbst will.
Den Sonntagnachmittag hat mich ein Buch von Ernst Wiechert, das ich in der Soldaten-Bibliothek aufgestöbert habe, ganz in seinen Bann genommen: Die Magd des Jürgen Doskocil.
Ernst Wiechert war für mich, nachdem ich vor Jahren einmal die Hirtennovelle gelesen hatte, stets ein Dichter einer ganz ausgeprägt eigenen, zartfühlenden, behutsamen Sprache. Durch all seine Bücher geht ein spürbarer Hauch der Melancholie, die in der ewigen Melodie der großen, unberührten Landschaft der Wälder und Seen Ostpreussens begründet
sein muß. Aus all seinen Bildern und Vergleichen spricht stets eine unnennbare Schwermut, ein unerfülltes Sehnen und Verhaftetsein an die menschlichen Schicksale. Hinter jedem Satz meint man eine hintergründige, unendliche Ferne zu spüren. Seine Menschen tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen aufgegeben ist, und sie tragen leidend und duldend. Sie suchen keine Gewalt, kein Aufbäumen gegen das Unabwendbare, aber sie zerbrechen auch nicht. Sie sind die getreuen Fährleute, die nicht im dumpfen Dahinleben ihr schweres Werk, das Leben vollziehen, sondern in einer inneren Bewußtheit um die abgründige Tiefe und Ungewißheit des Daseins, das doch wieder gehalten ist von jeher und für immer an der ewigen Kette göttlichen Wirkens. Als das Wasser dem von den Menschen verstoßenen, äußerlich gezeichneten Fähr-
mann Doskocil und seinem von ihm zart wie eine Engelsbotin geliebten Weibe die Frucht ihrer Liebe raubt, als es seinen mühsam mit der Hände Arbeit bebauten Acker und seine Hütte zu verwüsten droht, als Fähre und Boote und Netze, Werkzeuge und Sinnbilder seines Menschendaseins das aufbrechende Eis zu zertrümmern scheint, sind des getreuen Fährmanns Gedanken nicht Hader und Fluch, sondern es sind Gedanken des neuen Beginnens: Der Anfang, das ist das Leben. Nicht das Ende.
Dies Wort hat sich bei mir ganz besonders festgesetzt und regte mich zum Nachdenken an, weil ich glaube, daß es ein Wort ist, welches auch für uns in ganz besonderem Maße gilt. Gerade jetzt haben wir davon geschrieben, wie das Leben in einer wellenartigen Bahn auf und ab geht. In ständig neuen Variationen stellt es uns vor neue
innere und äußere Aufgaben. Nie können wir mit Gewißheit von einen Erreichten sprechen, sondern stets müssen wir erfahren, daß das Erreichte nur ein Auftakt ist zu neuem Wirken. Dafür ist uns das Leben geschenkt, das wirkliche, lebendige Leben – seltsam genug klingt dieses Bild – daß wir nicht aufhören es ganz zu leben. Wenn es anders ist, dann dürfen wir nicht von dem Leben sprechen, das wir als Menschen zu bestehen haben. Wenn wir wissen und erkannt haben, daß der Anfang das Leben ist, kann denn alles Schwere und Ungewisse, alles Hohe und Große, das uns bereitgehalten wird die Tiefen, auf die es ja ankommt, in ihren Fundamenten erschüttern? Es kann ihm Farbe oder Glanz oder Schatten verleihen, es kann den Weg des Lebens schmäler oder breiter, steiler oder ebner machen, aber
aber an seiner Grundrichtung kann sich dann nichts mehr ändern.
Und nun beginnen wir; ja, wir beginnen, können wir jubelnd ausrufen. Und wir beginnen gemeinsam. Wenn wir diesen Anfang gemacht haben, dann wird unser Weg anheben. Fragend blicken wir in die ungewisse Zukunft und sind doch glücklich, mit unseren Händen stets das Neue schaffen zu können.
In diese Gedanken über Wiecherts Buch kam mir Dein Brief vom Montag. Als ob Du von den Gedanken gewußt hättest, mußte ich so vieles aus Deinem Brief darauf beziehen. Dieser Brief sagt wie unsere letzten Briefe überhaupt wieder Entscheidendes sowohl über das äußere wie über das innere Geschehen auf dem Wege zu unserer Gemeinsamkeit.
Du, Marga, ich sehe Deinen fragenden Blick, ich spüre Dein horchendes Herz, ich erkenne Deine tiefen Gedanken. Wie soll ich mir die Sorge um mich erklären? Ich bin glücklich, Deinen Gedanken eine tiefe Berechtigung zuerkennen zu können. Du hast an Dir selbst erfahren, was mir schon häufig selbstverständliche Notwendigkeit war: Den ganzen weiten Raum unseres Lebens vorauszuahnen und –zusehen, alle Möglichkeiten, die es in sich beschließt. Du hast ganz offen und zuversichtlich davon geschrieben. Wir können und dürfen nicht so überheblich sein, und im Glück des Augenblicks all das in den Wind zu schlagen, was das Leben für uns ganz sicher bereit hat. Der Weg des Lebens ist bergisch, und wenn wir auf dem mühsam erreichten Gipfel nach dem nächsten Ausschau halten, dann wissen wir, daß er nur auf dem
Weg durch das Tal zu erreichen ist. Wir dürfen nicht mutlos werden, weil wir wissen, daß es so ist.
Dein Brief bringt neue Fragen über die praktische Durchführbarkeit unseres Beginnens. An dem einen wollen und müssen wir festhalten, daß wir auch bei den allerbescheidensten Ansprüchen etwas haben müssen, das wir als unsere Stätte bezeichnen können. Wir haben bisher durch die verhältnismäßig günstigen Aussichten auf die Wohnung dies als Voraussetzung für ein gutes Beginnen betrachtet. Bisher hat es in unserem Plan gut hineingepaßt. Wenn es nur irgend möglich ist, soll es auch dabei bleiben. Damit wollen wir uns nicht ganz und gar abhängig machen. Wenn es not tut, werden wir vielleicht eine Zwischenlösung vornehmen müssen. Das aller-
5
dings muß eine Lösung sein, wenn auch nur eine vorläufige. Du hast da einen Vorschlag gemacht, der uns sicher helfen kann. Ich kann zwar von hier aus nicht entscheiden, ob es tatsächlich so möglich ist, doch glaube ich, wenn Deine Eltern Dich so beraten haben, wird es schon etwas Richtiges sein.
Es ist natürlich schwierig, etwas darüber zu sagen, wie meine Soldatenlaufbahn weitergeht. Ich hoffe, daß es so kommt: Etwa im Januar denke ich, daß die Rechnungsführerprüfung sein wird. Danach kann ich damit rechnen, daß eine Versetzung kommt. Mein Plan war nun so, daß ich ursprünglich jetzt Ende November den Heiratsurlaub genommen hätte und dann im Anschluß an die Prüfung den Jahresurlaub. Bis dahin hoffte ich, daß es mit der Wohnung soweit sei. Aber es kommt nun anders: Einmal läßt der Heiratsurlaub noch etwas
auf sich warten, zum andern wird es mit der Wohnung noch länger dauern. Deine Eltern haben also durchaus recht, daß beim Festhalten am ursprünglichen Plan eine wirkliche Lösung vorerst fraglich werden könnte. Ich muß sagen, daß ich ihnen für ihre mitgehende Sorge, die eine Fülle der Lebenserfahrung offenbart, sehr dankbar bin. Trotzdem glaube ich daß wir es wagen können und müssen, die beiden Schritte voneinander zu trennen. Wenn wir unsere Herzen fragen, so wäre es uns beiden das Liebste, wenn wir dieses auch in den beengten Verhältnissen des Krieges große Ereignis unseres Lebens so begehen könnten, wie wir es uns wünschen: in der rechten Einheit zwischen natürlichem und übernatürlichem Geschehen. Schön wäre es, wenn dazu die Voraussetzungen gegeben wären, die wir ja beide kennen. Dann müßte ich es so machen, daß ich den ersten Urlaub
6
noch ein klein wenig hinausschiebe, vielleicht bis Weihnachten. Dann hätten wir den Jahresurlaub ganz unabhängig wie eine stille Reserve. All das hängt von den Umständen ab, die uns gegeben sein werden. Damit wollen wir uns nicht innerlich abhängig machen vom Äußeren, sondern wir wollen uns so halten, daß wir bereit sind. Wenn dann die Umstände günstig sind, dann wollen wir den Schritt tun, der uns richtig erscheint. Wenn der Heiratsurlaub sich noch (Schluß bei Fliegeralarm) etwas hinzieht, werde ich versuchen, vorher Kurzurlaub zu bekommen.
Diese nüchternen Erwägungen lassen sich ja viel besser mündlich abmachen; aber hier ist es notwendig sie zu schreiben.
Nun liegt die Initiative wie so oft in den Kriegsverhältnissen wieder bei Dir. Auf Deine Schultern ist es gelegt, die günstigsten
Umstände zu erkunden und sie in die vorgebrachten Vorschläge einzubauen. Dann mußt Du nur das schreiben und wir werden uns entscheiden können.
Liebste, Dein Brief hat mich wieder so innerlich angefasst, daß ich nicht so nüchtern meinen Brief beenden kann. Du hast davon geschrieben, wie die Familie Rachop an uns gedacht hat. Du, wie gut doch die Menschen zu uns sind. Wenn uns nur einmal die Möglichkeit gegeben ist, all das mit gebührendem Dank zu vergelten!
Als ich las, daß Dir das Büchlein Guardinis: „Vom lebendigen Gott“ neu geschenkt wurde, durchfuhr mich ein freudiger Schauer. Ich kenne das feine Werk und es wird uns später noch viel zu arbeiten geben.
Marga, Du, wie leuchtet eine wundersame starke Sehnsucht aus Deinem Briefe