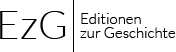Marga Broil an ihren Mann August, 16. Januar 1945
27. Reinstorf, den 16. Januar 1945
Mein lieber August,
täglich drängt es mich dazu, im Briefe zu Dir zu kommen. Einmal sind es die Gedanken und Probleme, die mich beschäftigen und dann erst loslassen, wenn ich etwas davon zu Dir hingetragen habe; dann muß ich Dir von den kleinen Geschehnissen und Erlebnissen meines Tages erzählen, der hier in so ruhigem Gleichmaß dahinfließt; zuweilen aber ist es garnichts „Besonderes“, was mich antreibt, Dir zu schreiben, sondern einfach nur das Verlangen, ein wenig bei Dir zu sein, mit Herz und Sinnen bei Dir zu verweilen und Dich spüren zu lassen, wie meine Liebe zu Dir zum Mittelpunkt meines ganzes Wesens geworden ist. Und wie es danach verlangt, sich auswirken zu können; einen Raum sucht, in dem es seine geheimen Kräfte wirken lassen kann, wo es gebraucht wird, wo es durch sein Dasein irgendwie heller, lichter, froher, und damit für die anderen leichter wird. Der eigentliche mir zu solchem Wirken geschenkte Raum ist das „andere Herz“, das Deine, in dem ja die gleichen Kräfte für mich walten. Die Erfüllung des vollen Menschenlebens muß wohl darin liegen, alle Fähigkeiten des Herzens, des Geistes und der Hände in den Dienst dieses Wirkens zu stellen in dem geheiligten Raum der Familie. In der Zeit der Trennung müssen wir uns bescheiden, nur dem Herzen und den sehnenden Gedanken ist ihr Tun vergönnt, dem ja weder Raum noch Zeit eine Schranke setzt. Aber auch die Kräfte des Leibes wollen ihr Werk tun, die Hände können nicht müßig im Schoße liegen, auch sie wollen ihr Werk verrichten. In diesen Tagen bin ich zum ersten Mal inne geworden, daß das Tun des Geistes allein keine Be-
friedigung geben können, oder besser gesagt, jetzt nicht mehr geben können, seitdem ich Frau geworden bin. Die kann mir nur dann werden, wenn Herz und Hände aus dem gleichen Beweggrund heraus ein gemeinsames Werk tun. Nun aber, da mir das nicht möglich ist, versuche ich ein wenig zu tun auf dem Platz, auf dem ich jetzt hier stehe. Es ist kein Tagewerk, auf das ich mit dem stolzen Bewußtsein abends zurückblicken kann, etwas geschafft zu haben. Es sind ja nur kleine Handlangerdienste, die ich hier verrichten kann. Wenn ich sie tue ist es gut, wenn nicht, macht sie die Bäuerin eben noch mit. Es wird angenehm empfunden, wenn ich da bin, aber wenn ich nicht da bin, würde es auch keine große Lücke geben. In meinem früheren Tagewerk wurde mein Selbstbewußtsein, das ohnehin nicht gering war, durch das, was ich leisten konnte, noch bestärkt. Die Menschen und auch die Geschehnisse und Forderungen sagten es offen und verborgen: du wirst gebraucht, du bist hier nötig, ohne dich geht es nicht. Und das kleine Menschenherz sonnte sich daran und war von seiner Wichtigkeit überzeugt. Nun aber lerne ich einsehen, daß es sehr wohn ohne mich geht, daß das Dienen, das Auf-dem-letzten-Platz-stehen und die Verrichtung all der kleinen Dinge, auf die ich früher vielleicht einmal etwas verächtlich heruntergesehen habe, mehr Kraft und innere Größe erfordern, als das noch so erfolgreich scheinende Tun. Es ist mir klar geworden, daß das Wort von der Dienmut, die ein Teil der Tugend der Demut ist, durchaus berechtigt ist. Ja, es gehört Mut dazu, klein und unbedeutend sein zu wollen und auf jede innere und äußere Bestätigung seiner selbst zu verzichten. In diesem Zusammenhang fällt mir der
Anspruch aus Goethes Faust wieder ein, den ich in Bansin wieder gelesen habe: „Zu große Forderung ist verborgener Stolz“. Wenn ich ganz ehrlich mit mir zu Rate gehe, muß ich gestehen, daß dies Wort auch in meinem Leben oft zugetroffen sein mag. Müßten wir uns nicht überhaupt mehr Rechenschaft über die Beweggründe unseres Denkens und Handelns ablegen? Wie leicht mag da die Eitelkeit und Selbstgefälligkeit sich einschleichen und den reinen, guten Beweggrund trüben. Nicht die Tat und ihr Erfolg sind ja das Entscheidende vor unserem Gewissen und vor Gott, sondern die Gesinnung, die Absicht, mit der es geschehen ist. Von daher gesehen, mag manches gescheiterte Bemühen, manches erfolglose Ringen mehr gelten als ein scheinbar vollbrachtes Tun, das aus einer weniger guten Gesinnung heraus geschehen ist. Liebster, heute ergeht es mir wieder so wie stets, wenn ich einmal das Wort an Dich gerichtet habe: Gedanken, die vorher noch im Unbewußten verborgen waren, kommen an die Oberfläche des Bewußtseins und nehmen im Wort Gestalt an, um zu Dir hingelangen zu können. Alles, was in mir ist, drängt zu Dir hin, der Brief kann ja nur ein Bruchteil davon sein. Wenn er manchmal so viel Probleme enthält, mache ich mir Vorwürfe, daß er so viel ernste Erwägungen enthält und so wenig Dinge zum Frohmachen, die doch eigentlich ein Brief an die Front haben muß. Aber ich bringe es nicht fertig, Dir gegenüber irgendetwas zu improvisieren, ich muß so zu Dir kommen, wie es mir gerade zu Mute ist und lieber ein Wort weniger sagen als eines, wo ich nicht ganz hinter stehen kann. Ich finde, gerade in diesen Tagen wiegt jedes Wort doppelt schwer, seine Forderung
auf ganze Wahrhaftigkeit ist besonders groß, da es jeden Tag der Bewährung ausgesetzt sein kann. Ich muß sagen, daß mir jetzt die Worte nicht mehr so leicht von der Hand gehen wie früher, ich halte sie gleichsam erst wie einen Spiegel vors Gesicht um zu prüfen, ob das Bild, das mir daraus entgegenblickt, auch der Wirklichkeit entspricht. Du aber kannst gewiß sein, daß es aus jener letzten Offenheit heraus gesagt ist, zu der nur die Liebe den Schlüssel in der Hand hält. Möge sie uns die Türen unserer Herzen weit auftun, daß wir uns auch in dieser Zeit der Trennung immer besser erkennen und mit der Erkenntnis auch die Liebe wachse, die ja die tragende Kraft unseres Lebens geworden ist. Gibt es aber jetzt etwas Frohmachenderes und Beglückenderes für uns als zu spüren, wie diese Kraft in uns wirkt und lebt? Liebster, das Bewußtsein, daß ich Dir gehöre, ist so stark in mir lebendig; Seele und Leib sind gleichermaßen davon durchdrungen, daß ich mein Leben in diesen Tagen des Alleinseins besitze, als besäße ich es nicht, daß ich es gleichsam nur für Dich verwalte. Was ich in meinen Mädchenjahren unbewußt bewahrt und gehütet habe, um es Dir in den beglückendsten Stunden zu schenken, das wahre ich nun ganz tief bewußt für Dich, aus der Erfahrung unseres vollen Menschenlebens heraus, das wir in der von Gott gesetzten Ordnung führen durften. Sieh‘, damit können wir auch jetzt in der Zeit der Trennung etwas füreinander tun, das die Kräfte des Herzens mit denen von Geist und Leib zu schöner Harmonie vereinigt. Aber alle Worte sind so arm, nur ganz leise kann die Sehnsucht in ihnen anklingen; Dein Herz aber nimmt den leisen Ton auf und ahnt die ganze Fülle der Melodie, die dahintersteht.
August, ich habe Dich lieb und bete für Dich
Deine Marga.