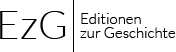August Broil an seine Frau Marga, 28. Januar 1945
2 O. U. den 28. Jan. 1945.
Meine liebe Marga,
heute ist Sonntag, und nach den Umzugsarbeiten der Woche bin ich heute – hoffentlich – wieder ein paar Stunden ganz für Dich da. Es waren einige für das Briefschreiben recht unfruchtbare Tage, die mir garnicht angenehm waren. Wenn ich nach Ablauf des Abends im Bett meinem Kameraden Gute Nacht gesagt habe, dann fängt noch eine kurze gute Weile für mich an so zwischen Schlafen und Wachen, und dann bin ich oftmals recht schön nahe bei Dir. Aber das ist an manchen Tagen oft nur diese kleine Weile, wenn ich die kurzen Gedankensprünge des Tages nicht einrechne. Und oft muß ich mit diesem Wenigen zufrieden sein, das oft genug doch sehr viel ist. Dann sind aber da noch einige andere Höhepunkte gewesen, und das waren die Stunden, wenn Deine Briefe ankamen – sie kommen jetzt ziemlich rasch und pünktlich und der Reihe nach, manchmal wohl zwei zu gleicher Zeit. Ehrlich muß ich sagen, daß es mir manchmal leid tut, in welche äußere Situation sie hineinkommen. Dann bleibt mir oft keine andere Möglichkeit als sie zuerst flüchtig zu lesen, überm Lesen werde ich dann oft eine solche Innigkeit gewahr, die wahrhaft nicht in jegliche Stunde hineinpaßt. Dann lege ich am Schluß Deinen, ach so lieben Brief still und nachdenklich in meine Tasche, ihn für eine günstigere Stunde aufbewahrend. Die kommt aber dann eines Tages ganz gewiß, und dann ist der Brief mir wie neu und ganz anders. Das sind ja die Bedenken,
die auch Du schon oft geäußert hast. Doch wir können diese Schwierigkeiten nicht einfach aus dem Wege räumen, sondern sind gezwungen, sie nach besten Kräften zu überwinden. Ähnlich ist es mit der Beantwortung der Briefe. Wenn ich einen Deiner Briefe lese, dann ist meist keine Gelegenheit dazu zu schreiben, sondern zum Briefschreiben sind es meist ganz andere, vom Lesen unabhängige Gelegenheiten. Dann mache ich es jetzt oft so, daß ich auf die Umschläge der Briefe, zu denen ich unbedingt etwas sagen müßte und möchte, eine kleine Notiz mache. So habe ich jetzt noch einige Briefe vor mir liegen. Ich nehme einen Brief aus der Adventszeit vor. (Nr. 8) Du sprichst von dem Zwiespalt des Christenmenschen zwischen weltlicher Pflicht und der gleichzeitigen Hinwendung zu dem Tun für das Übernatürliche. Eigentlich liegt in dieser Problemstellung schon die Antwort. Denn was soll die weltliche Pflicht des Christenmenschen anders sein als Hinwendung zum Übernatürlichen. Wir haben doch unser ganzes Sein von unserem Schöpfer empfangen, und alles was ist, das ist doch letztlich von Ihm. Wenn wir also in rechter Gesinnung unsere Pflicht tuen, dann muß es stets richtig sein. Aber es kommt ja immer die menschliche und persönliche Veranlagung hinzu, wie Du auch von mir schreibst, daß ich geneigt bin, mich leicht zu sehr nur an die weltliche Pflicht zu halten. Das möchte ich für mich gar nicht anders haben. Aber richtig ist es, wenn ich mir selbst Mühe gebe, die rechte Gesinnung
so hineinzubauen, wie wir es als richtig erkannt haben.
Du sprichst so feine Worte von der Hoffnung, die in uns sein soll. Wohl zu keiner anderen Zeit sind wir auf diese Hoffnung stärker angewiesen gewesen als jetzt. Zwar ist diese Hoffnung jetzt nicht mehr das, was wir vielleicht in unseren Wünschen träumen. Es ist schlechthin die Hoffnung; die Hoffnung, daß wir nie ganz verlassen sind, daß trotz aller Losgelöstheit von äußeren Bindungen die Bindung an die ewigen Worte des Menschen und der Menschheit nie zerstört werden kann, daß Gott uns durch alle Wirrnisse hindurchführt. Es wird sich einmal alles Ungewisse und Ungelöste klar vor uns hinstellen, und dann werden wir sehen, daß unsere Hoffnung nicht vergeblich war.
In Deinem 14. Brief erzähltest Du mir davon, wie Abraham dem Ort seines Sohnesopfers den Namen „Gott sieht“ gibt. Ich habe über diesen Namen und seine Bedeutung nachgedacht. Ja, Gott sieht, und daß Gott sieht, das spüren wir doch so oft in unserer Seele. Manchmal ist es so, daß wir meinen, uns wirklich zu kennen, und unsere Gesinnung für recht und wahr halten. Aber meist lassen wir in uns noch immer eine kleine Öffnung frei, durch die wir hinausschlüpfen wollen, wenn wir zur Bewährung gefordert werden. Abrahams Gesinnung aber war so, daß er sagen konnte: Gott sieht. Er hatte im tiefsten seines Herzens seine wahre Opfergesinnung erkannt und diese Gesinnung wurde für das Opfer selbst genommen. Wir können
diese durchdringende Tiefe des Gottesblickes garnicht erfassen und begreifen; allzu oft sind wir menschlich zu befangen und in der Tiefenerkenntnis unseres Selbst beschränkt, daß wir vor einem großen Geheimnis stehen. Es kann für uns Menschen nie ein Ende des Forschens und Schauens nach dem Innern geben, weil es ein so großes Geheimnis ist. Wir werden auch nie ganz in die Tiefe hinabsteigen können; aber unser Bemühen zu immer tieferer Erkenntnis und rechtem Schauen muß riesengroß sein. Das wissen wir beide ja auch von den Gedanken um die Offenheit und letzte Ehrlichkeit in Bezug auf unsere Gemeinsamkeit allzu gut. Und wir wissen auch welchen Wert uns dieses Letzte an Offenheit und Ehrlichkeit bedeutet. Für uns beide kommt dazu noch nicht allein das rein Menschliche, sondern das Bewußtsein des Schauens Gottes, auf den hin wir unsere Gemeinsamkeit auszurichten haben. Leider, so muß ich jetzt oft sagen, ist es bei mir so, daß ich recht wenig die Gelegenheit habe tiefer und inniger diesen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Jetzt, da ich diesen Brief schreibe, denke ich immer wieder daran, ob ich das auch alles so schreiben kann und darf. Es ist nicht zu verkennen, Liebste, daß das Leben in der Fremde und unter den Kameraden mir oft genug große Schwierigkeiten bereitet und daß ich oft denken muß, ob ich all mein Tun und Handeln, mein Reden und Wirken im Hinblick auf unsere Gemeinsamkeit verantworten kann, so wie ich es tue. Oft genug möchte ich wünschen, daß Du bei mir wärest, und ich glaube sicher, dann würde manches
anders sein. Es ist das, wovon man die Frauen oft sprechen hört, daß die Männer erst wieder ganz anders werden müssen, um in die volle Gemeinsamkeit zurückkehren zu können.
Der heutige Mensch ist aus der altgewohnten Gemeinschaft vollkommen herausgerissen. Du hast in Deinem 21. Brief darüber geschrieben, wie im Anschluß an das Wiedersehen in Bansin Dir diese Gedanken besonders nahe gingen. Als wir noch in Köln mit unseren Lieben und Freunden zusammen waren, da war unser Leben getragen und erfüllt von dem Denken und Leben in dieser Gemeinschaft. Jetzt aber sind wir ganz auf uns selbst gestellt. Wir sind damit zwar von vielen Dingen unabhängiger und unbefangener, aber wir wissen auch, was uns die Gemeinschaft bedeutete, was sie in uns wirkte und aufbaute. So kann ich verstehen, wenn Du von einer großen Sehnsucht sprichst, die Du jetzt nach der Bindung in der Gemeinschaft empfindest. Wir werden in der Zukunft uns darum bemühen müssen, überall dort wo wir sind, uns eine Gemeinschaft zu bauen und uns den befruchtenden Bindungen mit Menschen zu unterwerfen. Ein Einzelgängertum würde uns stets belasten, wenn wir es auf die Dauer auf uns nehmen würden.
Meine Liebste, nun habe ich in diesem Brief hineinverwoben all das, was mir aus Deinen Briefen seit längerer Zeit noch als unbeantwortet am Herzen lag. Es ist wieder ein Brief der Gedanken geworden, das Fühlen im Herzen kommt dabei garnicht recht zu Worte, und ich meine stets, mit einem solchen Brief könnte ich Dir nie recht tief
an Dein Herz anklingen. Wenn ich lese, mit welch glühender Kraft Du Deiner tiefen, schönen Sehnsucht in Worten Ausdruck zu verleihen vermagst. Manchmal habe ich nach dem Lesen Deiner Briefe, besonders der letzten, staunend dagestanden und zu mir gesagt: was hat die Sehnsucht und die Liebe mit Dir gemacht, daß sie Dich zu solchen Worten befähigt, Dich Marga, die Du von Natur herbe und verschlossen bist. Ja so erkenne ich immer mehr Deine wahren Tiefen und die Kraft, die Dich zu mir hinzieht. Es ist jetzt schwer für mich, das rechte, mitklingende Wort Dir zurückzugeben; noch ist dafür nicht die rechte, gute Stunde. Aber genau so wie ich weißt Du, daß sie kommt, und wenn sie da ist, dann werde auch ich so singen können wie Du, meine Liebste. Ach ich sehne mich sehr nach einer solchen Stunde, die ich mir von allem äußeren Gebundensein unabhängig gestalten kann, in der ich dann ganz bei Dir bin, bei Dir, die Du mich so lieb hast.
Dein August.
Ich bin sehr in Unruhe über die Lieben in Amelunxen. Oftmals habe ich hingeschrieben, aber noch gar keine Nachricht bekommen, genau wie Du. Was mag dort geschehen sein? Auch an Heinrich habe ich nach Leverkusen geschrieben. Auch Bruno hat lange nicht geschrieben.