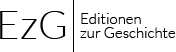Johannes Maaßen an Kaplan Stiesch (?), Februar 1942
Lenggries/Obb., im Februar 1942.
Lieber Freund!
Du suchst das außerordentliche, u. nun stößt Du – wie Du schreibst – fast jeden Augenblick an mancherlei Schranken, die Dir gesetzt sind. Schranken von Außen: dem Soldaten sind seine Wege vorgeschrieben, er kann nicht, wie er will, selbst die einfache menschliche Begegnung ist ihm vielfach durch Äußerlichkeiten, die aber unumgänglich sind, unmögllich gemacht. Die Grenzen eines Seminars sind ein Pradies an Freiheit gegenüber den Grenzen der Kaserne u. des strengen soldatischen Dienstes u. Befehls. Noch schwerer aber wiegen die Schranken von Innen her: auf einmal ist das Menschenbild, das Du hattest, ins Wanken geraten. Du siehst eine Wirklichkeit rings um Dich, die dich erschrecken macht. Der Mensch ist aus dem Fugen. Und Du kamst zur Welt, um sie mit einzurichten! Aber wo beginnen? Wie oft will man Dich gar nicht hören, wie gleichgültig nimmt man dich an, wie wenig Bereitschaft findet Dein Tun und Dein Wort. Wie tief ist das, was uns Christen verbinden sollte, hinter einen Vorhang hinabgesunken. Wie versandet die innere Welt. Kann man noch Brunnen graben nach der Tiefe zu? Aber wie lange muß man graben u. wie unablässig bemüht sein? Welche Verschüttung, welch ein Trümmerhaufen, wie viel nur noch oberflächlich, wie viel gar nicht mehr Geglaubtes. Ist im Menschen noch ein Ort, wo Gott seine Wirkung tun kann? Oder ist das äußerste schon erreicht, der Weg beschritten, der ins Heillose führt, ins Nichts u. in der Verzweifelung enden muß? Und wo stehst Du selbst? Kannst du das Übermaß des Glaubens, das Gott in einer solchen Stunde mehr als je von Dir als Gabe erbittet, aufbringen? Kannst Du Dir noch vergegenwärtigen, dass Gott um der Wenigen willen, die ihm getreu sind u. ihn in seinem Namen bitten, das Schicksal von Vielen zu wenden vermag und sie zu heilen bereit sein könnte? So viele Fragen, so viele Grenzen, - ich weiß es. Denn wir können das Dunkel nicht heben, das über dem Kommenden liegt. Wir wissen nicht, was Gott der Christenheit in Europa in den Menschen bereitet. Und dieses Nichtwissen ist eine Begrenzung die vielleicht schwerer zu tragen ist, als anderes, was uns von außen her bedrängt: denn wir meinen, wir müssten das Außerordentliche dann zumal tun können, wir wir nur wenigstens den Preis wüssten, um dessenwillen unser Einsatz geschieht, und statt dessen verlangt die Stunde den fraglosen Einsatz unseres Seins, das Aussäen ins Unbekannt, die Hingabe ans Ungesicherte u. Unenthüllbare.
Dies alles bedrängt Dich. Und Du möchtest es durch das Außerordentliche Deines Tuns und Deiner Antwort unmittelbar lösen, wie es Deiner jungen u. unmittelbaren Art entspricht, aber nun musst du lernen, und zwar als Lebenstatsache, die Du immer als spannungsgeladene Wirklichkeit bei Dir bewahren sollst: das gesicherte Wissen ist ebenso wie das Außerordentliche nicht des Menschen, sondern ist Gottes. Uns Menschen ist in allem eine Grenze gesetzt, und da dies für alle Dinge und Kreaturen gilt, so wollen wir uns an diesem Gesetz auch trösten und es keinesfalls beklagen. Uns kann es genügen, zu wissen, dass diese Grenzen von einem Größeren errichtet sind, dem wir vertrauen können, und zu glauben, dass uns, sofern wir vertrauen, solche Grenzen nicht hemmen, sondern an ihnen erst das Tor sich öffnet, das uns den Weg in das Eigentliche offen macht. So wie hinter der Grenze des Todes das Tor ins Leben sich weitet, nach dem Uneigentlichen das Eigentliche sich auftut, sodass wir wohl sagen dürfen, dass nach jedem Tod, nach jedem Verzicht wir dorthin gelangen, wo Gott erst ganz eigentlich seine Geschichte in einem vollendeten und auf die letzte Vollendung hinzielenden Sinne mit uns treibt.
Jegliche Grenze öffnet dem Glaubenden eine neue Welt der Erfahrung, immensester neuer Wirklichkeit und weitet ihm den Blick in das Ungemeine, eben erst Erahnte, das als neues Feld sich uns anbietet, darin wir wirken sollen, solange es Tag ist. Nur dem, der darauf vertraut, dass der Sinn wie alles Lebens so auch all seiner Begrenzungen von oben kommt, und so von uns fraglos und bereit angenommen werden kann, wird in den vielfachen Grenzen, die uns allenthalben gesetzt sind, nicht Hemmnis und Aergernis begegnen.
Zu dem kommt hinzu, dass wir überdies vertrauen, dass wir nicht über
unsere Kraft versucht werden, was doch wohl heißt, dass alle Last u. jegliche Beschwernis, die auf unsere Schultern gelegt sind und immer aufs Neue gelegt werden als des irdischen Daseins irdischer Anteil, - dass alle Begrenzung und alle Erschwernis nur sind bis zu einem gewissen tragbaren Maße, mag es uns Kleingläubigen im menschlichen Verstand auch vielleicht manchmal „maßlos“ erscheinen wollen. Bis zu einem Maß, das wir zuletzt nicht nur zu ertragen vermögen, sondern das uns auch größer macht.
Begrenzung und Erschwernis gehören in den Bereich des Übels. Aber da wir bitten, dass der Vater uns vom Übel erlösen möge, dürfen wir auch vertrauen, dass wir solcher Erlösung teilhaftig werden und dass es uns, wenn wir den Bereich des Übels unablässig betend ihm vergegenwärtigen, gnadenhaft geschenkt wird, zu Zeiten, die der Herr als der Herrschende über Mensch und Zeit bestimmt, unsere Grenze gesprengt, unsere Beschwernis – und sei es auch nur für eine Weile – aufgehoben, unsere Last an Versuchungen und Wirrnis leichter gemacht zu sehen. Wenn wir bitten, dass Gott uns nicht in Wirrnis führen möge, so wissen wir doch zugleich, dass der Versucher uns sich nahen kann als schöner Engel des Abgrunds in vielerlei Gestalt und Gewand und unter mancherlei Vorwand, und dass er gerade dort seine Macht aufzurichten und sein Wirken anzusetzen sucht, wo unsere großen Möglichkeiten und Fähigkeiten beschlossen sind, die er sich zunutze zu machen bestrebt ist. Aber es ist ihm keine endgültige Macht gegeben, denn Gott lässt uns bitten. Und wer uns bitten lässt, ist uns väterlich nahe. In des Menschen Freiheit ist der Kampf mit den Dämonen gegeben. Gott wollte die Größe des von Ihm geschaffenenen Menschen nicht antasten (und lieber die seine, wenn auch nur scheinbar, eingeschränkt sehen), - so lässt er ihn denn stehen an dem Ort, wo er frei sich für den ewigen Gott oder für den Versucher entscheiden kann.
Gott zwingt uns nicht. Aber er wollte wohl auch, da er die menschliche Natur, nachdem er sie wunderbar erschaffen und noch wunderbarer in Christu wiederhergestellt hatte, wie auf das Kampffeld der Geschichte stellen, damit wir, die wir Brüder Christ geworden sind, mit ihm brüderlich auch das Kreuz auf uns nehmen, und, also teilnehmend an der Not wie an der Glorie des „geschlagenen Gottesknechtes“, die Last des Übels als Prüfung und notvollen Weg zu Gott ertragen und im Opfer zur Wandlung ins Heil bringen. Wir sollen bitten, dass Gott uns nicht in Wirrnis führe, und wir wissen aus dem Jakobusbrief, dass Gott selbst niemanden zum Bösen versucht: Aber er will uns doch auch in Freiheit entscheiden lassen, und so nimmt er uns nicht von dem Ort, wo der Versucher sein Werk tun kann. Und nun erst erweist sich unser Vertrauen auf ihn als unsern Herrn, dem Herrn der Geschichte und dem Herrn alles dessen, was ist: wir sollen bitten, aber wir sollen auch vertrauend wissen, dass Gott unsere Bitten zu Seiner Zeit und in Seiner gänzlich unerforschlichen Weise erhört. Diese Bitten des Vaterunsers sind – wie alle Bitten des Herrngebetes – ins Geheimnis genommen, das sich uns erst drüben enthüllt, wenn wir schauen von Antlitz zu Antlitz. Noch aber ist auch hier Grenze, - als geheimnisvolle Teilhabe am Kreuz. Doch mit der Begrenzung, mit der Wirrnis, der Versuchung will Gott uns, da wir in ihnen teilhaben am Kreuz, uns zuletzt über alle Grenzen hinweg der Glorie des Sohnes anverwandeln. Da wir in den gleichen Versuchungen und Schmerzen wie Er leiden und uns die gleichen Grenzen gesetzt sind, wie sie Ihm in Seiner Menschlichkeit gesetzt waren, und wie Er sie auch auf sich nahm, ohne Seinen Engeln zu befehlen, trinken wir mit Ihm den Kelch der Leiden wie der Verheißungen des Heils und werden so hinübergeopfert zum Vater im Opfer des Sohnes: durch Ihn, mit Ihm und in Ihm, wie wir es hineingeben in das Opfer am Altar, welches die Erinnerung an Sein Leiden, seinen Tod, Seine Darstellung in der – menschlich gesprochen – äußersten Sinnlosigkeit, durch die Zeit wachhält und begeht.
In solchem Tun und solchem Glauben und Vertrauen ist uns in der Begrenzung doch die eine Gewissheit: die der Teilhabe am Erlösungsvolk in der Welt und daran, dass wir bereiten die Ankunft Christi, und so die inmitten all ihrer und unserer Begrenzung und eben durch sie hindurch, Parcusie entgegentragen. So dürfen wir wohl glauben, dass diese wenigen
Grundtatsachen, die mit einer – für das selbststolze Wissen der Welt – wahrlich erbarmungsvollen Schlichtheit im Credo ausgesagt sind, die Welt zusammenhalten. Und auch hier darf wohl gelten, die Seligpreisung, die an jene ergeht, die nicht stolz sind auf ihr Wissen, sondern verspüren die Armut des Geistes und wie er bedürftig ist der gnadenvollen Eingießung von oben, die der Christ annimmt in Wort und im Sakrament, um in solchem Offensein nicht mehr egozentrisch zu denken und zu planen, sondern – von Gott her erfüllt zu sein und in solchem durchgnadeten Sein Ihn bezeugen zu dürfen im Ertragen dessen, was ihm in seinen Tagen widerfährt; und nicht nur an äußerer Unbill, die ja auch nicht eben gering ist und doch noch gegenüber dem, was unsere Herzen schwer macht, erträglich genannt werden darf.
Was also könnte gegenwärtiger sein als das christlichen Gegenwartsverhältnis, das übrigens ja auch – ein Erweis der fortlebenden Gegenwärtigkeit des Herrn In der Kirche – im täglichen Liturgiegebet von einer spannungsgesättigten Gegenwart in der Zeit steht, durch sie hindurch geht und sie lenkt in das Hinüber und Jenseits aller Zeiten: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“
Wer so hört; in die Zeit und in ihr zugleich das Rauschen des Jenseits, für den ist immer und in allem, nicht zuletzt in der Erfahrung menschlicher Grenze, der Einbruch Gottes in die Zeit, adventus Domini, denn er verspürt die Geheimnisfülle der Dreieinigen Wirklichkeit des Herrn als stete Gegenwart und stets im Kommen. Er vernimmt durch alle Verlassenheit und alle unsägliche Mühsal unserer Schmerzen und Nöte, durch die Unrast unserer Süchte und über der Last, die uns bedrängt, ein tragendes und gewisses Wort der Verheißung. Mit uns rufend nach dem Heilbringer – denn dies war Er und ist Er zunächst: Seelvater und nicht magister: - macht sich die Kirche vor dem Vater zu unserm Anwalt. Und die Antwort des Vaters, mit der Er sich selbst im Sohn uns schenkt, ist ein „Aufscheinen“ Seiner helfenden und heilenden Macht, die wir uns vergegenwärtigen sollen, indem wir sie annehmen, wie sie uns angeboten ist, - und dies genügt. Damit vollzieht sich die Epiphanie, das Aufscheinen des Heilbringers und Arztes in der Welt, zugleich als ein Aufscheinen in uns am getrauften und gefirmten Christenmenschen, und ein Aufscheinen durch uns in die Welt. Es ist das Aufscheinen des Herrn im Aufscheinen des Jüngers, der keine von innerweltlichen Gesetzen her graduierte, selbstsichere Vollkommenheit des sittlichen Tuns besitzt, sondern sehr viel schlichter, nämlich von Gnade geführt, durch alle Zerbrechlichkeit hindurch sich der Vollkommenheit entgegenblüht, welche nicht seine Vollkommenheit ist, sondern die des allmächtigen Herrn, welcher dem Meer, den Wellen und dem Sturm zu gebieten vermag.
Da wir der Ankunft des Herrn entgegenharren, ist sie zugleich schon im Eintritt Christi in die Welt als geschichtliche Wirklichkeit außer uns und durch die Taufe in uns für immer vollzogen und tut sich durch uns vor der Welt auf: als unausgesetzte Sprengung der Grenzen in dauernder Gegenwart und Ankunft. Sie geschieht Tag um Tag, indem wir den erlösten Menschen in uns und im andern unablässig, von Gnade getrieben, wiederherstellen und darleben: auf den „Knien unseres Herzens“ liegend am Abgrund der Zerstörung und Stimme des Rufenden in der Verlassenheit. Wir vergegenwärtigen so den heilenden Herrn im Überwinden der Schwermut, in der Tapferkeit des Ertragens dessen, was uns in uns und ringsum bedrängt. Im Geschenk eines helfenden Wortes für die, welche am äussersten Rande leben; einer Tröstung und liebevollen Zuneigung, die um der Liebe Gottes willen uns mit dem Blick auf Seine konkrete Gegenwart nicht sich selbst meint, sondern den Menschen, die unsere Nächsten sind, immer wieder neu und trotz aller Enttäuschung sich zuwendet. In Geduld und Gelassenheit, in Heiterkeit und in unablässig betendem Vertrauen, mit einer Gebärde, die das einfache Dasein des Christen bezeugt: Vergegenwärtigung der humanitas Christi als eines neuen Menschenbildes, darin der Mensch in Ganzheit von Gott in Besitz genommen ist, „besessen“ ist von Gott, um so die ewige Liebe, mit der Gott die Welt in jeder Stunde ebenso liebt wie in aller Zeit, durch unsere stille, aber immer gegenwärtige menschliche Existenz darzulegen, als mandatum et opus novum, das der Sohn uns offenbar gemacht hat, da er kam, „um alles neu zu machen“.
So geschieht ein dauernder gnadenhafter Vollzug der Gegenwart des Herrn und seiner Ankunft, und wir beten nicht umsonst, dass der Herr bei uns bleibe, da der Tat sich geneigt hat. Dieser Abend, zu dem wir die Gegenwart des Herrn erbitten, ist unser brennendster und lebendigster u. gegenwärtigster Tag, in welchem die schönste Gebärde der Menschlichkeit Christ sich eint mit seiner Gotteswirklichkeit: da er uns das Brot bricht u. teilhat mit uns an der Gegenwart unseres Tisches. Eine Gebärde und eine Wirklichkeit, die uns bleiben mögen: als unter uns seiende Mächtigkeit, als ein Aufscheinen der Menschlichkeit Christi und Göttlichkeit des helfenden Herrn, als Fülle der Ewigkeit im schmerzlich bewegten Tag, als Sprengung unserer Begrenzung und Einbruch der Geheimnisse des Grenzenlosen: der Dreieinige Gott alles in allem.
So u. unter solchen Gedanken sollst Du tun, was Dir an der Stelle, wo Du eben stehst, aufgetragen ist: als helfender Dienst, als Begegnung mit den Menschen Deiner Umgebung, die Du lieben sollst als den Nächsten u. also wie Dich selbst. Lass rings um Dich nicht untergehen die lautere u. leuchtende Menschlichkeit Christi, die für so viele heute zum Saum des Mantels zu werden vermag, an dem sie seine Göttlichkeit ergreifen. Du hoffst, dass Dir einmal die Gnade geschenkt sein wird, Priester zu werden und Dein „Adsum“ vor Gott zu sprechen. Lass dieses Wort, mit der ganzen Schwere u. wunderbaren Größe seiner ins heilende Werk am Mensch u. Welt sich hineinschenkenden Gegenwart des „hier bin Ich“, als Strom einer sich unverzagt hinopfernden Liebe, als nie versagende Wärme u. Festigkeit, als Mitte einer in jeder Situation neu u. unmittelbar sich formenden Gewissensbildung, im Innersten Deiner Existenz,in Deines „Herzens Herzen“ als Antwort auf den je sich wandelnden Anruf des unwandelbaren Herrn immer gegenwärtig zu sein. Und nimmt, so dem Zukünftigen, das Gott Dir bereiten will, tapfer u. unverzagt entgegeneilend, in Dein Gebet, was Dir an Dingen u. Menschen, an Tun u. Lassen gegeben ist: „Ob wir nun leben oder ob wir sterben, - wir sind des Herrn!“ Und lass in all Deinen Sorgen um Dich u. diejenigen, die Dir geheimnisvoll anvertraut sind, Gott der unsichtbare Dritte sein, in dessen bleibender Gegenwart sich vollzieht u. vollendet, was Deine Geschichte, die Dir eigens u. allein vom Herrn aufgegebene, ausmacht.
Nimm in Deine Gedanken und in die Bewegungen Deines Herzens bis hinein in die innersten Kammern Deiner innersten Seele ein Wort, das Gott zum schmerzdurchzitterten, von Leiden überwältigten Job als getreue Verheißung gesprochen, zu ebendemselben, der vom himmlischen Vater sagen konnte, er werde auf ihn hoffen, selbst wenn dieser Vater ihn töte -, und nimm auch Du es als ein Wort des nieversagenden, immer wieder neuen Trostes und der ausharrenden Hilfe, als Geleit auf den gefahrvollen Weg Deiner schweren Tage und als eine Tafel, die Dir an den Grenzen die Dich verwunden wollen, tröstend aufgerichtet ist: „Wenn Du dein Herz auf Gott richtest und nach IHM deine Hände ausstreckst, wenn du das Unrecht entfernst, was an deinen Händen klebt, und den Frevel nicht in deinem Hause duldest: dann kannst du getrost dein Antlitz erheben, - du stehst fest und hast nichts zu fürchten. Sei gewiß, du wirst die Mühsal dann vergessen. Sonniger als der Mittag strahlt dir dann das Glück deines Lebens, und das Dunkel ringsum wird dir aufgehellt sein zum lichten Tag.“
Ich bin sehr teilnehmend an allem, was Dich bewegt, Dir herzlich und mit guten Wünschen und Grüßen nahe.
Dein Johannes Maaßen.