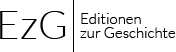Peter Pehl an Kaplan Stiesch, 26. September 1942
1. Blatt 26.9.42
Lieber Herr Kaplan.
Meine Eltern sagten mir, daß ich Ihnen zu wenig schreiben würde. Nun ja, schreiben tue ich nun mal nicht gern. Aber den Gefallen will ich Ihnen nun mal tun. Da will ich mal von vorn anfangen. Also in Lüttich wurde ich bei der leichten Infanteriegeschützabteilung ausgebildet. Es war so ganz schön, nur verstand ich mich schlecht mit dem Unteroffizier. Am liebsten hatte ich den Unterricht. Unsere Geschütze waren 7,5 cm im Kaliber. Allerdings war ich wegen der Brille ein schlechter Schütze. Die Märsche waren auch ganz anständig: 40 bis 50 km Märsche waren nicht selten. Aber in Lüttich selbst war es sehr schön. Wer Geld hatte, konnte sehr schön essen gehen: Kalbsbraten, ….., Leber u.s.w. Alles ohne Marken. Auch die Verpflegung in der Kaserne war im Gegensatz zu den Kasernen in Deutschland sehr gut. Dafür war aber der Dienst sehr streng. Dann wurden wir abgestellt und kamen zum Marschbatailllon. Da war ein wirklich faules Leben. Was ich so mit den Lütticher Kameraden erlebte war nicht schön. In die Kirche kam ich fast nie; denn Sonntag-Morgen machten wir unsere Sachen in Ordnung, sonst fielen wir Montag immer auf. Es waren nur wenige gute Kameraden in meiner Stube. Diese sind fast alle schon in Russland gefallen. Die anderen Kameraden waren nur Formkatholiken. Die schimpften auf Priester und Kirche. Des Sonntags gingen sie meistens
in das sog. Puffs. Da verkehrten Sie mit den Hurenweibern von Lüttich. Unser Hauptmannallerdings ein guter Katholik. Aber was wollte er gegen so viele machen. Dann gings ab. Quer durch Deutschland fuhren wir: Lüttich – Düsseldorf – Hamm – Magdeburg – Berlin - ?? – Dirschau (?) (2 Tage Aufenthalt) – Marienburg – Königsberg – Tilsit - ? – Riga – Pleskow – Rowaja Russa. Die Marschverpflegung war prima: täglich 750 gr Brot, 500 gr Wurst und 12 Zigaretten, weiter 150 gr Butter oder Schmalz. Dann gings zur Leitstelle der 8. Division 40 km hinter der Front. Bis dahin waren es 48 km. Bei glühender Hitze mussten wir den Weg zurücklegen. Manch einer ist dabei zusammengesackt. Dann wurden wir eingeteilt. Mich steggten sie in eine Radfahrerschwadron. Da hieß es nicht mehr Schütze, sondern Reiter. Wir sollten dort unter einem kaum 19jährigen Leutnant Frontausbildung erhalten. Dabei war der Leutnant noch nie richtig an der Front gewesen. Halt da habe ich noch was vergessen. Damals in Lüttich wurde ich vom Kompaniechef für einen K.O.B. Lehrgang vorgeschlagen. Aber ich habe es abgelehnt. Vielleicht war es eine Dummheit, vielleicht aber auch gut so; denn das habe ich in Russland selbst gesehen – zu einem Offizier gehört schon etwas. Ich hätte dabei eine Verpflichtung auf mich nehmen müssen und das konnte ich doch nicht. Nun in Russland sollten wir erst 4 Wochen Frontausbildung bekommen. Die Herrlichkeit dauerte aber nicht allzu lange. Bald schon wurde es anders.
Wir hatten noch kein Fahrrad gefahren und waren doch Radfahrschwadron, da hieß es in der 2. Nacht unseres Daseins bereits: fertigmachen. Von 3 Uhr morgens ging es los und wurde nicht eher Halt gemacht bis wir die ersten Russen trafen. Zunächst hatten wir Stützpunktkämpfe. In der Nacht mussten alle Wache stehen; keiner konnte mehr als 3-4 Stunden am Tage schlafen. Oftmals wollten uns die Russen überfallen. Aber wir wehrten sie immer ab. Wir selbst machten einmal 3 Angriffe gegen einen russischen Stützpunkt. Aber wir mussten immer zurück; sonst wären wir umzingelt worden. Sie können sich das ja nicht vorstellen: Nur Sumpf und dazwischen ein paar kleine Kiefernwäldchen. Im Wasser musste man schlafen, im Wasser angreifen und verteidigen, und im Wasser musste man essen. Wenn man Verpflegung und Kaffee-holen ging, so musste man eine Stunde durch Wasser waten. Dabei hatte ich noch zerschlissene Stiefel. Immer hatte ich nasse Kleider und Strümpfe. Schließlich konnte ich die Stiefel nicht mehr außiehen – die Strümpfe waren verfault in den Stiefeln und die Füße dadurch angefault. Trotzdem musste man die verfluchten Spähtrupps mitmachen. Da kostete es immer Leute. Dann war auch noch der Stützpunktkampf vorbei und wir bezogen die provisorische Stellung. Der Russe lag 100 m vor uns. Es war eine Wechselstellung d.h. einmal hatte ein Russe die Stellung, ein andermal der Deutsche. Wir lagen in einem Erdloch zu zwei oder drei
Mann. Der Russe schoß tüchtig. Dann kam der für uns so verhängnisvolle Angriff. Frühmorgens um 2 Uhr begann ein Trommelfeuer, daß man meinte, der jüngste Tag sei angebrochen. Mein Erdloch wackelte bei jedem Einschlag, bis es endlich über mir zusammenkrachte. Aber ich hatte mich schnell wieder herausgebuddelt. Da erhielt ich einen furchtbaren Schlag gegen den Kopf. Aber es ging noch mal gut: Ein Granatsplitter hatte meinen Kopfhelm aufgerissen. Bißchen tiefer und… . Dann griffen die Russen an. Sie konnten in den Graben eindringen, aber das Dorf hielten wir doch. Der Russe wurde zurückgeworfen, da kamen 10-15 russische Trups. Wir hatten keine Pak und leider war auch die M.G. Munition ausgegangen. Zu allem Unglück fiel auch noch unser Schwadronschef. Da gab der Unteroffizier den Befehl: Rette sich wer kann. Treffpunkt Flussufer. Wir liefen durch den Sumpf zum Flussufer. Hinter uns russische Tanks und zwischen uns Granateinschläge. Des Mittags erhielten wir Artillerieunterstützung und unser Gegenstoß begann. Dabei hat es mich nun am Spätnachmittag erwischt. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Hölle rausgekommen bin. Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Rechts und links schlugen Granaten ein, daß die Splittern nur so umhersurrten, und doch wurde ich immer wieder verschont. Es hätte ja viel schlimmer kommen können nur diese kleine Handverletzung. Aber Gott hat es sicher anders gewollt.
Ich kam dann zum Verbandsplatz. Von dort gings weiter: Auto, Flugzeug, Eisenbahn, Schiff und wieder Eisenbahn. Das waren die Transportmitteln, die wir benutzten. Jetzt bin ich nun hier und gut aufgehoben. Es wird wohl eine Weile dauern, bis ich hier herauskomme. Die Kameraden, die ich in Russland bei mir hatte, waren meistens frontmäßig d.h. sie waren in einem unzivilisierten Staat und das hatte auch auf sie, ja auf uns alle eingewirkt. Die meisten waren gottgläubig oder nur Formkatholiken. Ich muß leider sagen, daß ich in unserer Schwadron keinen von meiner Gesinnung gefunden habe. Aber Kameraden waren wir totzdem. Von meinen 77 Kameraden sind wohl höchstens 3 unverletzt geblieben; so haben wir uns geschlagen. Hier im Lazarett sind viele Kameraden, die nur von Mädchen sprechen können, aber leider in der unflätigsten Weise. Gerade die Alten sind darin am schlimmsten. Jeden Ausgang, gehen diese aus zum sog. „ficken“. Anderes dachten sie nicht. Daß sie sich und das arme Mädel damit unglücklich machen, wollen sie nicht wissen. Abends nach dem Ausgang geht es dann los. Dann bringen sie ihre „Heldentaten“ vor. Daß diese sich dabei nicht schämen, verstehe ich nicht. Man muß wirklich sich zusammennehmen, damit man sich nicht vergisst. Denn ich stehe hier allein gegen eine Mehr-
heit und dazu sind es ja die „Alten“. Wir „Jungen“ dürfen da nicht reinsprechen. Nun muß ich aber so langsam Schluß machen. Wie geht es denn der Pfarrjugend? Wer ist denn jetzt Pfarrhelfer? Weires ist ja auch weg.Ist Willi Krautz auch schon eingezogen? Ich muß immer daran denken, wie ich damals noch mit den Jungen Fußball spielte. Das war ja schöner als ein Heimabend. Das war noch eine Zeit, als wir Fahrten machten. Ich habe auch Briefverkehr mit Hans Meurers. Wissen Sie was von Hans Eiermann und vielleicht seine Anschrift? Wie ist die Anschrift von Werres? Können Sie mir noch mehr Adressen von mir bekannten Soldaten geben? Ich habe Ihnen ein kleines Heftchen beigelegt. Mir hat es gefallen. Vielleicht können Sie damit etwas anfangen oder einem anderen Soldaten schicken. Wieviel Jungens haben Sie denn noch? Viele werden ja im R.A.D. und Militär sein. So jetzt will ich den langen Brief beenden und sehen Sie damit Ihren Wunsch erfüllt. Die schlechte Schrift mögen Sie bitte entschuldigen. Ein so langer Brief und mir ein Grund zum Schreiben, da kann man nicht schön schreiben. Nun herzliche Grüße, ein frohes Weihnachten und Gott es Schutz in ihrer Arbeit wünscht Ihnen
Ihr Peter Pehl
P.S. Jetzt müssen Sie aber auch mal einen langen Brief schicken.