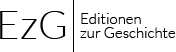Gisbert Kranz an seine Familie, 1. Januar 1942
Rußland, den 1.I.1942.
Meine Lieben!
Nun hat das neue Jahr seinen Lauf begonnen. Ihr werdet unterm Christbaum gesessen haben, um bei frohem Spiel und Sang und bei Wein und Konfekt die Mitternachtsstunde abzuwarten – wie wir es immer gehalten hatten. Ihr werdet sicher auch der letzten Sylvester-Feier gedacht haben, wo ich noch unter Euch weilte und in Versen, Bildern und Melodien alte Zeiten mit ihren seligen Erinnerungen heraufbeschwor. „Wie doch die Jahre enteilen...“ Diese Melodie von Paul Lincke durchzog den ganzen Abend. Nun sind wir wieder ein Jahr weitergerutscht, und auch dieser Abend ist ferne Erinnerung
geworden, wie all die andern, vielen freudigen und weniger freudigen Erlebnisse des Jahres 1941. Wer von uns hätte damals, als ich Hamm 1919 heraufbeschwor, gedacht, daß mich kaum drei Monate später das Schicksal mit dieser Stadt verband? Wer hätte damals gedacht, daß ich heute hier in Rußland sitze und zur niedrigsten Stufe herabgesunken bin, auf der menschl. Existenz, kaum noch möglich ist. Ich bin sehr bescheiden und anspruchslos geworden in diesen letzten Monaten, das Schicksal hat mich ziemlich gleichgültig und stoisch gemacht, mich kann nichts mehr erschüttern. Längst habe ich es aufgegeben, über dies Hundeleben noch zu klagen – es hat doch alles keinen Zweck. Hoffentlich hat das alles bloß bald ein Ende – das ist der einzige Wunsch, den man noch hat. – Wenn ich Anfang und Ende des vergangenen Jahres vergleiche – welcher Unterschied! Damals war ich noch mein eigener Herr, mir fehlte nichts, ich hatte mein schönes Zimmer, ich hatte Eure Liebe, ich konnte mit meinen Freunden bei Kuchen und
Likör Namenstag feiern. Ich saß bei meinen Büchern und trank noch mal mit vollen Zügen am Born der Weisheit und Schönheit. Damals hatte meine schöpferische Kraft ihren Höhepunkt erreicht, ich arbeitete wie besessen und hatte das Glück, noch vor meiner Einberufung meine erste große wissenschaftliche Arbeit vollenden zu können. – Dann kam meine Rekrutenzeit. Manches mußte ich schon damals entbehren, doch ich hatte noch Freunde bei mir. Ihr konntet mich besuchen – wie schön waren die Tage, die ich mit Euch in Heeßen verbringen durfte! Manche schöne Erinnerung habe ich aus dieser Zeit. Und dann kam die harte, aber schöne Schule von Elberfeld und Lingen und die letzten Tage beim Ersatz in Rheine. Als ich ins Feld rückte, wurde auf einmal alles anders, ein neues Leben begann, ein Leben voller Entbehrungen und Anstrengungen, das Gefühl der völligen Verlassen-
heit, Einsamkeit und Leere, ein Verlieren der letzten Reste von Kultur und Zivilisation. Verdreckt, verlaust, hungrig und durstig, schleppten wir unsern ausgemergelten Körper durch das öde Rußland. Es kamen nochmal gute Tage in Poltawa. Doch diese Freude war nur kurz. Unerwartet wurden wir eingesetzt. Ich brauche davon nicht mehr zu schreiben, Ihr habt aus meinen 26 Seiten Aufzeichnungen genug erfahren. Vom 23.-28.XII. war ich im Feldlazarett, wo ich schöne Stunden verbrachte. Dann wartete ich auf der Krankensammelstelle in Mariupol auf Abtransport. Hier lagen wir wieder auf Stroh. Gestern morgen wurden wir um drei Uhr geweckt und zum Bahnhof gefahren, wo wir in einen russischen Zug gesetzt wurden, der uns nach Stalino bringen sollte. Damit begann der letzte Tag des Jahres, der einen würdigen Schlußpunkt setzte hinter all die Schrecken und Leiden des Jahres. Diesen Tag werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich schüttle
jetzt noch den Kopf und vermag kaum zu glauben, daß so etwas möglich war. Ich kann es immer noch nicht fassen. –
Um sechs Uhr fuhr der Zug ab. Die Sonne kam langsam herauf und erhellte die unter hohem Schnee vergrabene Landschaft. – Wie waren zu 130 Mann, Verwundete und Kranke, von den letzteren hatten die meisten erfrorene Füße und Gelbsucht (typische Stoffwechselkrankheit, verursacht durch einseitige Verpflegung: Viel Fleisch, statt Gemüse Nudeln und Graupen, überhaupt keine Kartoffeln, kein Zucker und kein Obst). Man gab uns noch eine dicke Wurststulle mit auf den Weg, dann dampften wir ab. Mittags kamen wir in Jesowka, 7 km vor Stalino, an. Nach einer Weile hieß es „Aussteigen!“ Wer den Befehl gegeben hatte, weiß ich nicht; jedenfalls stiegen wir aus. Eine mühsame Sache bei den vielen Fußkranken. Wir standen eine zeitlang auf dem Bahnsteig, ohne zu wissen, was los
war, als wieder „Einsteigen!“ gerufen wurde. Nun, das sind wir als alte Landser gewohnt. Wir sagten nichts und stiegen wieder ein. Nach zwei Minuten stiegen wir wieder aus. Dabei wäre nichts weiter gewesen, wenn wir gesunde Knochen gehabt hätten. Wir aber waren krank und schimpften jetzt. Der „Bahnhofsoffizier“, ein Obergefreiter, teilte uns mit, wir würden hier von der Krankensammelstelle abgeholt werden und sollten uns solange in den Warteraum begeben. So quetschten wir 130 Mann uns in die enge, als „Warteraum“ bezeichnete Bude und warteten – eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Die meisten mußten stehen. Rotes Kreuz gab es hier nicht. Zu essen bekamen wir nichts; auch nichts zu trinken. Als es schon dunkel wurde, stiegen wir in einen alleinstehenden Waggon, in dem wir nicht alle Platz fanden. Die meisten standen im Gang und auf dem Perron. So warteten wir weitere zwei Stunden. Niemand kümmerte sich um uns. Wir waren ganz auf uns
angewiesen. Es war kein Sanitäter da, der mit uns fuhr, und keiner, der für den Transport verantwortlich war. Niemand wußte Bescheid, was los war und wohin wir sollten. Man hatte uns in Mariupol einfach in den Zug gesetzt und uns ins Blaue fahren lassen. – Ich weiß nicht, wie spät es mittlerweile geworden war – mir war alles so gleichgültig geworden – auf einmal setzte sich jedenfalls unser Wagen in Bewegung. Eine Lokomotive hatte sich vorgesetzt und fuhr uns nun über Stalino hinaus ungefähr 15 km weit. Der Zug hielt, wir warteten. Niemand kam. Ich weiß nicht, ob jemand inzwischen von irgendwoher irgendwelche Anweisungen bekommen hatte, ich war schon sehr müde und konnte das nicht mehr beachten. Doch nach einer halben Stunde Wartens stiegen einige mit ihrem Gepäck aus. Andere folgten, nach und nach leerte sich der Wagen. „Wo wollt ihr hin?“ Die meisten wußten es selbst nicht,
andere redeten etwas von einer imaginären Krankensammelstelle. Mir war alles wurst. Ich konnte nicht laufen und blieb sitzen. Die Füße schmerzten mir, und die Stiefel bekam ich schon lange nicht mehr an. Schließlich kam jemand und warf die paar, die noch da saßen, hinaus: Wir sollten die Krankensammelstelle suchen gehen, da wir doch nicht abgeholt würden. Ich konnte mir das alles nicht mehr zusammenreimen. Um Euch aber nicht lange Rätselraten zu lassen, will ich Euch gleich sagen, daß wir in diesem Orte nichts zu suchen hatten, daß wir nur bis Stalino fahren sollten, wo die Kraftwagen der Krankensammelstelle auf uns warteten. Auf wessen Veranlassung wir aber in dieses Kaff gefahren sind, weiß ich bis jetzt noch nicht. Organisation fabelhaft. – Mir blieb nichts anderes übrig, als die Füße in die Stiefelschafte zu stecken, so gut es ging, damit ich nicht auf Strümpfen laufen mußte und den andern nachzugehen. Ein paar
liefen auf Strümpfen durch den stellenweise knietiefen Schnee. So schleppten wir uns blind durch die Gegend, ungewiß, wohin. Zu allem Überfluß krachten noch vier Fliegerbomben auf den Bahnkörper, sodaß wir zu diesem ausgekochten Sylvesterunsinn auch noch das nötige Feuerwerk hatten. Ein Feldwebel, der nicht mehr mitkonnte, blieb im Schnee liegen, und rief mir zu, wir sollten ihn nachher holen. Ich habe im ganzen Krieg noch nie geweint, aber da heulte ich vor Wut. – Als wir uns wohl 1500 m weit geschleppt hatten, standen wir vor einem Lazarettzug. Er war besetzt, und der Stabsarzt wollte uns nicht aufnehmen. Wir seien ja garnicht angemeldet. So standen wir hilflos mit unsern Habseligkeiten in bitterer Kälte im Schnee und wußten nicht wohin. Die einen liefen nach hierhin, die andern nach dorthin. Die einen wollten zur Krankensammelstelle (nur wußte niemand, wo sie war. Die andern
wollten in die paar umliegenden Häuser gehen und Quartier machen. Einen Bahnbeamten fragten wir nach dem Weg zur Krankensammelstelle. Der Mann sah nicht unsern Zustand, war wohl auch noch nie an der Front, sonst hätte er uns nicht so trocken sachlich sagen können: Erste Straße links, 400 m weiter an der Mühle rechts ab, dann zweite Straße links, bis zu dem großen Gebäude, dann halbrechts auf die Häusergruppe zu. Da müßt ihr mal fragen, wie es weitergeht. Es sind ungefähr 3-4 km.“ Punkt. Schluß. –
Auf einmal hieß es: „Wir gehen wieder zu unserem Wagen zurück und schlafen da (im ungeheizten Wagen!). Morgen fahren wir nach Stalino zurück.“ Die meisten weigerten sich einfach. Jetzt kam, was kommen mußte: Die Leithammel (es waren nämlich mehrere, der eine wollte hüh, der andere hott)
warfen sich gegenseitig die Schuld an diesem Unglück vor. Sie schrien sich gegenseitig an: „Ich hab’s ja gleich gesagt... Hätten wir...“ Und die andern standen frierend und vor Schmerzen wimmernd herum und schimpften. Übrigens waren wir schon lange nicht mehr 130 Mann. Der Haufen war ganz versprengt. Kein Wunder, niemand war da, der Führung und Verantwortung hatte. Schließlich erbarmte sich unser ein Oberarzt, rief den Rest von 50 Mann zusammen und veranlaßte die Krankensammelstelle – die natürlich nichts von uns wußte, da wir nicht gemeldet waren und ganz wo anders hinsollten – Wagen zu schicken und uns abzuholen. Die Fußkranken fuhren, die andern mußten laufen. Es war 11 Uhr, als wir ankamen. Wir bekamen unser Strohlager angewiesen, eine Stulle – fertig. Zu trinken gabs nichts. Auch heute morgen bekamen wir nichts
zu trinken. Auf meine Beschwerde beim Unterarzt (wir hatten seit vorgestern Mittag nur noch Brot gegessen und seit 30 Stunden nichts mehr zu trinken bekommen!) erhielten wir kurz vor dem Mittagessen etwas Tee. Heute morgen kamen noch einige von den Versprengten zur Krankensammelstelle. Wo die übrigen geblieben sind, weiß ich nicht. –
Das ist eine Episode aus dem Rußlandkrieg, geschehen in der Neujahrsnacht 1942. –
Nun liege ich auf meinem Stroh und schreibe. Die Läuse bilden eine unerträgliche Qual; dazu die schmerzenden Füße. Ich bin mutterseelenallein, die Kameraden sind mir fremd, von der Kompanie und meinen alten Bekannten ist niemand mehr da. Meine ganzen Habseligkeiten sind 2 Wolldecken, Waschzeug, Schreibzeug und was ich am Körper trage. Omnia mea meeum porto. Arm, krank, verdreckt und verlassen gehe ich ins neue Jahr. –
Ich habe heute morgen den Herrgott gebeten, mich doch möglichst bald nach Deutschland gelangen zu lassen. Ich habe ihn gebeten, mich nicht zu verlassen, wenn alles mich verlassen hat, mich zu stärken für das Leid, das mir noch bevorsteht. Ich habe Ihm gedankt für die frohen Tage und Stunden des vergangenen Jahres, aber auch für all das Leid und Elend, das ich erdulden mußte, hat es mich doch stark und geduldig gemacht. Ich habe Ihm gedankt für den Beistand, den er mir im Gefecht gab, dafür, daß ich mutig und tapfer kämpfen konnte. Und die ganze Zukunft habe ich in Seine Hände gelegt. Herrgott, mach mit mir was Du willst, Du wirst es schon recht machen. Du hast mich hungern lassen. Es war gut so. Doch wenn es Dein Wille ist, dann laß mich bald nach Deutschland kommen, damit ich gesunde an Leib und Seele.
Darum habe ich Euch, Ihr Lieben, das alles geschrieben, daß Ihr in diesem Sinne mit mir und für mich betet. Ich bitte Euch, tut das! Nicht, um von Euch bemitleidet zu werden, schrieb ich Euch von all meinem Elend. Oh, wie hasse ich dieses Mitleid, das mir doch nicht helfen kann. Es ist des Soldaten nicht würdig. Der Soldat kämpft und leidet. Aber er klagt nicht. Und die andern sollen ihn auch nicht beklagen, sondern achten.
Es grüßt Euch herzlich
Euer Gisbert