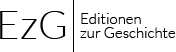Gisbert Kranz an seine Familie, 15. - 22. Dezember 1943
Zeebrügge
15.XII.43.
Meine Lieben!
So einigermaßen habe ich mich in meiner neuen Umwelt schon eingelebt. Ich finde sie nicht übel. Ich bin Kommandant eines kleinen Werkes, dessen Hauptwaffe eine Panzerabwehrkanone ist. Die Besatzung besteht aus 5 Mann: ein Obergefreiter aus dem Hunsrück, ein Gefreiter aus Lübeck, zwei Grenadiere aus Westpreußen und Berlin; den fünften kenne ich noch nicht, er liegt zur Zeit im Lazarett. – Ich muß gestehen, daß es mir etwas unheimlich war, als ich diese Höhle von Stahl und Beton zum erstenmal betrat. Solche unterirdischen Gelaße, deren größter Raum von Waffen und Munition ausgefüllt ist, haben immer eine drückende Atmosphäre. Mir standen noch die Bunker des Westwalls in Erinnerung, deren Bemannung im Laufe der Monate unausweichlich einem Koller anheimfiel. Doch umso überraschter war ich, als ich den Fortschritt bemerkte, den die Ausstattung der Mannschaftsräume in den letzten vier Jahren gewonnen hatte. In der Tat wohnen die Soldaten in ihren Bunkern heute gemütlicher als seinerzeit am Westwall. Die Betten sind sogar, was ich bis jetzt noch bei keinem Feldtruppenteil erlebte, weiß bezogen und haben statt der üblen Strohsäcke angenehm weiche Matrazen. Ich weiß das sehr zu schätzen, nachdem ich wochenlang keine Bettwäsche mehr gesehen habe, außer in dem holländischen Hotel, in dem ich vor wenigen Tagen
übernachtete. Auch sonst ist die Einrichtung so beschaffen und sind die Verhältnisse derart, daß man hier getrost den Winter zubringen kann. –
Wenn ich mein Werk verlasse, so stehe ich inmitten einer fantastischen Landschaft. So weit das Auge reicht, überall erheben sich fertige und halbfertige Kasematten dunkel aus hellem Sande. Zwischen ihnen ein Gewirr von Laufgräben und Drahtsperren, Lichtleitungen, Feldbahngleisen, hohen Stapeln von Baumaterialien und Mauerresten von zerstörten Häusern – ein Bild, wie ich es ähnlich vom Westwall her kenne. Nur kommt hier als Neues die See hinzu, deren Wellen bis 100 Schritt an meinen Bunker heranreichen.
Als ich heute morgen in der Frühe durch den Stützpunkt ging, sah ich im Westen mehrere hohe Kirchtürme ragen, die ich am Tage vorher nicht bemerkt hatte. Bei näherem Zuschaun entpuppte sich das, was ich für die gotisch durchbrochenen Helme von Kirchtürmen gehalten hatte, als die Eisenkonstruktion von Hebekränen, die auf der Mole von Z. stehen. Ihre ausladenden Arme waren in meine Richtung geschwenkt, und da der leichte Nebel in der Morgendämmerung die perspektivische Sicht aufhob, konnte für einen Fremden diese Täuschung entstehen. So wird es noch eine Weile dauern, bis ich mir die Erscheinungen meiner neuen Umwelt zu eigen gemacht habe.
Unser Dienst besteht hauptsächlich in Postenstehen und Streifengehen. Für mich kommt natürlich nur das Letztere in Frage. Die Nächte werden dadurch in Abschnitte geteilt und der Schlaf in Raten konsumiert.
Doch kommt der Körper schon auf seine Kosten. Auch die Verpflegung ist zufriedenstellend. In dem Kantinier lernte ich wieder, wie in der Pionierkompanie, einen Sohn Steeles kennen, Gefreiten Hübsche aus dem Rott. –
In zehn Tagen ist Weihnachten. Ich werde diesmal wieder nicht zu Hause sein können und stattdessen das Fest in Flandern feiern. Betrüblich, daß die schönen Weihnachtspakete mich nicht mehr rechtzeitig erreichen. Ich versuchte gestern, meiner alten Einheit fernmündlich meine neue Nummer mitzuteilen, bekam aber nur die Division; das Bataillon war nicht mehr angeschlossen und hatte vermutlich schon alles für den Abmarsch gepackt. Ich rechne aber damit, daß ich spätestens am Heiligen Abend wieder Briefe von Euch habe. Es muß noch eine ganze Menge Post von Euch und von Freunden für mich unterwegs sein. Das meiste davon werde ich in diesem Jahr nicht mehr bekommen. Sind auch die äußeren Verbindungen einstweilen abgeschnitten, so weiß ich doch, daß Ihr mit Euren Gedanken bei mir seid, wie auch die meinigen stets um Euch kreisen. Ich hoffe, daß Karlheinz am Heiligen Abend in Eurer Mitte sitzt, daß auch Günter und Fritz dabei sind und Ihr so alle in Fröhlichkeit beisammen seid. Laßt mich bitte wenigstens im Geiste unter Euch weilen. Die Gnade und den Frieden des Herrn wünsche und bete ich auf Euch herab.
Euer Gisbert
15.XII. abends.
Heute nachmittag bin ich in Begleitung eines Unteroffiziers alle Werke unseres Stützpunktes abgegangen. Mir wurden einige Waffen und Einrichtungen erklärt, die mir bisher noch fremd waren. Die Leute waren mit Stolz und Eifer dabei, mich mit allen Einzelheiten der Verteidigungsanlagen bekannt zu machen. Mir kam unterwegs der Gedanke, daß es ein unangenehmes Gefühl sein muß bei einem feindlichen Angriff hinter der Scharte eines Bunkers zu sitzen, die unweigerlich das Feuer des Feindes auf sich zieht. Lieber stehe ich da schon mit einem Maschinengewehr im offenen Graben oder Panzerdeckungsloch. Wie ich hörte, erhoben sich früher auf dem Gelände unseres Stützpunktes stattliche Bauten, Wohnhäuser und Hotels, die alle niedergelegt worden sind.
16.XII.43.
In der letzten Nacht begleitete ich einen Unteroffizier auf seinem Streifengang, um mit den Wegen auch bei Dunkelheit vertraut zu werden. Mein Ortsinstinkt muß sich noch bis zu ungeahnten Höhen entwickeln, ehe er sich in dem Gewirr von Draht und Steinhaufen zwischen den Kasematten unseres ausgedehnten Stützpunktes zurechtfinden kann. Es ist schon vorgekommen, daß Streifen sich den Fuß verstauchten oder gar Arm und Bein brachen, weil sie über eine Unebenheit oder ein Hindernis stolperten oder in eine Versenkung unversehens hineinrutschten. Auch bilden etliche zugefrorene Tümpel für den Unkundigen eine Gefahr.
Heute morgen beim Arzt wegen meiner Fußbeschweren. Er gab mir ein Paar Einlagen, die mir aber nicht passen. Ich werde in der nächsten Woche nach Brüssel fahren, um mir bei einem Orthopäden welche anfertigen zu lassen. Ich freue mich schon jetzt darauf, bei dieser Gelegenheit auch einmal die Hauptstadt kennenzulernen. – Heute mittag erfuhr ich durch meinen Zugführer, daß ich nach ihm der dienstälteste Unteroffizier des Stützpunktes und somit stellvertretender Stützpunktkommandant bin.
Ich verfüge über sehr viel Freizeit, die ich vorwiegend zum Lesen und Schreiben benütze. Ich lese jetzt in Ernst Jüngers Tagebüchern von 1939 u. 1940, zum zweiten Mal seine „Marmorklippen“ und Hölderlins Hyperion, dann Novellen von C. F. Meyer und Gottfried Keller.
17.XII.
Gestern abend gemeinsames Essen des Unteroffizierkorps der Kompanie mit anschließendem Zechgelage, das sich bis zum Morgen hinzog. Lernte bei dieser Gelegenheit alle Unteroffiziere kennen, die ich hier zum erstenmal beisammen sah. Unser Spieß, Förster in zivil, hatte drei Hasen geschossen, sie bildeten die Hauptattraktion des Mahles und für mich das einzig Erfreuliche am ganzen Abend überhaupt. Denn die Folge der Getränke bildete ein solch barbarisches Durcheinander und die Unterhaltung war so geistlos, daß ich danach trachtete, möglichst bald diese widerliche Szene zu verlassen. Das Unteroffizierskorps dieser Kompanie setzt sich aus wenig angenehmen Typen zusammen, die meisten Korporäle haben die Front noch nicht gesehen, und ich bin der einzige, der das EK trägt. Im Lehrgang Jensen in Danzig und in der 1. Kp. des Füsilierregimentes haben mir solche Kneipen bedeutend besser gefallen, schon allein in ihrem Stil, auch wegen der guten Form und der gehobenen Bildung der Gesellschaft. Nachdem, was ich gestern beobachtete, verspreche ich mir von der geplanten Weihnachtsfeier nicht viel. Der Chef selbst, einziger Offizier in der Kompanie, ist ein rabiater Bursche, ohne Anstand und Bildung, menschlich wenig sympathisch. Ich bedauere es nicht, daß ich ihn nur selten zu Gesicht bekomme. Überhaupt ist es sehr günstig, daß man in seinem Bunker ein ziemlich abgeschlossenes und unbehelligtes Leben führen kann. Der Korpsgeist leidet darunter zwar stark, und wo er in einer Truppe fehlt, entwickeln sich – besonders unter diesen Umständen – rasch individua-
listische und anarchische Tendenzen. Ich überlege, wie man dem wirksam entgegenarbeiten kann, ohne dabei die Sonderung außerachtzulassen, die mir bei der inneren Struktur der hiesigen Truppe geboten zu sein scheint. Die Kompanie muß zwar von Zeit zu Zeit zusammengefaßt werden, damit dem Einzelnen nicht das Gefühl der Verantwortung nach oben verlorengeht und der Masse nicht die Disziplin; aber der Abstand, der zwischen den einzelnen Besatzungen der Werke räumlich ohnehin besteht, muß auch geistig dasein: Nur so können Reibungen, die sich für das Ganze nachteilig auswirken, auf die Dauer vermieden werden. Das scheint mir die richtige Lösung zu sein; über die Mittel und Wege zu ihrer Verwirklichung sinne ich noch nach. Man muß das eine tun und darf das andere nicht lassen – zwei Pole stehen sich gegenüber, wie so oft im Leben, das aus lauter Spannungseinheiten besteht, die Gegensätze einschließen. Person – Gemeinschaft; Licht – Dunkel; Mann – Frau. Die Polarität des Lebens reicht vom Metaphysischen bis ins Physikalische und Biologische. Die Pole sind eigenständig und doch aufeinander bezogen. Aber es muß Abstand zwischen ihnen sein, soll die Lebensordnung nicht gestört werden: Reißt der Staat die Attribute der Person an sich, so beschwört er seinen Untergang herauf. Freundschaften zerbrechen an Vertraulichkeit, die nicht der Abstand zu wahren weiß. Und um an unseren Ausgangspunkt zurückzukehren: Ich erlebte es in einer Kompanie, in der sonst ein guter Geist zw. Offizieren und Unteroffizieren herrschte, daß bei einem Kameradschaftsabend ein Skandal hervorgerufen wurde durch die anmaßende Vertraulichkeit eines Unterführers, der gegenüber
einem Leutnant nicht mehr die durch die Subordination gebotene Distanz zu halten wußte. Eine über mehrere Tage andauernde Mißstimmung auf beiden Seiten war die Folge dieses bedauerlichen, aber lehrreichen Vorfalls. –
Während ich in der Pionierkompanie fast ausschließlich mit Mecklenburgern und Pommern im Alter von 17 Jahren zusammen war, habe ich es in meiner neuen Einheit mit älteren Leuten aus allen Teilen des Reiches zu tun. Es sind meist Familienväter Mitte der Dreißiger. Mein neuer Bursche ist noch ein junger Kerl, heißt Kasimir Josefowicz und stammt aus dem früheren Polen. Er sorgt in rühriger Weise um mein persönliches Wohl und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab; ohne daß ich ihm Anweisungen zu geben brauche, besorgt er mir alles, was ich gerade nötig habe. Typen seines Schlages sind mir nicht unsympathisch. Wenn sie auch ein geringes Wissen besitzen, so mangelt es ihnen doch nicht an Intelligenz. Als Ausbilder in Danzig habe ich viele Leute dieser Art, meist Landarbeiter wie mein Kasimir, beobachten können, und ich gewann dabei die Überzeugung, daß sie – von wenigen Schlampern abgesehen – recht wertvolle Soldaten sind. Wenn man sie richtig anfaßt, wissen sie sich gut zu fügen und bereiten weniger Schwierigkeiten als Menschen komplizierterer Verfassung. Man tut Unrecht, wenn man – wie ich es öfters erlebte – bei frisch eingetroffenem Ersatz gleich nach Volksdeutschen fragt und dabei den Eindruck erweckt, als ob es sich hier um eine minderwertigere Rasse handelt. Mögen diese Männer auch über wenig Kultur
und Bildung verfügen, so bringen sie doch andere Eigenschaften mit, die erwarten lassen, daß sie – bei entsprechender Ausbildung – gute Soldaten werden. Es fehlt vielen Offizieren das psychologische Talent, diese Leute auch richtig einzusetzen. –
Schlief bis zum Mittag. Nach dem Essen Fahrt nach B. zum Baden. Das tat dem Kater gut. Anschließend Waffenunterricht. Dann Abendessen (es gibt jeden Abend Warmes). Nachher Streife und Postenkontrolle. Dichte Finsternis, sodaß man kaum fünf Schritte weit sehen konnte.
19.XII. (4. Advent)
Seit gestern abend stürmisches Wetter. Der Frost hat aufgehört, dafür regnet es anhaltend und stark. Hatte bei dieser ungemütlichen Witterung in der vergangenen Nacht Streife. Die Finsternis war undurchdringlich. Kein Stern war zu sehen. Nur von der Mole her blinkte von Zeit zu Zeit das Leuchtfeuer herüber, Schiffe in den Hafen einzuweisen. Ich ging auf dem Uferkai auf und ab, dachte dabei nach über Geist und Willen des Menschen und ihre Beziehungen zueinander. In meinen Bunker zurückgekehrt, machte ich mir gleich einige Notizen dazu. Vielleicht entsteht daraus eine brauchbare Arbeit. Die viele Muße, die ich augenblicklich habe, zwingt mich wieder zu geistiger Arbeit.
20.XII.
Nach dem Regen gestern haben wir heute wieder herrliches Sonnenwetter, dem eine klare, helle Sternennacht vorausging. – Am Sonntag Nachmittag Kino im Stützpunkt.
Dann an meinen neuen Aufzeichnungen gearbeitet. Mir kam dabei die Erkenntnis, daß nicht der Wille gezüchtete Natur ist, wie ich bisher annahm, sondern der Geist des Menschen, insofern darunter Vernunft und Gefühl (Herz) zu verstehen ist. Der Wille ist nicht rassisch gebunden, er ist frei und das Attribut der Persönlichkeit, die ohne Willen nicht gedacht werden kann, während der Geist des Menschen (sein Herz und seine Vernunft) in der Erbmasse wurzelt. Im menschlichen Geiste schwingen die Gedanken u. Gefühle von Jahrhunderten nach. Wie weit diese Überlieferungen neue Tat werden, hängt allein vom Willen der Persönlichkeit ab, der frei und unabhängig ist. – Nachdem mir das in allen Folgerungen klar geworden, ist es mir unverständlich, wie ich vor drei Monaten um eines bestimmten Zusammenhanges willen vom Gegenteil überzeugt sein konnte. Ich entdeckte den Irrtum, als mein Gedankengang von der Beziehung zwischen Geist u. Willen hinüberglitt zu dem Problem der Freiheit. Dabei mußte der Widerspruch offenkundig werden. –
Obwohl ich in der letzten Nacht nur wenig und schlecht geschlafen hatte, fühlte ich mich heute morgen ungewöhnlich frisch, und dieses wohlige Kraftgefühl hielt den ganzen Tag über an. Ich führe das auf die klare Luft zurück, die mir stets angenehmen Einfluß auf Geist und Körper nahm. Diese Stimmung ist meiner Arbeit günstig, und so begann ich gleich nach der Mittagsruhe zu schreiben. Freilich wurde ich alsbald gestört durch den Lärm von Handwerkern, die anfingen, in meinem Werk eine Wasserleitung zu legen. Bisher mußte ich das Wasser immer von einem benachbarten Bunker holen lassen, und zum Waschen mußten Schüsseln benutzt werden.
Umso froher bin ich, daß ich selbst nun fließendes Wasser bekomme, worauf ich schon lange wartete, und daß die Arbeiten noch vor dem Fest erledigt sind. Doch da die Leute mit Preßlufthämmern eine Führung für das Leitungsrohr in den Beton schlugen und der Lärm unerträglich wurde, warf ich meine Schreibbogen zusammen und machte einen Spaziergang nach H., längs der Küste. Lernte bei dieser Gelegenheit auch die benachbarten Stützpunkte kennen. An den Straßen Minenfelder und Sperren aller Art. Sie geben der Landschaft hier das Gepräge eines Labyrinths. – Grotesk die noch aus friedlicheren Zeiten stammende Inschrift auf einer Häuserwand, auf der in Riesenlettern zu lesen war: England via Z. – H. Der Hinweis einer Schiffahrtsgesellschaft. So erscheinen uns Dinge, die unter normalen Umständen selbstverständlich waren, auf einmal lächerlich, wenn sie beharrlich fortbestehen in einer völlig veränderten Umwelt.
21.XII.
Gezüchtete Natur. Ich habe den Ausdruck gestrichen, da er verwirrt. Der Geist steht über dem Blute. Seine Macht muß die Macht des Blutes zügeln und formen. Es ist aber nicht so, als ob der Geist aus dem Blute hervorgehe, als ob er das „gezüchtete“ Ergebnis, der Ausfluß der Rasse sei. Die Formel: „Geist gleich gezüchtete Natur“ hat mich auf eine falsche Fährte gebracht. Darin liegt die Gefahr solcher Schlagworte: Sie sind glatt und leicht zu gebrauchen, schillern aber bedenklich zu ihrer Bedeutung und verwirren das Denken. Dieser Fall soll mir warnende Lehre sein. –
22.XII.
Sternklare Nacht. Ich hatte Streife von 2 bis 4 Uhr. Es festigte sich in mir die Erkenntnis, daß Geist und Blut die bestimmenden Kräfte im menschlichen Leben sind. Der Wille ist integrierender Teil des Geistes. Geist und Blut stehen im Verhältnis der Polarität zueinander: Es sind Gegensätze, die sich nicht ausschließen, sondern aufeinander bezogen sind. Sie bilden eine lebendige Einheit. Alle menschlichen Taten in Kultur und Zivilisation entspringen diesen beiden Prinzipien: dem Geist (d. i. Vernunft, Herz und Wille) und dem Blut (d. i. Hunger und Eros, oder die Triebe zur Erhaltung und Fortpflanzung des Lebens). Dabei ist der Geist der Persönlichkeit, der Individualität zugeordnet, das Blut aber den anonymen Kräften der Rasse. So liefert die Erbmasse den menschlichen Werken gleichsam ihren formlosen Urstoff, dem dann der einzelne schaffende Mensch den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückt.
Gleich nach meiner Rückkehr vom Streifengang legte ich diese Gedanken nieder und schrieb bis zum Mittag.