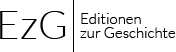Gisbert Kranz: Notizen 4.-26. Januar 1944
4.I.44.
Vorgestern hörten wir den Vortrag eines Generals zur politischen Lage. Nichts Neues, die üblichen Phrasen. Übel fand ich, daß er sich in jenem salbungsvollen, pastoralen Kanzelton bewegte, wie er mir bei vielen Geistlichen so unsympathisch ist. Als der General, ein alter Herr von wohl über 70 Jahren, merkte, wie wenig Interesse für seine propagandistischen Ausführungen vorhanden war, wechselte er noch das Thema und erzählte eine Stunde lang Witze, so versuchend, sich populär zumachen. Allerdings hatte er dann damit auch vollen Erfolg.
Mich regten die rotgoldenen Rangabzeichen zu einer Betrachtung über die Symbolik dieser Farben an. In ihnen wird die hohe Macht versinnbildet. Über dem Versuch, die Frage zu lösen, warum gerade Rot und Gold diese Bedeutung zukomme, spann ich mannigfache, verschlungene Gedanken, die ich in wenigen Stunden zu einem kleinen Essai verarbeitete. Selten ist mir eine Arbeit so rasch von der Hand gegangen. Dabei handelt es sich um eine meiner glücklichsten Inspirationen. Das Ganze hat 13 Kapitel: Im ersten behandele ich Ursprung und Anwendung der Farbensymbolik, in den folgenden die einzelnen Komplementärfarben. Die nächsten Abschnitte sind den Farben Braun, Schwarz und Weiß sowie den gemischten Farben gewidmet, von denen mir Violett die bedeutungsvollste zu sein scheint. Gegenstände der letzten Kapitel endlich sind die Dynamik und Dämonie der Farben, ihre Etymologie und ihre Stellung in der Mythologie.
In dieser Arbeit habe ich zum erstenmal die Form des Essays
gemeistert. Im Essai glaubte ich die literarische Form gefunden zu haben, die der Eigenart meines Geistes am ehesten entspricht. Ernst Jüngers Kunst ist mir hier Vorbild. Ich fühle aber schon, daß ich mich davor hüten muß, seine eigentümlichen Formen als Schablone zu nehmen und sie zu kopieren, soll die Entwicklung meines persönlichen Stiles nicht leiden.
Ich finde, daß der Winter von jeher meine schöpferischen Kräfte weckte. Woran das nun liegt, weiß ich nicht. Im Sommer bin ich weniger fruchtbar. Jedenfalls freue ich mich, in diesem Winter wenigstens Muße zum Schaffen zu haben (es klingt paradox, aber geistiges Schaffen fordert tatsächlich Muße). Freilich ist diese „Muße“ nicht wie ich sie mir wünsche. Aber ich bin überhaupt schon zufrieden, daß ich soviel Zeit habe, meine Gedanken zu entwickeln und auch aufzuzeichnen. Außerdem ist es überraschend wohltuend, einmal so ganz ohne literarische Hilfsmittel aus dem Eigenen heraus zu arbeiten.
5.I. Ernst Jünger: Merkwürdig, welch ein intensives Verhältnis dieser Geist zugleich zur Technik und Naturwissenschaft wie zur Metaphysik hat. Dabei sieht er die Welt der rationalen und die Welt der irrationalen Dinge als ein Ganzes. Bezeichnend dafür ist der Sizilische Brief an den Mann im Mond. Hier einige Sätze aus dem Schluß: „Das Wirkliche ist ebenso zauberhaft wie das Zauberhafte wirklich ist... Das war das Wunderbare, das uns an den doppelten Bildern entzückte, die wir als Kinder durch das Stereoskop betrachteten: Im gleichen Augenblicke, in dem sie in ein einziges
Bild zusammenschmolzen, brach die neue Dimension der Tiefe in ihnen auf... Die Zeit hat uns den alten Zaubersprüchen, die lange vergessen, aber immer gegenwärtig waren, wieder nahegebracht.“
Die alte Feindschaft zwischen Natur- und Geisteswissenschaft scheint langsam zu erlöschen, um einem tieferen Verständnis Raum zu geben. Max Planck ist dafür eine symptomatische Erscheinung.
6.I.
Heute morgen mit dem Rad durch die Polderlandschaft nach Lissewege zu einer Schiedsrichterbesprechung für eine Bataillonsübung. Ich benutze die Gelegenheit, den Adjutanten zu fragen, ob ich als Offiziersanwärter in den Listen des Bataillons geführt würde. Er bejahte dies und fügte hinzu, daß ich damit rechnen könnte, am nächsten Fahnenjunkerlehrgang teilzunehmen. So werde ich dann wohl in einem Monat schon wieder versetzt, diesmal zum Ersatztruppenteil nach Luxemburg, um von dort aus zur Waffenschule kommandiert zu werden.
9.I.
Gestern fuhr ich wieder nach Brüssel. Der Zug fuhr pünktlich ab, was ich als gutes Omen für den weiteren Verlauf des Tages ansah; es kommt nämlich bei der belgischen Eisenbahn nicht selten vor, daß die Züge mehrere Stunden Verspätung haben.
Nachdem ich meine Geschäfte erledigt hatte, blieben mir bis zum Mittag noch zwei Stunden, die ich zu einer Rund-
fahrt durch die Stadt benutzte. Da ein sehr dichtes Netz von Straßenbahnlinien über die ganze Stadt ausgebreitet ist, das fast jede Straße berührt, bereitet es keine Schwierigkeit, in kurzer Zeit die bedeutendsten Punkte von Brüssel aufzusuchen.
Wieder die reizenden flämischen Schildchen: Werpt uw Reisebriefje bij het afstappen niet op den Weg! – Aus vielen Einzelzügen bemerkte ich immer wieder die feine, aufmerksame Höflichkeit, die den Menschenschlag dieses Landes auszeichnet. Sie erstreckt sich über alle Stände und wird dem Fremden ebenso zugewendet wie dem Freund. Ich war recht glücklich über diese Beobachtung, doch zugleich betrübte mich der Gedanke, daß im eigenen Vaterlande das Volk erst durch Wettbewerbe zur Höflichkeit erzogen werden muß. Eine wahre, von Herzen kommende, feine Courtoisie – die fehlt uns Deutschen noch.
Die längste Zeit verweilte ich wieder auf der Grand Place, deren geschlossenes Bild sich mir diesmal im Glanze der Mittagssonne bot. – Am Portal des Rathauses gotische Skulpturen: Die vier Kardinaltugenden, durch Frauengestalten allegorisiert: Prudentia mit Schild und Fackel, Iustitia mit Schwert u. Waage, Fortitudo eine Schlange in würgender Faust haltend, und Temperantia mit einem achteckigen Gegenstand, dessen Bedeutg ich nicht erkennen konnte. Rechts u. links davon Lex u. Pax. In der Mitte des Bogenfeldes St. Michael, dem man hier nicht selten begegnet. – Von vornehmer Zurückhaltung und gemessenen Formen der Palast der Herzöge von Brabant. – Bürgerbauten, Zunfthäuser der Handwerkerinnungen, zum Teil in prachtvoller Renaissance.
Ich hätte noch bis zum Abend in Brüssel bleiben können,
zog es aber vor, mit dem Mittagszug nach Gent zu fahren, um den Nachmittag dort zu verbringen. Am Abend gedachte ich dann in Brügge zu verweilen.
In Gent angekommen, nahm ich zunächst im Soldatenheim ein Mittagessen ein. Dann spazierte ich durch die alte Heldenstadt, viertelstündlich von den Klängen eines Glockenspiels begleitet. Gent hat eine Fülle herrlicher Bauten, die meist einen trutzigen, wehrhaften Eindruck machen. Die ganze Stadt ist verwittert und altersgrau, ihr Antlitz eher abweisend als anziehend. Jene zauberische Stimmung, die den Fremden in Brügge so schnell heimisch werden läßt, fehlt Gent völlig. Diese Stadt wirkt weniger durch Schönheit, mehr durch Macht.
Den großen Kirchtürmen, die das Stadtbild beherrschen, fehlen die Helme. Dafür trägt der Belfried als Zeichen der Stadtherrlichkeit einen stolzen Helm, dessen Spitze einen goldenen Drachen weit über die Dächer der Stadt hebt. – Ich ging zunächst zur St. Baafs-Kathedrale, die einst den berühmten Eyck-Altar beherbergte. Leider sind die Meisterwerke der flämischen Malerei während des Krieges nicht zugänglich. St. Baafs ist eine dreischiffige, hochgotische Kathedrale mit vielen heterogenen Bauelementen. Baumaterial ist meist Kalkstein, dessen zuweilen hellgraue, zuweilen dunkle Färbung den Außenmauern einen kühlen, nüchternen Anstrich verleiht. Um das Hochchor, dessen Wandgliederung an Tournai erinnert, ein Kranz von Kapellen mit meist barocker Innenausstattung. Als störend empfand ich eine Kanzel im Rokokostil, die aber feine Holzschnitzarbeiten trug. Sehr eindrucksvoll der gotische Vertikalismus des Raumes. Beim Gang durch die Kirche überraschende Perspektiven. –
St. Nikolaus, gotisch mit romanischen Reminiszenzen, scheint durch den Krieg stark gelitten zu haben. Eindrucksvoller Vierungsturm mit vier runden Ecktürmchen. – St. Michael, gotisch, mit wuchtigem, viereckigen Turm, der anscheinend unvollendet blieb. Im Innern anstatt der Bündelpfeiler Rundsäulen, die einen Raumeindruck hervorrufen, wie er für flämische Kirchen typisch ist. – Von der Lievebrücke bei St. Michael aus hat man wohl den herrlichsten Blick auf die Stadt. Hier ziehen sich längs der Lieve die prunkvollsten Bürgerhäuser hin, die Lagerbauten und Häuser der Zünfte, auch mancher Herrensitz mit wehrhaften Mauern und Zinnen. – Ich ging die Korenlei hinunter zum Gravensteen, der Burg der Grafen von Vlandern. Sie erhebt sich inmitten der Stadt, von Wasser umgeben, mit dunklen Mauern und trutzigen Türmen. Der romanische Bergfried und der Pallas erinnert mich an den Papstpalast in Avignon: hier ist wahrhaft imperiale Baukunst. Doch wirkt s’Gravensteen gedrungener, schwerer, wuchtiger als das gotische Palais des Papes. – Als die Dämmerung begann, suchte ich die Frontbuchhandlung auf, wo ich wohl im Dutzend Bücher erstand. Nun muß ich aber meinen Wunsch auf ein Paar Offiziersstiefel aufgeben. Bis zur Abfahrt meines Zuges saß ich in einem kleinen Café, wo es Eis und ausgezeichnete Obsttörtchen gab. –
Am Abend wollte ich wohl noch einen Spaziergang durch das vollmondbeschienene Brügge machen. Doch das Wetter war diesig geworden, sodaß ich meinen Plan aufgab. – Bei der Ankunft zu Hause starke Kopfschmerzen. Ich legte mich sofort schlafen. Es war zu viel des Schönen, das dieser Tag für mich beschert hatte.
19.I.44.
Ich lebe als Zöllner unter Zöllnern. Meine Haft verbüße ich in der Strafanstalt in Brügge. Besondere Umstände machen es möglich, daß die Häftlinge den größten Teil des Tages gemeinsam in einer Zelle hockend verbringen. Dabei habe ich Gelegenheit, die merkwürdigsten Typen zu studieren. So einen Obergefreiten aus Koblenz, Frisör, 35 Jahre alt, ein langer, schwarzer Kerl mit hagerem Gesicht südländischer Rasse; ein intelligenter Bursche, der schon weit in der Welt herumkam: Er durchwanderte die Schweiz, Italien, Frankreich, Sizilien und fuhr als Schiffsjunge zur See bis nach Kapstadt. Er wuchs als Vollwaise auf, ein armer Teufel; erarbeitete sich am Westwall ein kleines Vermögen, heiratete und ist jetzt Vater von zwei Kindern. Ehemals Kolpingsbruder, vertritt er jetzt die Weltanschauung eines egoistischen Materialismus. – Ein anderer Obergefreiter, der sich als Deutschgläubig bezeichnet und seit 1930 Parteigenosse ist, bekleidet in der Dortmunder H. J. das Amt eines Referenten für Weltanschauung und Kultur und ist von Beruf – Schneider. Er trägt am Kopf noch Narben aus der Kampfzeit. – Ein dritter, ebenfalls schon 35 Jahre alt, ein Flieger aus Sachsen, schon drei Jahre Soldat, aber immer noch nicht befördert, verfügt über ein Register von wohl acht Militärstrafen: einer von jeden Typen, die ständig auffallen, aber ihr Schicksal mit erstaunlicher Gelassenheit und ingrimmigem Humor tragen. Nerven wie ein Drahtseil und ein Fell wie ein Elefant. Ein verwegener Bursche: alter Kommunist, saß 1934/35 zwei Jahre Gefängnis wegen politischer illegaler Tätigkeit ab. Ich habe mich eine ganze Nacht mit diesem roten Funktionär unterhalten, der mit Leidenschaft seine materialistischen Ideen verficht. Er ist vom Klassenhaß durchglüht, steht mir persönlich
aber recht freundschaftlich gegenüber. Er bezeichnet sich natürlich als Freidenker („ich glaube nur an die Natur“) und vertritt die Idee der Freikörperkultur. In Zivil ist er Transportarbeiter. Es ging ihm sehr dreckig im Leben. Zuhause hat er eine Braut mit einem unehelichen Kind. –
Da ich von allen Insassen die längste Strafe habe, dabei aber der einzige bin, der Kriegsauszeichnungen trägt, genieße ich unter meinen Kumpanen einen traurigen Ruhm. Bei stundenlangen Gesprächen sitzen wir beisammen, reden über Krieg, Glückspiele, Frauen, ferne Länder, fremde Völker und Reiseabenteuer, debattieren auch zuweilen über Gott und die Dinge der Religion oder über politisch-weltanschauliche Fragen, oder wir singen alte Lieder und versinken dabei in süße Erinnerungen – und bei alledem gewinnt die Welt für uns in unsrer engen, kahlen Zelle gesteigerte Größe und Farbenpracht. –
Gestern reichte ich eine sechs Seiten lange Beschwerde an den Regimentskommandeur ein. Ich wurde deshalb zum Adjutanten befohlen, der sich für meinen in der Tat recht merkwürdigen Fall sehr zu interessieren schien. Er gab mir noch einige Tips und wies mich auf einen Umstand hin, der sehr zu meinem Gunsten spricht, den ich aber übersehen hatte. Daraufhin faßte ich das Schreiben noch einmal neu – eine erwünschte Gelegenheit, die Zelle für ein paar Stunden mit einem gemütlicheren Lokal zu vertauschen. –
20.I. In den Stunden der Einsamkeit verbinden uns nur die Geräusche, die durch die Mauern des Gefängnisses an unser Ohr dringen, mit der Außenwelt. In der Morgenfrühe weckt uns der eigenartige Marschgesang der Russen-Kompanie, die in der Kaserne nebenan liegt und nun zum Dienst ausrückt. Später vernehmen wir das lärmende Geschrei der Kinder einer benachbarten
Schule. Im Laufe des Tages klingen die Weisen des Glockenspiels vom Belfried herüber; und abends begleiten uns die Gesänge der Russen in die Bezirke des Traumes hinein, in denen die Grenzen von Zeit und Raum verfließen und die Dingen sich geheimnisvoll verweben. –
Mittags einige Abgänge, dafür kommt ein Neuer, ein Obergefreiter aus dem Sudetenland, Metallarbeiter und Stalingradkämpfer. Er war kürzlich noch daheim in Urlaub, und so lasse ich mir über die politische Stimmung der Sudetendeutschen berichten. Dann Gespräche über die Lage der Fronten, über die Aussichten des Krieges und über die Haltung der Offiziere. Mit Grauen entdecke ich neue Zeichen beginnenden Niedergangs. Oder wie anders ist es zu deuten, wenn ein Graf als Major und Bataillonskommandeur nur deshalb bei seinen Leuten beliebt ist, weil er sie ungezügelt läßt und als gewaltiger Säufer und Stößer an ihren Orgien teilnimmt? Der Pesthauch des Verfalls greift schon den Adel an, und das ist der Anfang vom Ende. Hier und in anderen Dingen kündigt schon laut sich die nahe Auflösung an. –
20.I. (abends). Am Nachmittage eine Stunde Spaziergang auf dem Kasernenhof. Hier beobachtete ich die Russen beim Exerzieren. Ihre Gestalten nehmen sich in den deutschen Uniformen recht seltsam aus. Die Männer scheinen schon auf deutscher Seite im Einsatz gewesen zu sein, denn viele von ihnen tragen das Verwundetenabzeichen und einige das grüne Band des Ordens, der eigens für die Fremdenlegionen geschaffen ist. Die Kompanie untersteht einem russischen Offizier und wird überwacht von einem
deutschen Oberleutnant. Die Unteroffiziere sind Russen. Dem deutschen Hauptfeldwebel ist ein russ. Dolmetscher beigegeben. Die Kommandosprache ist abwechselnd deutsch u. russisch. – Ich frage mich, wozu diese russischen Truppen im Westen eingesetzt werden sollen. Ob man sie tatsächlich gegen Engländer kämpfen läßt? –
21.I. Zu meiner Verwunderung muß ich feststellen, daß der rote Funktionär in klassischer deutscher Opernmusik sehr bewandert ist. Er kennt ganze Partien aus Mozart, Beethoven und Wagner auswendig. –
Heute nachmittag neuer Zuwachs. Diesmal sind es zwei echte „Zöllner“ vom Grenzschutz, Männer von 50 Jahren, der eine aus Hamburg, der andere aus Lüdinghausen. –
Allmählich kristallisiert sich aus unserem Tagesablauf ein geregelter Dienstplan heraus. Um 10 Uhr stehen wir erst auf. Die ersten zwei Stunden vergehen mit Ofen anmachen, Morgentoilette und Frühstück. Wir haben Zeit, darum machen wir alles langsam. Nachmittags wieder ein Schläfchen, dann von 15-16 Uhr Spaziergang auf dem Kasernenhof. Anschließend Gespräche bis zum Abend, zwischendurch Abendbrot. Gegen 21 Uhr legen wir uns schlafen. In dieser Weise geht unsere Zeit rasch um. Daß sich der Besonderheit unserer Lebensweise entsprechende Umgangsformen herausgebildet haben, ist selbstverständlich. Der Unterschied der Dienstgrade besteht nicht mehr, und das „Du“ wird als einige Anredeform anerkannt. Wenn einer seinen „guten Tag“ hat, an dem er volle Verpflegung bekommt, so teilt er seine Portion brüderlich mit den Leidensgenossen. Ebenso
ist Tabak Allgemeingut. In allem herrscht ein praktischer, edler Kommunismus. –
22.I.
Obwohl ich vor 10 Uhr selten aufstehe, erwache ich doch meist schon um 6 Uhr von der Morgenkühle, die durch die Decken kriecht. Dann pflege ich die Decken fester anzuziehen, und so im Bette liegend, meditiere ich zwischen Träumen und Wachen. Dann sehe ich wieder die glücklichen Wochen in Bonn vor einem Jahr, oder ich male mir Berufsaussichten für die Zukunft aus. Oder ich ergehe mich in philosophische Spekulationen. So dachte ich heute morgen wieder über die Symbolik der Farben nach. Ich habe mir dazu in den letzten Wochen noch viele Notizen gemacht, und ich denke, diese Arbeit später in größerem Umfang neu zu fassen. So ist der Gedanke, daß Blau nicht nur die Farbe der myst. Unendlichkeit, sondern auch der Vernunft, die geschlechtslose Farbe des Rationalismus, dahin weiterzuentwickeln, wo Blau die Ordnung versinnbildet. Während das warme Rot die Farbe ist, die Dionys am angemessensten zu sein scheint, symbolisiert Blau das apollinische Prinzip. Das Blau an der Uniform des früheren preußischen Heeres und der Polizei. Bis in die kleinsten Dinge des Alltags hinein: die blauen Aktendeckel und die blauen Umschläge der Briefe von Behörden. – Das Insignum des Ordens Pour-le-mérite, das blaue Johanniterkreuz mit goldenen Adlern, scheint mir unter allen Auszeichnungen in Gestalt und Farbe die aesthetisch gelungenste und zugleich die symbolisch bedeutungsvollste zu sein. –
23.I. In einer Art von Galgenhumor schrieb ich an die Wand meiner Zelle:
Freund, laß es Dir sagen: Ein rechter Mann Fängt unter zehn Tagen Erst garnicht an.
So weckt die aufgezwungene Muße schöpferische Kräfte. Ich arbeite wieder an einigen Sonetten.
24.I. Gestern Abend wurden mit lautem Gepolter zwei betrunkene Matrosen eingeliefert. Man hatte sie in einer Kneipe nicht weit von hier aufgegriffen. So waren – wenigstens für eine Nacht – alle drei Wehrmachtteile hier vertreten. Heute Mittag zwei weitere Neue.
Morgens Alarm. Anstatt in den Luftschutzkeller zu gehen, zogen wir es vor, dem Schauspiel am Himmel zuzusehen. Bei schönstem Sonnenschein zog ein Geschwader nach dem anderen vorüber, Bomber und Jäger, ein krauses Gewirre von Kondensstreifen am blauen Himmel hinterlassend. Es mögen wohl mehrere hundert Maschinen gewesen sein. Geschossen wurde nicht, und man hatte ein friedliches, ja sogar heiteres Bild, in dem nichts auf die gefahrdrohende Wirklichkeit hinzuweisen schien. Zu alledem gesellte sich noch ein stark leuchtender Regenbogen, der – ein seltenes Naturphänomen – sich horziontal und genau über uns am Himmel erstreckte und länger als zwei Stunden zu sehen war, obwohl es überhaupt nicht regnete. Diese Erscheinung erhob die dröhnenden Geschwader in eine Sphäre schmerzloser Traumwirklichkeit.
26.I. Ich bin entlassen. So wäre auch dieses Abenteuer nicht ohne Gewinn überstanden.