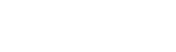KAS (Köln)
Gesamtbeurteilung der Klasse
Gutachten über Klasse OI a:
Die Klasse OIa, die jetzt noch 15 Schülerinnen hat, wurde Ostern 1946 als OIIa neu zusammengestellt.
Die Schülerinnen, die aus recht verschiedenen Schulen kamen, brachten sehr verschiedene Vorbildung mit. Nur sehr langsam haben sie sich zu einer geschlossenen Gemeinschaft zusammengefunden. Alle 15 Oberprimanerinnen sind ausnahmslos wertvolle junge Menschen, die zielstrebig an ihrer Charakterbildung arbeiteten und immer starkes Interesse für alle menschlichen und philosophischen Probleme zeigten.
Im Unterricht arbeitete die Klasse ruhig, aber mit gleichbleibendem Fleiss. Bei vielen guten Durchschnittsbegabungen kann die Klasse aber die Leistungen nicht aufweisen, die wir von einer Oberprima nach achtjährigem Besuch einer höheren Schule erwarten, da einerseits immer wieder Lücken der Mittelstufe, die in den langen Kriegsjahren entstanden, auszufüllen waren; anderseits die unzureichende Ernährung, die weiten Schulwege, die beengten Wohnungsverhältnisse, häusliche Pflichten und der Büchermangel nicht volle Leistungsfähigkeit zuliessen.
Beurteilung
Dorothee merkt man das gebildete Elternhaus und die häusliche Kultur an. Sie ist eine allseitig begabte Schülerin mit gutem Denkvermögen und sicherem Blick für geistige und menschliche Probleme, die sie mit sprachlicher Gewandtheit darzustellen vermag. Besonders lebhaftes Interesse und feines Empfinden zeigt sie in Musik und in den deutschkundlichen Fächern. Hier fällt sie durch eigene philosophische Fragestellung auf.
Die Auswahl ihrer Kameradinnen zeugt für ihr grosses Streben nach menschlicher Reife und Persönlichkeit. Schade ist es, dass sie in ihrem Ringen nach echter Menschlichkeit durch die nihilistischen Zeitströmungen sehr beeindruckt ist.
Lebenslauf
Ich bin am 30.IX.1929 als Tochter des Universitätsprofessors Hans Carl N. und seiner Ehefrau Hildegard, geb. E., in Köln geboren. Ich habe vier Geschwister, von denen mir, nach Alter und Entwicklungszustand wechselnd, immer ein anderes besonders nah und vertraut war. In den ersten Kinderjahren war mir Thomas, mein zwei Jahre älterer Bruder, unzertrennlicher Gefährte. Als er sich später immer mehr von mir fort und den Büchern zuwandte, war meine Schwester Sabine groß genug geworden, um an meiner bunten Welt teilzuhaben.
Wesenhaft bestimmt war diese Welt durch den großen Garten hinter unserem Hause. Blumen und Bäume wuchsen um mich herum, und auf den Frühling freute ich mich alljährlich noch mehr als auf Weihnachten. Daß wir in einer Großstadt lebten, ging mir erst viele Jahre später auf. Im Winter spielte ich voller Hingabe mit meinen Puppen. In langen, abenteuerlichen Geschichten, die ich meiner Schwester und mir selbst halblaut erzählte, ließ ich sie stets als lebendige, erwachsene Menschen handeln, kämpfen, lieben und große Gefahren bestehen.
Diese traumbunte, rauhe Welt trat verblassend in den Hintergrund, als ich mit fünfeinhalb Jahren in die Schule kam. Binnen kürzester Zeit wurde aus dem verträumten kleinen Mädchen ein rauflustiger Wildfang, dessen heißester Wunsch es war, ein Junge zu sein. Keine Schulstunde fiel so sehr meiner Verachtung anheim wie die Handarbeitsstunde, und dieses Gefühl bewahrte sich bis zur Untersekunda. Im übrigen ging ich herzlich gern zur Schule und hatte bald einen großen Freundeskreis. Die beiden letzten Volksschuljahre waren überstrahlt vom Glanz der Freundschaft mit Michael, einem Klassenkameraden. Was ihn für mich deutlich über die andern hinaushob, war, daß er selbst das Feuer hatte und nicht erst angezündet zu werden brauchte. Es war nicht nötig, ihn zu begeistern, weil er es selbst war. Verwandt klangen seine Ideen, Pläne und Vorstellungen den meinen, vor allem aber: sie brannten in ihm, wie sie in mir brannten: glühend, rücksichtslos, fraglos und gebietend. Michael war der Punkt meines Lebens, wo das traumhaft-versponnene mit der ungebändigten Wildheit zusammenfloß.
Den wie hätte es anders sein können, als daß die Träume verborgen weitergeglüht hätten? Hatte ich doch in diesen Jahren zum erstenmal mit Bewußtsein die Sterne gesehen und mehr als alle anderen Dinge angestaunt und geliebt! Konnte es doch geschehen, daß ich mitten im Versteckspiel Mozart hörte und alles andere vergaß. Und vor allem: hatte sich mir doch eine andere Welt aufgetan, in der wieder nicht Menschen sondern Dinge, nämlich Blumen, Berge, Wälder und Wiesen das Bestimmende waren. Es war ein kleines Dorf bei Berchtesgarden, in dem wir wie alljährlich unsere Sommerferien verbrachten. Nie wieder später hat mich eine Landschaft vom ersten Augenblick an so völlig in Besitz genommen. Es war das „Land Ohne-angst", und meine Spielgeschichten handelten nicht mehr von Rittern und Königen ,_ sondern von Zwergen und Sennern.
Ostern 1939 verließ ich tiefbetrübten Herzens die Volksschule und kam zur Kaiserin Augusta Schule. Bei Kriegsausbruch sah ich zum erstenmal einen verzweifelten Menschen, meine Mutter. Tagelang lief sie wie zerbrochen herum und weinte fassungslos. Es erschreckte mich, aber ich begriff noch gar nicht, was Krieg hieß und erfuhr es auch erst langsam, von Beginn des Rußlandfeldzuges an. Auch die Schule lief zunächst genauso weiter wie sonst.
Damals verschlangen Thomas und ich den ersten Karl-May-Band, dem bei mir mindestens fünfundzwanzig weitere folgten. Ich habe bestimmt drei Jahre lang nichts als Indianer gespielt; Lehrerinnen waren in meinem Munde nur "Bleichgesichter", Schulfreundinnen „rote Brüder". Daß dieses Spiel nicht fade wurde und dann eintrocknete, sondern mit einem Ruck von außen abriß, habe ich später sehr dankbar empfunden; damals war ich tieftraurig, als wir alle durch die Evakuierung auseinandergesprengt wurden.
Unterdessen war ein neuer wichtiger Mensch in mein Leben getreten: eine Lehrerin, für die ich zunächst sehr backfischhaft und albern schwärmte. Ich wußte aber schon damals, daß mein Gefühl tiefer reiche als das der Kameraden, und in dieser Tiefe trotz der vielen Worte irgendwo unausgesprochen und bleibend stand, einen hellen Schein durch mein Leben werfend. Daß mir gänzlich unverdient eine tiefe und reichmachende Freundschaft mit diesem selten gütigen Menschen zuteil wurde, ist noch heute ein unbegreifliches Wunder. Ich war in eine heilsame Hand geraten, die vor allem meine Intoleranz auf das energischste bekämpfte. Denn im Gefühl einer geistigen Überlegenheit über die andern tat ich alles, was ich nicht verstand, mit einer Handbewegung und „Quatsch!" ab.
Es war darum nur gut, daß ich damals die Freundschaft älterer Menschen zu suchen begann, je komplizierter mir die Sache mit dem Leben und vor allem die mit dem lieben Gott vorkam. Mit dreizehn Jahren erlebte ich einmal einen Frühlingsabend in unserm Garten mit ganz anders aufgetanen Sinnen und anders klopfenden Herzen als je früher. Ein Apfelbaum war kein Apfelbaum mehr sondern ein blühendes Wunder. Als ich zufällig ein Buch umblätterte, fand ich ein Goethewort: „Über viele Dinge können wir uns nie ganz verständlich machen. Darum, über viele Dinge kann ich nur mit Gott reden." Es war zum erstenmal in meinem Leben, daß mich ein Wort traf. Ein Tor in mir ging plötzlich auf, und ich staunte überwältigt in eine neue Welt. Daß gleichzeitig das alte Tor für immer zufiel, habe ich erst viel später begriffen. Vorläufig sah ich nur, daß dieses Überwältigende das Eigentliche war und daß die Wichtigkeiten eines Bratapfels, einer Klassenarbeit, eines Tintenflecken völlig gegenstandslos und töricht waren. Es war nur natürlich, daß in diesem Aufwachen auch die Opposition mitaufwachte. Waren es doch die Lehrer, die Klassenarbeiten für wichtige Ereignisse hielten, betrachteten doch die Mütter einen Tintenflecken als ein Unglück! Aber das andere war es, auf das es ankam! Ich liebte es in der Unausgesprochenheit, und vielleicht ging damit zusammen, daß ich mich schon nach einem halben Jahr Klavierstunde ganz unwiderstehlich zu Bach hingezogen fühlte. Hier war, was mir fehlte.
Solange meine beiden älteren Brüder noch zu Hause waren, wurde bei uns fast den ganzen Tag Musik gemacht. Wir spielten alle fünf Klavier und zwei Brüder Cello und Geige. Manchmal, wenn ich abends im Bett lag, hörte ich Carl, meinen ältesten Bruder, Brahms-Intermezzi spielen. Ich meinte dann, daß diese Musik zu schön sei. Mit keinem Wort war sie zu benennen, jedes Gefühl wurde zu eng und zu klein, und das Herz wollte mir zerspringen, glaubte ich doch, daß so später einmal das Leben sein werde, randvoll dieser so gänzlich ungeahnten Seligkeiten und Schmerzen. Ich hörte die Stücke mit derselben Deutlichkeit Ton für Ton noch einmal, wenn Carl schon lange den Flügel geschlossen hatte.
Auch dies fehlte mir sehr, als ich die Sommer 1942 und 43 wegen der Fliegergefahr in Darmstadt bei meiner Großmutter verbrachte. Sie wurde für mich Beispiel eines Menschen, der Haltung bewahrt, was auch geschehen möge. Sonst freilich fand ich keinen Menschen und war sehr heimwehtraurig, besonders als ich 43 zum erstenmal nicht nach Ramsau fahren durfte. Schön war mir das Herumstöbern in der Bibliothek meiner Tante. Dabei fand ich vor allem ein Inselbändchen mit Hermann Hesses Gedichten, die freilich mehr Bestätigung meiner Traurigkeit als Trost enthielten. Eine Zeitlang war ich Mitglied des Mädchen-Bibel-Kreises (MBK), aber ich merkte bald, daß ich mich selbst betrogen hatte und hier nichts von dem war, was ich eigentlich meinte. Ich versuchte auch im Konfirmandenunterricht zu glauben, was der Pfarrer sagte; das Mißlingen dieses Versuches lag nicht nur an den vielzu ruhigen und salbungsvollen Worten, die er wählte. Ungesichts des Schrecklichen, das ich doch erst langsam und nur stückweise zu Gesicht bekam, konnte ich nicht an die Liebe Gottes glauben. Ich spürte den Widerspruch, der darin lag, sich dann trotzdem konfirmieren zu lassen. Aber zu einer konsequenten Ablehnung war ich noch zu jung und fühlte auch, daß darüber jetzt noch keine Entscheidung gefällt werden durfte. Ich gab das Versprechen ab und beschloß im übrigen, immer weiter zu suchen, von ganzem Herzen. In diesem Sinne - dem Bereitsein - hörte ich soviel Musik, wie nur irgend möglich. Es war sehr still bei uns geworden, da nun auch Thomas als Luftwaffenhelfer eingezogen war. Er kam jedoch häufig auf Urlaub, und wir sangen dann zusammen Schumann, Brahms und vor allem immer wieder Schubert. Wie in ganz früher Kinderzeit trieben wir nun alles gemeinsam. Musik, Bücher, Verse und Freundschaften wurden stets miteinander erlebt. Der Sommer 44 war die schönste Zeit meines Lebens, vielleicht weil wir spürten, wie bedroht und unwiederbringlich uns alles war. Im Frühling machten wir eine Reise nach Straßburg, in die Heimat meiner Mutter. Die Rose des Münsters erschien mir damals wie ein Symbol der unbegreiflichen, unendlichen Schönheit der Welt. Ich lernte ein Mädchen kennen, die zu ihrer Laute Freude und Klage in einem Lied zu singen wußte. Nie bin ich soviel gewandert, nie habe ich soviel Verse geschrieben und gesungen wie in diesem Sommer. Das stets begleitende Buch war der „Konradin", (Gmelin) und in den Briefen fand ich zuweilen dieses kurze, alles besagende Wort: wir reiten!
Im Herbst 1944 schlossen die Schulen, und wir gingen nach Jena. Es mag sein, daß ich wieder einmal intolerant und arrogant war, woran es vielleicht in Darmstadt lag, daß ich mich nicht wohlfühlte, aber auch beim besten Willen blieb mir hier alles fremd, kalt und leer. Die Schule erschien mir ebenso unerträglich wie das „zu Hause". Was ein Schlager war, wußte ich damals nur vom Hörensagen. Daß Musik, für meine Begriffe das Schönste und Tiefste auf der Welt, auch häßlich, entwürdigend, gemein gebraucht werden konnte, daran hatte ich noch niemals gedacht. Hier sangen die Mädchen - und zuvor auch die, mit denen man sich über das „Einfache Leben" unterhalten konnte - in jeder Pause nichts als Schlager, vor allem immer wieder jenen, mir so unglaublich ekelhaften „In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine ...". Derartige Dinge existierten in meinem Elternhaus nicht. Sie wirkten um so grotesker, je verzweifelter die militärische Lage wurde. Hätte ich nicht damals im Hause meiner Verwandten das E-moll-Quintett von Brahms mehrmals und sehr gut gehört, so wäre ich am liebsten taub geworden.
Auch die Lehrer hatten für mich fast alle etwas Gespenstiges. Einer las uns z. B. Ende Februar 1945 Aufrufe von Körner 1813 vor. Als einige lachten, fing er an zu weinen. Obwohl ich zu niemandem darüber sprach, erschütterte mich das alles stärker, als ich selbst wußte. Ich fing wieder an zu grübeln und wollte durchaus den Sinn des Lebens erfahren. Es war weniger der Hunger und die Gefahr, die mich so verzweifeln ließen, als das allgemeine Schicksal. Was mir als selbstverständlich immer im Hintergrund gestanden hatte, wurde nun offenbar und brennend. „Deutschland trägt man im Herzen oder nirgends und nie!"
Schließlich floh ich - wenn auch als Flucht unbewußt - in die Bücher. Ich verschlang ein Drama nach dem andern und liebte vor allem Kleist und Shakespeare.
Am 31.XII.1944 brannte unser Haus in Köln aus. Es war gar nicht der materielle Verlust, der mich so sehr betrübte, aber mein Gefühl des Heimwehs wurde nun zu einem bitteren der Heimatlosigkeit, das sich noch nicht wieder ganz verloren hat. Gut war, daß Carl damals öfters auf Urlaub kam. Er fühlte sich für uns, „die Kleinen", mitverantwortlich und war, obwohl er es bestimmt viel schwerer hatte, hoffnungsfreudiger und tapferer als wir alle.
Nach dem Einmarsch der Amerikaner vergingen noch drei Monate in verzweifeltem Warten auf die Heimkehr. Unterdessen kehrte mein Bruder Otto aus der Gefangenschaft zurück. Kurz vor der Übergabe an die Russen verließ ich Thüringen und blieb nach einer einzig schönen Autofahrt durch Deutschland für vier beruhigende, erholsame Wochen in Darmstadt. Anfang August waren wir wieder zusammen in Köln und warteten nur noch auf Carl, der zuletzt aus der Tschechei geschrieben hatte. Ich sagte nichts, ja ich tröstete meine Mutter und machte ihr Hoffnung, aber in Wahrheit glaubte ich ebensowenig wie sie, daß er heim käme.
Wenige Tage vor Schulbeginn im November 1945 kam dann die Nachricht, daß er im September auf dem Transport in die Heimat gestorben war.
Aber das Leben kümmerte sich nicht darum und lief weiter. Für uns war das Schlimmste die Trauer unserer Mutter. Für sie gab es weder Trost noch Sinn, und ich dachte damals oft, wie allein doch jeder Mensch ist und wie man keinem andern helfen kann und wenn man ihn noch so lieb hat.
Für mich selbst entdeckte ich ein wunderbares Betäubungsmittel, die Arbeit nämlich, in die ich ganz bewußt floh, um die Stimmen von innen zu übertönen. Ich lief vor allem weg, was etwa das Herz bewegen könnte wie Musik, Gedichte und liebe Menschen. Noch nie hatte ich meine Schulaufgaben so sorgfältig und ordentlich gemacht; im übrigen vermied ich alles Reden.
Erst im nächsten Frühjahr spannten sich die Fäden zu den alten Menschen wieder. Ich war vor allem viel mit jener einstigen Lehrerin zusammen und als sie ein Jahr später eine große Erschütterung durchlebte, die auch mich sehr bewegte, hatte ich zum erstenmal das Gefühl, nicht ganz überflüssig zu sein. Wie denn überhaupt die Beziehung von Mensch zu Mensch mir das einzig bleibende zu sein schien. Ich gab das Suchen nach Jenseitigem, Überirdischen, immer mehr auf und wollte lieber trotzigen Herzens und spottenden Mundes ein guter Mensch werden. Aber in Wahrheit war mein Herz mehr traurig als trotzig, und mein Mund spottete nur, um nicht zu weinen.
Im Frühling 1946 begann ich Griechisch zu lernen, ohne zu ahnen, daß es sich für mich nicht um eine neue Sprache, sondern um eine neue Welt handelte. Zunächst fand ich rein ästhetisch Freude an dem schönen Klang, interessierte mich dann rein rational für Grammatik und Sprachform, um schließlich eben als Mensch in einem viel tieferen Sinne getroffen zu werden, als ich etwas von der Lebenshaltung der Griechen erfuhr. Ich glaubte nun, was sie glaubten, soweit ich dies sehen konnten: die Götter als Lebenswirklichkeiten, das Schicksal als unbegreiflich und fast immer verhängnisvoll und die Menschen als Schuldige in diese dunkle Welt gestellt, um trotzdem auszuharren und etwas Großes zu schaffen. Als ich später Homer las, wurde dieses Bild erst farbig und plastisch, und ich liebte Achill, wie ich einst Winnetou geliebt hatte. Schuld an dieser so sehr klärenden und weitenden Begegnung hatte nicht zuletzt der Mensch, der sie mir vermittelte; wie es mir überhaupt in den letzten Schuljahren in den für mich wichtigen Fächern Musik und Religion so erging, daß die Sache erst durch den Menschen in vollem Licht aufstrahlte und zu einer eigentlichen wurde.
Was mir - damals beginnend - immer wieder geschah und geschieht, fand ich einmal bei Rilke so formuliert: „da ist keine Stelle, die dich nicht trifft. Du mußt dein Leben ändern." So trafen mich Worte aus der Bibel, so die Pathétique, so Stellen aus Sokrates' Dialogen und so vor allem Hölderlin.
Die geistige Atmosphäre meines Elternhauses und die Gespräche meiner studierenden Brüder zeigten neben sehr viel Positiven wie auch ihre Gefahren, die in der Anregung und in dem Reden von Dingen, von denen ich nichts verstehe, bestanden. Gesteuert wurde diesen Gefahren durch wachsame ältere Menschen und durch gute Kameraden, mit denen ich auf Fahrt ging. Auch mein Bruder Otto mit dem mich neben vielem die Freude an recht törichten und närrischen Dingen verbindet, war ein gutes Gegengewicht.
Im letzten Jahr bildete sich ein neuer Freundeskreis, eine Bindung, die ganz bewußt im Hinblick auf das Allgemeingültige, Wesenhafte geschah.
Was die Zukunft anlangt, so ist bisher noch nicht zu sehen, ob und wofür im Besonderen ich begabt bin. Ich kann darum kein äußeres Berufsziel angeben. Es scheint mir dies auch eine sekundäre Frage zu sein, angesichts dessen, daß ich nichts weiter werden will als das eine, so unglaublich Schwere, ein Mensch.
Das Studium in der Philosophischen Fakultät ist mir die meiner Entwicklung gemäße Form dieses Versuchs. Wie auch mein Beruf später sein werde, er bleibt Mittel oder Verwirklichung jenes Höheren.
Da ich mich länger mit der englischen Sprache beschäftigt habe, bitte ich, in diesem Fache eine schriftliche Prüfungsarbeit machen zu dürfen.