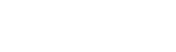KAS (Köln)
Gesamtbeurteilung der Klasse
Gutachten über Klasse OI a:
Die Klasse OIa, die jetzt noch 15 Schülerinnen hat, wurde Ostern 1946 als OIIa neu zusammengestellt.
Die Schülerinnen, die aus recht verschiedenen Schulen kamen, brachten sehr verschiedene Vorbildung mit. Nur sehr langsam haben sie sich zu einer geschlossenen Gemeinschaft zusammengefunden. Alle 15 Oberprimanerinnen sind ausnahmslos wertvolle junge Menschen, die zielstrebig an ihrer Charakterbildung arbeiteten und immer starkes Interesse für alle menschlichen und philosophischen Probleme zeigten.
Im Unterricht arbeitete die Klasse ruhig, aber mit gleichbleibendem Fleiss. Bei vielen guten Durchschnittsbegabungen kann die Klasse aber die Leistungen nicht aufweisen, die wir von einer Oberprima nach achtjährigem Besuch einer höheren Schule erwarten, da einerseits immer wieder Lücken der Mittelstufe, die in den langen Kriegsjahren entstanden, auszufüllen waren; anderseits die unzureichende Ernährung, die weiten Schulwege, die beengten Wohnungsverhältnisse, häusliche Pflichten und der Büchermangel nicht volle Leistungsfähigkeit zuliessen.
Beurteilung
Elvira D. fällt durch ihren grossen, fast unjugendlichen Ernst und ihre charakterliche Reife auf. Aus tiefer Religiösität stellt sie hohe Anforderungen an sich. Sie verfügt über klaren Verstand und eine Fähigkeit zum abstrakten Denken, die sich in den deutschkundlichen, wie auch in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern zeigt. Sie sieht Probleme, geht ihnen mit Zähigkeit nach und versteht sie sprachlich geschickt darzustellen.
Ihre Leistungen entsprechen zeitweilig nicht ganz der guten Begabung, da sie durch die Sorge für den elterlichen Haushalt und für die kranke Mutter, aber auch durch ihren eigenen wechselnden Gesundheitszustand nicht immer voll leistungsfähig ist. Ihr zeichnerisches und handwerkliches Können, Fähigkeiten, die in den letzten Jahren nicht zur Geltung kamen, müssen besonders hervorgehoben werden.
Lebenslauf
Als Tochter des Lehrers Max D. und seiner Ehefrau Anna, geb. B. erblickte ich, Elvira Jutta D., am 2.5.1929 in Köln das Licht der Welt und wurde dort am 7.5. in der Severinskirche getauft. Bald darauf hielt ich, noch ein hilfloses Bündel, an einem strahlenden Frühlingsmorgen meinen Einzug in dem großen, grauen Schulhause Kreutzhäuschen bei Overath, freudig begrüßt von den Bewohnern, skeptisch, ja eifersüchtig beblinzelt von Wotan, unserm Schäferhund. Hier, auf dem Lande, fern vom Getriebe der Großstadt in wohltuender Einsamkeit, verbrachte ich die frühesten Kinderjahre. Die Schule lag an der Landstraße auf einer Anhöhe, teils von nahem Wald, teils von Wiesen umgeben, weit ab von den nächsten Einzelhöfen. Ich entbehrte nicht des Lichts, der Luft und Sonne. Anfangs lag ich strampelnd im Wagen unter den Bäumen des Gartens, von Wotan bewacht, der sich schnell mit mir abgefunden hatte, und der, wie mir meine Eltern oft erzählten, von Zeit zu Zeit seine Schnauze behutsam über den Wagenrand legte, um nachzuschaun, ob sein Schützling noch da sei. Später, als ich meine ersten Gehversuche machte, war Wotan mein liebster Spielgefährte, der sich willig alles gefallen ließ und mit mir herumbalgte. So kannte ich niemals Furcht vor Tieren, sondern betrachtete sie als meine vierbeinigen Kameraden, die ich alle einmal streicheln mußte. In der schönen Umgebung wurde vielleicht damals schon in mein Herz der Keim zur Naturliebe gelegt. Ich ging an keinem Blümlein am Wegesrand vorbei, an keinem Käfer, den ich entdeckte, ohne sie genau zu betrachten, sammelte Steine und bunte Blätter. Als ich fest „auf meinen eigenen Füßen" stand, fühlte ich mich ganz als Persönlichkeit. Ich suchte die Höfe auf, schloß Freundschaft mit den Bauern und dem Schäfer. Wie viel besser schmeckte es doch am Bauerntisch unter den Mägden und Knechten! Gern besuchte ich meinen Vater in der Schulklasse im Unterhaus, worüber er freilich nicht sonderlich entzückt war, und setzte mich in eine Bank unter die Dorfkinder. Doch wenn ich den Unterricht störte, stellte er mich gar unbarmherzig vor die Tür. In den Pausen machte ich mit bei alten Kreisspielen, im Winter rodelte mein Vater mit mir die vielen Abhänge hinab durch den glitzernden Tannenwald. Wie herrlich war doch die Zeit auf diesem Fleckchen Gotteserde!
Mein viertes Lebensjahr brachte mir eine schmerzliche Enttäuschung, die ich noch heute empfinde. Im Sommer 1932 wurde mein Vater nach Köln versetzt, und somit wurde meinem ungebundenen Leben in der Natur der erste Riegel vorgeschoben. Wo blieben die Tiere, der Wald und der Garten? Meine Eltern zogen jedoch in einen gesunden, freieren Vorort, nach Zollstock, in dem ich bald das Vergangene vergessen konnte. Mit den vielen Kindern des Wohnblocks wurde auf der Wiese hinter dem Hause Ball gespielt oder ein Zelt gebaut. Im Winter versorgte ich meine Puppenkinder, die ich wie Menschen handeln und sprechen ließ. Mein bester Freund aber war mein Vater, der sich oft mit mir beschäftigte. Ich zeigte damals ein erstaunliches Zeichentalent, das ich vielleicht von ihm geerbt hatte. Oft saß ich stundenlang unentwegt vor meinem Zeichenheft und legte Erlebnisse ohne Anleitung nieder, hantierte mit Buntstift und Pinsel wie ein Alter, brachte so mit unübertroffenem Feuereifer Bilder zustande, die weit über mein Alter ragten und vergaß dabei Essen und Trinken. Mein Vater hob alle meine Zeichen- und Malblätter vom dritten Lebensjahre an mit Bemerkungen auf, die aber leider im Kriege verbrannten. Wie gern rutschte ich auch in der Dämmerung auf meines Vaters Schoß und lauschte den lieben Märchen von verzauberten Prinzen und bösen Hexen so andächtig, daß vor Rührung oder Angst heiße Tränen meine Backen hinunterkollerten.
Im April 1935 marschierte ich als stolzer ABC-Schütze in die neue Schule in Zollstock, die ich vier Jahre besuchte. Ich war eine eifrige, fleißige Schülerin, der gewöhnliche Erklärungen nie genügen konnten. In dankbarer Weise gedenke ich meiner damaligen Lehrerin, Frau O. Fels, die mich mit großem Verständnis leitete. Leider war ich fast das ganze erste Volksschuljahr hindurch bettlägerig, da ich viele Kinderkrankheiten durchmachte. Der neue Pflichtenkreis eröffnete mir auch einen Freundeskreis. Ich trollte viel auf der Straße umher, spielte Hüppekästchen und fuhr Rollschuh mit unerschöpflicher Ausdauer, kletterte über Zäune und auf Bäume, ja meine Eltern behaupten, ich hätte es so getrieben, daß sie mir eine Sepplhose anpassen wollten. Meine Ferien verlebte ich meist bei meinen Großeltern im Vogtland. Bei schönen Tagen machte ich mit Großvater oder Onkel herrliche Ausflüge durch die Wälder, bei Regentagen besuchte ich meine alte Freundin dort, eine Schneiderin, und nähte unter ihrer Anleitung aus Resten Puppenkleidchen.
Am 17.9.1937 bekam ich ein Brüderchen geschenkt, Lothar Torolf, das mich erst schrecklich enttäuschte, da ich mir sehnsüchtig ein Schwesterchen gewünscht hatte. Obwohl ich nun nicht mehr die erste Geige spielte, hatte ich mich doch bald getröstet, zog Lothar Puppenkleider an und fuhr ihn in der Wohnung im Puppenwagen umher. Später, als er sich nicht mehr alles gefallen ließ, und er mir, „wenn er einmal sooo... groß sei, seine Dresche anbot", kam es manchmal zu kleinen Zäckeleien, war doch der Altersunterschied beträchtlich. Als dann wurden die Boxkämpfe berufsmäßig zur Stählung ausgeführt. Mit zehn Jahren, im letzten Friedensjahre, ging ich zur 1. hl. Kommunion und gab so meinem bisherigen Leben den würdigsten Abschluß; denn nun trat ich in einen neuen Bereich ein.
Ostern 1939 wurde ich nach bestandener Aufnahmeprüfung Schülerin der Kaiserin Augusta Schule, Karthäuserwall. Ich werde nie die ersten schönen Monate auf der höheren Schule vergessen! Mit vollem Interesse widmete ich mich dem neuartigen Unterricht, außer Turnen, das meine schwache Seite war zum Leidwesen meines Großvaters mütterlicherseits, eines aktiven Turners. Unter den fremden Gesichtern hatte ich mich bald eingewöhnt, jedoch wurde ich mit der Zeit stiller und ruhiger. Gern hatte ich die Handarbeitsstunden, in denen ich Märchen erzählen oder mit anderen, vor allem um die Weihnachtszeit, Laienspiele aufführen durfte. Damals war auch in einem kleineren Teil der Klasse eine „Indianer-Epidemie" ausgebrochen, von der ich auch angesteckt wurde. Ich verschlang sämtliche Karl May-Bände, die ich nur ergattern konnte, traf mich mit meinen „roten Schwestern" im Wigwam, die Friedenspfeife (die eines Weckmanns), zu rauchen und das Kriegsbeil zu vergraben.
Da begann, gerade als ich wieder bei meinen Großeltern weilte, der Krieg, der so bald unser friedliches Glück mit eiserner Hand zerstörte. Als ich die Kriegserklärung im Radio hörte, schnürte mir ein unheimliches Etwas die Kehle zu, ohne daß ich wußte, warum. Ich hatte ja noch nichts Schlimmes erlebt, war vor dem Elend des Lebens gehütet worden. Unsere sofortige Heimreise von der tscheschischen Grenze war durch die Truppentransporte von längerer Dauer, und als ich im verdunkelten Köln ankam, packte mich ein Grauen. Bald gab es die ersten Fliegeralarme. Waren sie noch so harmlos gegen die der folgenden Jahre, so raubten sie uns doch die Nachtruhe. Wie oft rüttelte die Mutter uns Kinder bei Alarm aus dem Schlaf, halb träumend zogen wir uns an und torkelten schlaftrunken in den Keller. Später schliefen wir Kinder meist die ganze Nacht auf Holzpritschen unten, wenn der Drahtfunk dauernde Luftgefahr meldete. Der Schulunterricht setzte oft aus, da die Bahnen nicht fuhren, die Schulgebäude zerstört worden waren. Die meisten Schulstunden brachten wir im Keller zu, während sich die Eltern daheim ängstigten. So konnten wir nicht so viel lernen wie eigentlich der Lehrplan vorschrieb, zogen von einem Trümmergebäude in das andere um und teilten es noch mit zwei weiteren Schulen. Dennoch fand ich noch Muße genug zu solchen Beschäftigungen, die mich die Schrecken von draußen zeitweilig vergessen ließen. Ich spielte Klavier und oft begleitete mich mein Vater mit seiner Geige. Auch hatten wir uns ein riesiges Puppentheater gebaut, das ich mit Karikaturen bemalte. Daneben fiel mir die Bekleidung der Puppen und die Ausstattung zu. Mein Bruder brachte seine Spielgefährten mit, und dann begann die Vorstellung. Ich hatte andächtige Zuhörer, selbst Erwachsene waren darunter, denn ich spielte richtige Theaterstücke mit Kulissen, Beleuchtung usw., teils nach Vorlage, teils aus eigener Phantasie. Leider störte uns oft Sirenengeheul und Flakfeuer.
Da es im Frühjahr 1944 mit den Angriffen zu schlimm geworden war, fuhren mein Bruder und ich zu den Tanten nach Falkenstein im Vogtland. Ich besuchte dort die Knabenoberschule, anfangs mit innerem Sträuben, denn es herrschte darin ein regelrechter „Kommißton". Wir wenigen Mädchen mußten strammstehen und reden wie Jungen, es gab Morgenappelle und Pflichtsammlungen. Bald jedoch wurden die Lehrkräfte eingezogen, sodaß der Unterricht ruhte. Als eine Bremer Jungenoberschule mit ihren Lehrern nach Falkenstein evakuiert wurde, konnte ich mit den Einheimischen an ihrem Unterricht teilnehmen, der mir sehr zusagte. Vor allem fesselten mich die naturwissenschaftlichen Fächer. Als Kriegsdienst erhielt ich von der Schule den Auftrag, die Seidenraupenzucht zu versorgen. Das Leben und die Fütterung der Raupen beobachtete ich eifrig. Im Sommer fiel uns Schülern noch die Arbeit zu, vor der Stadt Wälle aufzutürmen und Schutzgräben zu bauen. Bald kam meine Mutter zu uns, und wenige Tage darauf traf die Nachricht meines Vaters ein, daß eine Sprengbombe in den Keller unseres Hauses gefallen sei, unsere Wohnung aber noch stünde. Die Bewohner waren mit einem blauen Auge davongekommen. Plötzlich im November kam mein Vater, nur mit einem kleinen Handkoffer, und überbrachte die Hiobsbotschaft, daß wir am 28. Oktober 1944 alles verloren hätten. Das war für meine Eltern ein harter Schicksalsschlag, den ich damals noch nicht in seiner Tragweite erfassen konnte. Ich trauerte nur meinem kleinen „Eigentum" nach.
Mein Vater unterrichtete nun im Nachbarort, in dessen Schule, die schon mit Ostflüchtlingen belegt war, wir uns ein Zimmer notdürftig einrichteten. Da wir keinen Herd hatten, nahmen wir an der Lagerverpflegung teil. Bald wurden die Schulen geschlossen, die Alliierten rückten immer näher an den Ort heran. Auf den Umhöhen zögerte plötzlich der Vormarsch, und wir lagen ungefähr drei Wochen bei Tag und Nacht unter Artilleriebeschuß, teils wenig, teils heftig. Die Einwohner flüchteten in die Keller. Uns konnte das nicht mehr erschüttern, auch nicht die riesigen Schwärme von Fliegern, die vorüberzogen und die Nachbarorte, wie Plauen bombardierten. Wir bekamen drei Monate kein Fleisch, kein Fett, keine Kartoffeln, lediglich 2 Pf.[!] Brot wöchentlich. Um den Hunger zu stillen, haben wir Brennesseln und Otterzungen gekocht und selbst Kartoffelschalen gegessen und magerten so zu Skeletten ab. Das sind keine Märchen, sondern leider Tatsachen.
Am 7.5.1945 endlich erfolgte der Einmarsch der Amerikaner. Damit setzte allenthalben ein Zurückfluten der Evakuierten nach dem Westen ein, denn jeder strebte nach Beendigung des Krieges, in seine Heimat zurückzukehren. Da keine Züge fuhren, Brücken und Straßen zerstört waren, bedeutete dies ein schwieriges Unternehmen. Wir hatten anfangs nicht die Kraft und genug Verpflegungsmittel, uns auf den Weg zu machen. Als wir unsern Paß erhielten und sich uns eine günstige Fahrgelegenheit bot, besetzten die Russen über Nacht Sachsen und Thüringen. Jetzt gestaltete sich die Rückreise noch schwieriger, da man der Willkür der russischen Truppen ausgesetzt war, sämtliche Straßen und Übergänge in Stadt und Land abgesperrt wurden. Mit Handgepäck gelangten wir im Juli teils zu Fuß, teils mit Lastwagen unter großen Schwierigkeiten bis zur „grünen" Grenze, an der uns ein Halt geboten wurde. Die Posten ließen uns trotz der Pässe nicht durch. Von Gerüchten vorgetrieben zogen wir Tage, ja Wochen, die Grenze entlang, von einem Ort zum andern. Wir übernachteten vor Schlagbäumen, in Schulen, Scheunen und schmutzigen Bahnhöfen, auf Gras, Stroh, Diehlen und Stühlen, - mit uns viele tausend Flüchtlinge mit Kisten, Kasten und Wagen, die sich langsam angesammelt hatten. Wir mußten uns an den Türen etwas Nahrung erbetteln und führten so ein regelrechtes Landstreicherleben. Wir schleppten uns die sandige Landstraße entlang, bei glühender Hitze und bei Regen, mit schalen Versprechungen oder Drohungen von den russischen Kommandanten von einem Dorf ins andere getrieben, - doch der Schlagbaum blieb geschlossen. Noch heute klingt mir das Gerappel der vielen Handwagen in den Ohren, wenn ich daran denke. Wie oft bin ich darüber im Schlaf, von einem bösen Traum verfolgt, aufgeschreckt.
Schließlich gelang es uns, in Fernbreitin[=?]bach bei Gerstungen bei einer freundlichen Lehrerswitwe ein Unterkommen zu finden. Wir hatten nun einige Wochen Ruhe und Ausspannung, endlich wieder ein warmes Essen und eine bessere Schlafgelegenheit, wenn es auch nur ein Strohsack war. Da auf russischen Befehl die Schulen im Herbst wieder eröffnet werden sollten, setzte sich mein Vater mit der Schulbehörde in Verbindung, die ihm die Schulleiterstelle des größeren Nachbarorts Lauchröden übertrug, zu dem wir später übersiedelten. Um nicht müßig zu sein, arbeitete ich bei einzelnen Bauersleuten auf dem Felde, was mir sehr große Freude bereitete. Sie hätten mich gerne als Hilfe dabehalten, als wir abfuhren. Ich verdiente mir so Kartoffeln und Gemüse für unsern Bedarf und kam durch die gute Kost wieder zu Kräften. Dazu unternahm ich kleine Wanderungen in die nähere Umgebung, suchte in den Wäldern Pilze und Beeren. In trübsinnigen Stunden half mir das Klavier, das in der Schule stand, über meinen Kummer hinweg.
Im Winter 1945 erhielten wir die amtliche Ausreisegenehmigung. In einem Sammellager in Eisenach faßte man uns Westevakuierte zusammen und schob uns nach Erledigung aller Formalitäten in einem Sonderzug mit Loren nach dem Westen ab. Nach vielen Irrfahrten, Umladungen, Aufenthalten, Entlausungen, Untersuchungen und Verhören kamen wir nach zehntägiger Reise in der Weihnachtswoche in Köln an, nachdem die Rückfahrt von Falkenstein mit ihren Unterbrechungen beinahe ein halbes Jahr gedauert hatte. Wir übernachteten im Dombunker und fanden schließlich bei Bekannten auf der rechten Rheinseite ein Obdach. Im Januar 1946 meldete ich mich in der Kalker Schule in den Gebäuden des Flughafens Ostheim an.
Im März 1946 zogen meine Eltern in eine schwer zerstörte Dienstwohnung in Raderberg, die wir uns erst mit großer Mühe einigermaßen bewohnbar herrichteten. Es gefiel mir gut in der Kalker Schule, aber da auf die Dauer der Schulweg durch die Stadt über die Holzbrücke zu weit war und ich gern wieder in meine alte Kaiserin Augusta Schule zurückwollte, meldete ich mich nach Ehrenfeld um, wo ich heute die Oberprima besuche. Meine liebsten Fächer sind Mathematik, Physik, Biologie, Geschichte, Deutsch und Religion. Was die neueren Fremdsprachen betrifft, so möchte ich die schriftliche Prüfungsarbeit in Englisch schreiben. Kenne ich doch diese Sprache schon einige Jahre vor dem Französischen.
Die Schulaufgaben, denen ich mich gerne genau widme, lassen mir jetzt leider keine Gelegenheit für Mußestunden. Meine freie Zeit fülle ich im Haushalt aus, um meine Mutter bei ihrer Arbeit etwas zu unterstützen. Als sie voriges Jahr fünf Wochen im Krankenhaus lag, spielte ich ohne Hilfe Hausfrau, d.h. ich kochte und backte, nähte und flickte, putzte und schrubbte mit Begeisterung, angespornt von dem Lobe meiner Eltern. Auch schneidere und stricke ich mir jetzt meine Kleidung selbst. Im Sommer dieses Jahres erteilte ich an Knaben der Oberschule Privatunterricht und konnte so einmal meine Befähigung zum Lehrerberuf prüfen.
Die Zukunft steht noch rätselhaft vor mir. Da meine Eltern total ausgebombt sind und durch die Währungsreform ihr Vermögen verloren haben, ist das Universitätsstudium, was doch von jeher mein Wunsch war, für mich noch in Frage gestellt. Andere Fachschulen, wie die pädagogische Akademie sind vorläufig für Neuaufnahme gesperrt. Andererseits habe ich auch das Bestreben, bald auf eignen Füßen zu stehen, damit die finanziellen Lasten meiner Eltern nicht zu schwer fallen.