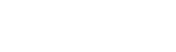KAS (Köln)
Vorbemerkung
Leider ist für beide Sonderlehrgänge des Jahres 1946 im Schularchiv nur ein einziger Lebenslauf einer Abiturientin überliefert.
Gesamtbeurteilung des Sonderlehrgangs B
Charakteristiken für den Sonderlehrgang b.
Beim Beginn des Lehrganges b waren für die Klasse 25 Schülerinnen angemeldet. Während der Vorbereitungszeit traten 8 aus verschiedenen Gründen zurück; gleich nach den Weihnachtsferien kamen noch 2 hinzu, sodass die Klasse jetzt 19 Schülerinnen aufweist. Die jüngste zählt 17, die älteste 23 Jahre, das Durchschnittsalter beträgt jetzt 19 Jahre.
Den Reifevermerk bzw. die Versetzung nach Klasse 8 erhielten 6 an der Kaiserin-Augusta-Schule, 6 an der Oberschule in der Machabäerstr., 5 an verschiedenen auswärtigen Schulen, 1 bereitete sich nach einer nicht bestandenen Reifeprüfung als Externe privat vor (s. Anlage).
Etwa die Hälfte der Schülerinnen zeigte gute Begabung, über dem Durchschnitt liegende Sonderbegabungen traten in den erteilten Unterrichtsfächern nicht hervor.
Von Anfang an erfreute die Klasse durch gutes Streben und anerkennenswerten Fleiss. Wenn nicht alle entsprechende Leistungen erzielten, so liegt der Grund zur Hauptsache an den bekannten Ursachen: beschränkte Wohnverhältnisse; weiter, oft sehr beschwerlicher Schulweg; schlechte Ernährung; Belastung durch ausserschulische Arbeiten. Zu einem argen Hemmnis gestaltete sich auch der Mangel an Büchern und Papier.
Die aus mancherlei Schulen hergekommenen Mädchen haben sich zu einer guten Klassenkameradschaft zusammen geschlossen. Ihr Verhalten zu den Lehrern war höflich und voller Vertrauen.
Vorschläge für den deutschen Aufsatz des Sonderlehrgangs B
1.) Verlorene Kostbarkeiten.
2.) Abschied von ... (einem Ort oder einem Menschen, die uns lieb waren)
3.) Viele Blumen tun sich der Sonne auf, doch nur eine folgt ihr immerfort. Herz, sei die Sonnenblume; nicht bloß offen sei dem Gott, sondern gehorche ihm auch. Raabe.
4.) Der Drang nach einem Stern adelt und hebt über sich hinaus. Wehe dem armseligen Herzen, das nicht von ihm erfüllt ist; es geht blind durch die Strassen der Welt und mit verschlossenen Ohren. Finckh.
Beurteilung
Gisela ist die Jüngste der Klasse, sie wird erst nach der Reifeprüfung 18 Jahre alt. Sie ist ein frisches, natürliches Mädchen, von gesundem Aussehen; aber sie leidet an Schwächezuständen mit Ohnmachtsanfällen. Früher war Gisela recht eigenwillig, sie stand im Widerspruch zu allem, was ihr irgendwie veraltet erschien. Die schweren Schicksalsschläge, die unser Land trafen und der Tod ihres sehr geliebten Vaters haben sie gereift. Sie bewahrt jedoch immer noch eine frische anmutige Kindlichkeit. Gisela ist gut begabt. Ihr klarer Verstand, ihre gründliche Auffassung und ihr gewandter Ausdruck machten sie zu einem wertvollen Mitglied der Klassengemeinschaft. Im deutschen Aufsatz erzielte sie mehrmals sehr gute Leistungen; sie erfreute die Klasse oft durch ihren schönen Vortrag von Gedichten. Sie ist künstlerisch ganz besonders begabt und möchte die Kunstakademie in Düsseldorf besuchen. Einige ihrer Illustrationen zu Kinderliedern erscheinen demnächst in einem Braunschweiger Verlag. Die Klasse besitzt in ihr eine hilfsbereite, wertvolle Kameradin.
Abituraufsatz
„Viele Blumen tun der Sonne sich auf, doch nur eine folgt ihr immerfort. Herz, sei die Sonnenblume; nicht bloß offen sei dem Gott, sondern gehorche ihm auch."
Wir Menschen sind ich-bezogen. Die meisten Dichterworte interessieren uns nur dann, wenn wir ihre innere Wahrheit an uns selbst erfahren haben. Als ich dieses Wort Raabes zum ersten Male las, war mir, als hätte der Dichter beim Schreiben nur an mich gedacht. Die Forderung erfaßte mich tief: „... nicht bloß offen sei dem Gott, sondern gehorche ihm auch." Es ist schwer, von sich selbst zu reden, aber wenn ich irgendetwas von dem Spruch sagen soll, kann ich es nur im Gedanken an eigenes Erleben, Erleben, so zwingend und unentrinnbar, wie man es, glaub ich, nur einmal haben kann. Und darum muß ich davon sprechen.
Ich wuchs auf in einem Hause voll Harmonie und Stille als eigenwilliges, verträumtes und nachdenkliches Kind. Meine Eltern waren nicht das, was man gewöhnlich unter dem Begriff „fromm" versteht. Meine Mutter war Protestantin, mein Vater Katholik, und aus diesem Grunde wurden mein Bruder und ich protestantisch getauft. Meine Eltern gingen selten zur Kirche, und fast nie sprach irgendeiner von Dingen bei uns, die Kirche oder Glauben angingen. Dennoch weiß ich, daß meine Mutter tief gläubig war. Nie vergaß sie, abends mit mir zu beten, und sie ist diejenige gewesen, die meine Vorstellung von Gott begründete. Ich war in jenem Alter unermüdlich im Erforschen und Erfragen aller Dinge - warum die Sonne scheine und weshalb man abends schlafen gehen müsse und wohin Knecht Ruprecht mit den unartigen Kindern im Sack gehe; allein es gab Dinge, die außerhalb jeder Frage standen, die festgegründet und selbstverständlich und naturgegeben waren, und zu diesen Tatsachen, mit denen man sich fraglos abfand, rechnete ich auch Gott. Er war da, ohne daß man darüber gesprochen hätte, er half aus allen kleinen und großen Nöten und strafte, wenn man ungehorsam gewesen war; er sah und wußte alles, man redete nicht von ihm, - er war ganz einfach da, und ich liebte ihn mit aller Kraft und allem Vertrauen meines kindlichen Herzens, war eine der „vielen Blumen, die sich der Sonne auftun."
Ich weiß nicht, wodurch sich diese Einstellung so grundlegend änderte. Es mochte an meinem Alter liegen, jenem Alter, da die Fragen und Zweifel auftauchen, auf die es keine Antwort gibt; es mochte an meinem Interesse für soviel Dinge liegen, die gar keine Verbindung mit den Fragen des Glaubens hatten und die mich sehr in Anspruch nahmen; es mochte endlich auch an der Zeit liegen und all den Widersprüchen, die sie in sich schloß, - ich weiß es nicht, ich weiß nur, daß ich Gott vergaß. Ich hörte auf, mit seiner Existenz zu rechnen, ich übersah ihn, und zwischen seinem Himmel und meiner Erde lag ein Raum, der unüberschreitbar schien - ich gehörte nicht mehr zu den Blumen, die ihm immerfort folgen.
Jung, begeistert für alles Schöne, dabei äußerst selbstbewußt, neigte ich zur Skepsis andern Dingen, andern Anschauungen, andern Menschen gegenüber und kritisierte alles, angefangen bei den Launen meiner Mitmenschen bis zur Vorsehung, - nur eines überging ich dabei - mich selbst. Niemand konnte mir etwas vormachen über die Menschen und die Welt; Gott - ach, er war wohl da, aber wie sollte er sich für diese kleine, lächerliche Erde überhaupt interessieren - es war unmöglich, sich vorzustellen, daß er auch nur irgendetwas von mir wußte und wissen wollte.
Und dann kam der Krieg. Ich wurde nicht gottzugewandter durch ihn; wohl demütiger, stiller, nachdenklicher. Aber wer vermochte noch an Gott zu glauben? Täglich brachen Städte in Rauch und Asche zusammen, täglich verbrannten Tausende von Büchern, Bildern, Instrumenten, und täglich, stündlich starben Menschen, um die andere Menschen so bitterschweres Leid trugen. Ein Reich brach zusammen, ein Volk ging zugrunde, und die am Leben blieben, saßen auf Trümmern und hatten nichts als einen ungeheuren, dumpfen Schmerz, eine tiefe Enttäuschung und eine Leere, die furchtbarer war als alles andere.
Ich begriff nichts mehr, ich verzweifelte nur an allen Idealen, die ich je gehabt hatte, mein Glaube an göttliches Walten schien endgültig zerstört - und wie mir, so ging es vielen, vielen anderen jungen Menschen. Heute weiß ich einen Sinn in dieser Verzweiflung, weiß, warum alles so kommen mußte.
Viele Blumen tun der Sonne sich auf - ach nein, ich war noch nicht aufgetan, noch nicht bereit für die Sonne. Ich war nichts mehr als ein armes, hoffnungsloses, enttäuschtes Menschenkind, das unendlich litt an den Trümmern seines Glaubens und seiner Ideale. Ich fragte nicht mehr: „Warum?" - das „Umsonst!" der Niederlage war zu furchtbar gewesen. Ich war nur noch eine einzige stumme Anklage für den, der solches zulassen konnte!
Ich erwartete auch keine Antwort auf diese Anklage, ich schwieg trotzig in mich hinein, und da gab mir Einer Antwort, den ich längst totgeglaubt hatte - auf einmal war es, als begänne die Leere in mir zu klingen; der Raum zwischen dem Unbekannten und mir verringerte sich, ein Tor öffnete sich sekundenlang und ließ mich ahnen, daß ich im Dunkel war. Es war nicht Gott, der kam, aber es waren die Stille und die Erwartung, die mich öffneten für ein Größeres und die Ihm vorangingen.
Ich war verwirrt und wie geblendet, ich tastete unsicher voran und verlor wieder und wieder den Weg, der sich mir aufgetan hatte. Der Same der Sonnenblume begann sich zu regen - aber viel, wie viel mußte noch an mir geschehen, bis ich nicht mehr vergaß, daß es Einen gab, dem ich wichtig war und der mich rief.
Ich begegnete einem Menschen, dem Menschen, den ich brauchte, um klarer zu erkennen, was ich nur dunkel fühlte. Wir kannten uns vom ersten Augenblick unserer Begegnung an, ohne es uns zu gestehen. Wir schwiegen lange voreinander und verbargen uns hinter Hochmut und Kühle - bis uns ein Unbekanntes zueinander zwang. Ich erlebte nie zuvor die Gewalt eines Menschenherzens so stark - aber wir waren wohl füreinander bestimmt. Es war wie ein sanftes, starkes Licht, das über mir hereinbrach und mich alles sehen ließ, was ich zu sehen begehrte; alles, was ich nur gespürt hatte, wurde mir nun bewußt: Gott ist nicht die ferne, überweltliche Macht, die irgendwo im Nichts ruht und von der wir durch Äonen geschieden sind. Gott ist die Ewigkeit, die uns aufhebt, die Gnade, die uns überwältigt, die Liebe, die uns trägt und die nur ein Einziges verlangt: Hingabe, bewußte, restlose Hingabe - wie Rilke sagt, wir müssen „der Tiefbesiegte von immer Größerem sein."
Ich kenne jetzt den Willen, in dessen Gewalt wir beide damals standen, der uns zueinanderzwang, um einen durch den andern zu befreien. Da aber, zu jener Zeit, wußte ich es noch nicht, daß es kein Wehren gab gegen die Stimme, die mich rief. Ich war nur wie getrieben von einer Ahnung und geöffnet dem Gott, der zu mir kommen wollte. Ich stand erst am Anfang eines langen Weges, den vielleicht keiner zu Ende geht; und ich verirrte mich oft. Ich glaubte, ich müsse mich ganz aufgeben, müsse alles, was mir einmal gehört hatte, hinter mir lassen, um zu Gott zu gelangen. Ich wollte ein anderer Mensch werden, - bis ich mit einem Male begriff, daß ich das nicht könne und daß Gott das auch nicht wolle. Denn wie sollte ich Ihm treu sein, wenn ich mir selber nicht treu blieb? Ich mußte einen anderen Weg gehn und mußte wieder allein weiter, denn der Weg des Menschen, der mich bis hierhin brachte, war hinfort nicht mehr meiner. Ich ging wieder allein, und doch nicht allein, denn es blieb mir ein Wort Bergengruens:
Der Engel spricht: gehorche! Was für ein Lohn dir bereitet? Ich habe dir keine Verheißung zu sagen. Dir zu Füßen ist Meer gebreitet; unberaten und unbegleitet sollst du das Wagnis des Petrus wagen. Ob dich die Wellen wie Hände tragen, ob der Herr dir entgegenschreitet - , ich weiß es nicht, - und du darfst mich nicht fragen!
Ich hatte schon manches aufgegeben. Aber ich hatte bis dahin nicht erkannt, daß das Bereitsein allein zu wenig war. Ich glaubte der fordernden Stimme zu genügen im Erkennen des Höheren, das über mir war. Aber - „nicht bloß offen sei dem Gott, sondern gehorche ihm auch." Ich wußte nicht, daß Gehorchen noch mehr ist, noch, wie schwer es ist.
Ein so Großes ist um den Gehorsam, daß man es zuerst gar nicht zu ermessen imstande ist. Es ist ein Ruf, ein Geheiß darin, das unser Letztes verlangt. Und ich kämpfte, ach nein, ich kämpfe mit diesem Befehl, wie es nur einer kann, der so viele Zweifel und Fragen, soviel Hochmut und Trotz hat wie ich, der so erdverhaftet und gottesfern ist wie ich. Ich glaube, Raabe war ein sehr alter, weiser Mann, als er diese Worte fand - es liegt ein ganzes Leben darin, ein Leben voll Kampf und Selbsthingabe, und keiner weiß, ob er je hineinwächst in diesen Gottesgehorsam. Der Mensch ist aus zähem Stoff gemacht - und noch habe ich mich nicht geändert, bin noch nicht weiter auf dem Weg zu Gott oder nur ganz wenig. Ich bin so selbstbewußt und trotzig und schwach und blind gegen alle meine Fehler wie je zuvor. Aber ich glaube, ich glaube an die Gnade und daran, daß es eine Macht gibt, eine Gewalt, der ich verfallen bin auf immer und die mich nie mehr entläßt, auch wenn ich mich sträube und wehre. -
Nichts ist mehr zufällig in meinem Leben, alles ist irgendwie gewollt. Mir ist, als sei ich in eine seltsam veränderte Lage zu allen Dingen gekommen; alles sieht ein wenig anders aus, es ist etwas Neues, Ungewohntes um jedes Ding, jeden Menschen, dem ich begegne, und alles ist mir beglückende Versicherung: Gott ruft dich!
Dennoch ist nur ein Ring geschlossen; denn bin ich nicht, auf vielen Umwegen, seltsam verwandt jenem Kinde, das abends gläubig und zuversichtlich in seinem Bettchen betete und das alles Leid, alle Not, alle Fragen getrost Dem überließ, der unser Leben in seiner Hand hält? -
Bekenntnisse sind schwer und schmerzen immer. Doch war es der Spruch, der mich anrührte und mir irgendwie neue Klarheit gab:
Viele Blumen tun der Sonne sich auf; doch nur eine folgt ihr immerfort. Herz, sei die Sonnenblume; nicht bloß offen sei dem Gott, sondern gehorche ihm auch!
Ich bin der Sonne aufgetan worden; ob ich ihr immerfort folgen kann? Noch ist mir mein Weg fremd, unvertraut; ich gehe fast wie ein Träumender, unsicher und zögernd und verirre mich oft, auch so oft! Aber ich glaube, daß sich dies einmal erfüllen wird:
Herz, sei die Sonnenblume; nicht bloß offen dem Gott, sondern gehorche ihm auch.
Alleine werde ich es nicht können, so ganz Sonnenblume werden. Ich bin zu sehr erdverhafteter, gebundener, schwacher Mensch, zu sehr ein gottesferner Träumer, aber es gibt ein Wissen, das jenseits aller Vernunft ist, ein Wissen, das Kraft und Mut und Hingabefähigkeit bedeutet, das Wissen: ich bin gerufen!
Ich spüre deine ruhigen Hände, die meine Seele still betasten und noch nicht wissen, wo sie rasten und halten sollen. Herr, o wende dich nicht zu frühe ab von mir! Ich bin so starr, so erdgehalten, ich kann noch nicht die Hände falten und trage nicht den Blick aus dir. Du hängst, ein mächtiges Gewitter und dunkeldrohend über mir und schweigst. Ich fürchte mich vor dir und muß bei deinem Namen zittern. Doch spüre ich dich manche Stunde; dann bebt mein Herz in deiner Hand. Ich habe dich noch nie erkannt, ich fühle dich nur, tief im Grunde; doch kann ich dich noch nicht ertragen und meine Seele fliehet dich. Herr, deine Hand betastet mich und findet mich voll dunkler Fragen ...
(12.V.1946)
Hier spricht ein junger Mensch, angeregt durch Raabes Wort, innerstes Erleben aus. Der Leser steht ehrfurchtsvoll vor diesem Bekenntnis.
Die Leistung liegt über dem, was man von der Klasse erwarten darf.
Sehr gut.
Die Jahresleistungen waren sehr gut und gut.
25.V.1946.
N. Heusgen.