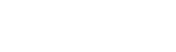KAS (Köln)
Gesamtbeurteilung der Klasse
Gutachten über Klasse OI a:
Die Klasse OIa, die jetzt noch 15 Schülerinnen hat, wurde Ostern 1946 als OIIa neu zusammengestellt.
Die Schülerinnen, die aus recht verschiedenen Schulen kamen, brachten sehr verschiedene Vorbildung mit. Nur sehr langsam haben sie sich zu einer geschlossenen Gemeinschaft zusammengefunden. Alle 15 Oberprimanerinnen sind ausnahmslos wertvolle junge Menschen, die zielstrebig an ihrer Charakterbildung arbeiteten und immer starkes Interesse für alle menschlichen und philosophischen Probleme zeigten.
Im Unterricht arbeitete die Klasse ruhig, aber mit gleichbleibendem Fleiss. Bei vielen guten Durchschnittsbegabungen kann die Klasse aber die Leistungen nicht aufweisen, die wir von einer Oberprima nach achtjährigem Besuch einer höheren Schule erwarten, da einerseits immer wieder Lücken der Mittelstufe, die in den langen Kriegsjahren entstanden, auszufüllen waren; anderseits die unzureichende Ernährung, die weiten Schulwege, die beengten Wohnungsverhältnisse, häusliche Pflichten und der Büchermangel nicht volle Leistungsfähigkeit zuliessen.
Beurteilung
Schwere Kriegsschicksale haben Maria mit ihrer Mutter und fünf kleineren Geschwistern aus ihrer ostpreussischen Heimat nach Köln gebracht. Im Arbeitsdienst, im Kriegseinsatz in einer Munitionsfabrik, auf der gefahrvollen Suche nach ihren Eltern, durch die Zwangsarbeit unter den Russen und Polen in Ostpreussen und auf der furchtbaren Fahrt nach dem Westen hat sie das Leben von der grausamsten Seite kennen gelernt. Es ist schwer, hinter ihr Wesen zu schauen, da sie sehr verschlossen ist. Die Sorge für eine kranke Mutter und fünf jüngere Geschwister und die sehr beengten Wohnungsverhältnisse haben ihr die Schularbeit sehr schwer gemacht. Bei ihrer nur mittelmässigen Begabung ist es ihr trotz des grossen Fleisses nicht ganz gelungen, die Lücken, die durch die Kriegsverhältnisse entstanden, ganz auszufüllen.
Obschon sie weit älter als ihre Mitschülerinnen ist, hat sie sich in die Klassengemeinschaft völlig eingeordnet.
Lebenslauf
Am 7.8.1925 wurde ich als 7. von 13 Kindern des Bauern Andreas B. und seiner Ehefrau Hedwig, geb. G., in Thalbach, einem kleinen freundlichen Dörfchen des Kreises Braunsberg in Ostpreußen, geboren und auf den Namen Maria Elisabeth getauft. In ländlicher Stille, ganz in der Geborgenheit des Elternhauses habe ich eine glückliche Kinderzeit verlebt. Mit 6 Jahren kam ich in die Volksschule in demselben Dorfe. Der Unterricht machte mir sehr viel Freude. Sobald ich lesen konnte, waren Bücher meine besten Freunde, die ich immer wieder hervorholte. Doch schon früh, als ich etwa 10 Jahre alt war, konnte ich auf meine jüngeren Geschwister achtgeben. Sie waren meine einzigen Spielgefährten. - Nach 6 Volksschuljahren wurde ich in die Quinta der Oberschule für Jungen in Wormditt aufgenommen. Den 4 km langen Schulweg mußte ich mit dem Fahrrad zurücklegen, was im Sommer wohl sehr angenehm, im Frühjahr und Herbst jedoch bei den Stürmen und der schlechten Straßenbeschaffenheit weniger erfreulich war. Wenn es im Winter gar zu kalt war, wurden wir mit dem Schlitten zur Schule gefahren, ein ganz besonderes Vergnügen für uns.
In der höheren Schule habe ich stets mit sehr viel Eifer meine Aufgaben gemacht. Englisch, Mathematik und Biologie waren meine Lieblingsfächer.
Doch schon im nächsten Jahr brach der Krieg aus, der so schwere Folgen für uns haben sollte. Meine beiden älteren Brüder wurden zum Wehrdienst gerufen, desgleichen sämtliche deutschen landwirtschaftlichen Hilfskräfte. Wir Kinder mußten nun zu Hause viel mithelfen. Nach dem Polenfeldzug erhielten wir polnische Kriegsgefangene und später auch weibliche ausländische Kräfte. Die schlechte Verständigungsmöglichkeit und auch die Unzuverlässigkeit dieser Ausländer forderte unsere doppelte Mitarbeit. So mußten wir uns recht früh in der Haus- und Landwirtschaft betätigen. Jeder aufgabenfreie Nachmittag und jede freie Stunde waren nun voll ausgefüllt. Ich war besonders gern auf dem Felde. Gibt uns doch gerade diese Arbeit ganz in Gottes freier Natur eine rechte Befriedigung. Und ganz besonders an Erntetagen spürt man die tiefe Verbundenheit mit dem Land. Wanderungen und Ferientage an der Ostsee waren Erholung nach arbeitsreichen Tagen.
In der Schule machten sich die Kriegsverhältnisse durch dauernden Lehrerwechsel sehr bemerkbar. Oft hatten wir einen Fachlehrer nur 6-8 Wochen. Der Musikunterricht fiel aus, einige Zeit danach auch der Zeichenunterricht. Unser Oberstudiendirektor war sehr nationalsozialistisch eingestellt. Man sagte ihm nach, zu seiner Stellung nur durch Förderung seitens der N.S.D.A.P. gekommen zu sein. Diese Haltung konnte auf den Gesamtcharakter der Schule nicht ohne Wirkung sein. So fehlte zum Beispiel nach der 3. Klasse jeder Religionsunterricht. In den folgenden Jahren griffen Kohlenferien und im Sommer monatelanger Ernteeinsatz sehr nachteilig ins Schulleben ein.
Seit 1941 war die Schule oft wegen Einquartierung mehrere Monate geschlossen. Wegen Lehrermangels legte man je 2 Klassen zusammen, so auch unsere 6. mit der 7. Als Unterrichtspensum galt der Stoff der 7.
Meine Mutter war zu dieser Zeit stark herzleidend, so daß meine etwas ältere Schwester und ich sie sehr unterstützen und sie wochenlang in unserem 14-18 Personenhaushalt ganz vertreten mußten. Hatte ich trotz meiner angeborenen Zurückhaltung im Unterricht bis jetzt immer zu den besten Schülerinnen gezählt, so fingen meine Leistungen jetzt an zurückzugehen.
Im August 1941 fiel mein älterer Bruder in Rußland.
Im Sommer 1944 wurde ich in die 8. Klasse versetzt und mußte anschließend Ernteeinsatz machen. Am 9. November kam dann ganz plötzlich die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Nach bewährter Reichsarbeitsdienst- und Kriegshilfsdienstzeit sollte uns das Notreifezeugnis gegeben werden. Meine Arbeitsdienstzeit begann in einem Musterlager in Ostpreußen. Es herrschte ein streng militärischer Dienst, der uns (fast alle Maiden waren Schülerinnen) anfangs recht schwer fiel. Doch unsere Lagerführerin hatte auch Sinn für wahres Frauentum und echte Lebensfreude, sodaß ich mich noch recht vieler schöner Stunden erinnern kann. Im Außendienst war ich bei zwei ganz alten Leuten, denen der Krieg den einzigen Sohn genommen hatte. Vielleicht haben sie in mir Stütze und Hilfe gefunden. Durch meine landwirtschaftlichen Kenntnisse konnte ich ihnen auch praktisch überall zur Hand gehen. Ich sehe noch die Freude der alten Frau, als ich ihr das Melken der beiden Kühe abnehmen konnte.
Ende Januar sollte das Lager eine Auswahl Maiden zum Luftwaffendienst stellen. Ich war leider auch dafür ausersehen, und so begann die Vorbereitungszeit mit langen nationalpolitischen Vorträgen und anderen Schulungen. Doch auch praktischer Dienst in Haus und Küche wurde fleißig geübt. - Am 23. Januar 1945 kam dann ganz plötzlich der Räumungsbefehl. In 2 Stunden mußte das Lager verlassen sein. Der Anfang der Flucht! Schwer bepackt mit Dienstsachen marschierten wir mit Fahrrädern zur nächsten Kreisstadt. Es war Glatteis und 15° Kälte. Wir standen nachts um die Abteilfenster. Die Angst vor der nahen Russengefahr brach nun über uns herein. Dazu kam die Ungewißheit um den Verbleib der Eltern und Geschwister. Vielleicht zum letzten Mal sahen wir unser friedliches ostpreußisches Land. Der Schnee flimmerte in der sternklaren kalten Mondnacht, und nur ganz in der Ferne rollte ein dumpfer Geschützdonner. Tiefes Schweigen herrschte auch unter uns, obwohl wir damals noch nicht begreifen konnten, was diese Flucht für uns bedeuten sollte. In Königsberg herrschte auf dem Bahnhof schon eine Panik, und nur mit größter Mühe war es uns möglich, durch die Fenster in den Zug zu kommen. - Schon in den ersten Tagen hatte ich genug Gelegenheit, Elend und Not zu beobachten, daß mich darüber meine eigene Sorge um die Angehörigen weniger quälte. 10 Tage verbrachten wir in ungeheizten Bahnwagen oder zum Teil offenen Viehwagen bei 20° Kälte. In Pommern machten wir 2 Tage in einem Holzbarackenlager Rast, und schließlich endete unsere Reise in Schnackenburg an der Elbe. In einem R.A.D. Lager fanden wir Unterkunft und mußten einer Scharlachsperre wegen 7 Wochen dort verbringen. Da es an Raum für gemeinsame Beschäftigung fehlte und wir das Lager nicht verlassen durften, war die Zeit manchmal sehr lang, denn auch Bücher waren nicht da. Dazu kam die Unruhe der einzelnen, denn fasst niemand hatte eine Nachricht von den Angehörigen. Der Wehrmachtsbericht wurde immer genau verfolgt, und ich erinnere mich noch des Tages, als ich hörte: „Um Wormditt wird erbittert gekämpft." Vereinzelte Schreckensnachrichten drangen zu uns; zum Beispiel daß der Frost nachgelassen hätte und auf dem frischen Haff 60 Flüchtlingswagen hintereinander gesunken wären, daß die Russen Greueltaten verübt hätten und dergleichen mehr.
Am 23. März schickte man uns als Kriegshilfsdienstmaiden nach Grasleben bei Helmstedt in eine Heeresmunitionsfabrik. Wir wohnten in einer verwanzten Steinbaracke ohne jede Betreuung und mußten 10 Stunden täglich unter Tage arbeiten. Hier lernte ich Fabrikleben und Fabrikmenschen kennen. Die Not dieser oft alleinstehenden Fabrikmädchen hat mich tief beeindruckt. Die Arbeit war sehr eintönig und fast geisttötend.
Als man auch hier den Geschützdonner der Westfront deutlich hören konnte, entließ man uns ohne Geld und Ziel mit einem Urlaubschein auf Abruf. Da ich von meinen Verwandten und Bekannten im Osten wie im Westen durch die Frontlinie getrennt war und ich in Mitteldeutschland niemanden hatte, fuhr ich nach Berlin zu meiner Großtante, der ich dann dank meiner Unerschrockenheit und meiner starken Nerven etwas durch die schwere Zeit hindurchhelfen konnte. Während der 14 Tage des dauernden und starken Beschusses und der Luftangriffe habe ich fast für das ganze Haus die wenigen möglichen Einkäufe gemacht, da alle Hausbewohner sich nicht aus dem Keller wagten. -
Am 2. Mai kamen die Russen! -
Den Tag werde ich nie vergessen!
Schon am nächsten Tag mußte ich mit den übrigen Hausbewohnern Barikaden wegräumen und Straßen säubern. Nur durch Verkleidung und Verstellung war es mir möglich, einer Verschleppung zu entgehen. Da meine Tante in den letzten Tagen noch ausgebombt war, mußte ich ihr eine neue Wohnung suchen, was fast gänzlich unmöglich war.
Die Ungewißheit über den Verbleib meiner Eltern und Geschwister ließ mir keine Ruhe. Eine Postverbindung gab es nicht, so war eine Erkundigung unmöglich. Ich entschloß mich daher, zu Fuß nach Ostpreußen zu gehen. Am 25. Mai gaben die Russen den Befehl, jeder müsse dorthin, wo er vor 1939 gewohnt habe. So ging ich an demselben Tage von Berlin fort, entgegen den Warnungen meiner Verwandten und Bekannten. Bereits in Lichtenberg erfuhr ich von einem Zug nach Frankfurt/Oder. Da ich fast kein Gepäck hatte und auch ganz allein war, gelang es mir, mich in 5 Tagen über Dirschau - Marienburg nach Wormditt durchzuschlagen. Schon in den Zügen zeigte sich die Gewalttätigkeit und Willkür der Russen und auch der Polen. Den heimkehrenden Flüchtlingen wurden noch die letzten geringen Habseligkeiten genommen. - Die Marienburg, die ich mit 14 Jahren wohl mit Staunen und Bewunderung, aber doch wenigem Verständnis gesehen hatte, fand ich nun fast völlig zerstört vor. Doch durfte man sich auf der Straße nicht sehen lassen, wenn man nicht sofort aufgegriffen und in ein Lager transportiert werden wollte.
Schon in Pommern war ich immer nur durch Dörfer gefahren, in denen jedes Haus verödet und verlassen war, weder Menschen noch Tiere waren zu erspähen. Je weiter ich nach Osten kam, um so größer wurde die Zerstörung und Verwüstung. Nach einem 25 km Fußweg kam ich in meiner Heimatstadt Wormditt an. Dort wohnten in einer schlechten Straße unter Bewachung 500-600 Deutsche oft in den menschenunwürdigsten Verhältnissen. Die übrige Stadt war von Tausenden von Russen bewohnt. Hier erfuhr ich von den furchtbaren Greueltaten der Russen, von der großen Zahl der Verschleppten und der Toten auch aus meinem Bekanntenkreis.
Von den Russen wurde ich sofort zur G.P.K. geschleppt und genauestens mehrmals verhört. Jetzt begann für mich die eigentliche Schreckenszeit, in der die Zwangsarbeit noch den besten, ruhigsten Teil des Tages einnahm. Nach 10 Tagen kamen meine Eltern, eine ältere und 4 jüngere Schwestern von der Flucht zurück (300 km Fußweg mit einem kleinen Handwagen). Unsern Hof wie das ganze Dorf fanden wir völlig zerstört vor. Nicht ein Haus in der ganzen Stadt war von der Zerstörungswut der Russen verschont geblieben, vor allem war die Entweihung und Schändung der Kirchen und Klöster unbeschreiblich.
In der Stadt wurden uns 2 fast leere Zimmer angewiesen. Es begann für uns jetzt ein Leben, das man einer Gefangenschaft gleichstellen kann, zumal wir eine achtköpfige Familie waren. (Mein Vater war 68 Jahre alt, leidend, meine Mutter desgleichen krank, meine jüngste Schwester 7 Jahre alt.)
Jeden Morgen wurden die arbeitsfähigen Frauen, Mädchen und Jungen (Männer gab es fast keine) wie auf dem Sklavenmarkt verhandelt oder mußten gemeinsam Zwangsarbeit leisten. Kirchen, Schulen, Ärzte, Krankenhäuser, Geschäfte, alles fehlte gänzlich. Man lebte monatelang nur von Kartoffeln, die man in Kellern unbewohnter Häuser fand und von den 200 gr. Brot, die die Russen den Arbeitenden zuteilten. Kranke und Alte mußten elend umkommen. Unbeschreiblich war die leibliche und seelische Not jener furchtbaren Zeit, deren grausamste Wirklichkeit sich uns ganz offenbarte. Aber ein Asyl war uns noch geblieben; in einem alten, von starken Mauern geschützten Kloster zelebrierte ein alter Geistlicher täglich die hl. Messe. Dorthin stahlen wir uns in der noch nächtlichen Dunkelheit, um uns immer wieder neue Kraft zu holen. Der Wert unseres Glaubens leuchtete uns klarer als je zuvor auf, wir alle lebten nun bewußter.
Nach etwa einem halben Jahr zogen die Russen ab, die Gewaltherrschaft der Polen mit der Grundeinstellung Rache, Vergeltung begann. Gummiknüppel und Gewehrkolben wurden nicht selten in Gebrauch genommen. Weder Geistliche noch Ordensfrauen wurden verschont. Im November 1945 ging der erste Transport nach Deutschland. In 10 Minuten erfolgte die Ausweisung völlig unvorhergesehen und schon auf dem Bahnhof die völlige Ausplünderung.
Meine ältere Schwester und ich erkrankten im Sommer mehrere Wochen am sogenannten Hungertyphus. Infolge der schlechten Ernährungslage und der Ermangelung eines Arztes starb mein Vater. In den folgenden Wochen erkrankte meine Mutter sehr schwer, jedoch konnte ihr durch eine Ordensschwester geholfen werden.
Die Polen hatten nun für die den Deutschen geraubten Sachen Lebensmittel in Polen eingetauscht. Sie machten in unsrer Stadt kleine Geschäfte auf. Wir haben uns durch Heimarbeit, Stricken, mühsam durchgebracht. Bei der geringen Bezahlung und der Preishöhe für Lebensmittel konnten wir bei schnellstem und gediegenstem Arbeiten kaum genügend Kartoffeln und Brot beschaffen. Die Not war so groß, daß wir uns gezwungen sahen, die wenigen Möbel zu einem Spottpreise zu verkaufen und monatelang auf der Erde zu schlafen. Meine drei jüngsten Schwestern lagen drei Monate lang an einem malariaähnlichen Fieber.
Es gab weder Licht, noch Wasser, noch Brennmaterial. Dazu kam der Zustrom der Polen aus der Ukraine und Weißrußland. Durch das Zusammenleben mit einem so wenig kultivierten Volke und durch die Aussichtslosigkeit der Lage wurde das Leben immer schwerer.
Die erste Post im August 1946 brachte uns die Nachricht vom Tode meines 16jährigen jüngsten Bruders. Erst im Januar erfuhren wir dann von meinen Geschwistern im „Reich". Ein jüngerer Bruder, der als vermißt gemeldet war, war bereits aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen; ein älterer Bruder, der in Rußland eine schwere Kopfverletzung erhalten hatte, lebte mit seiner Familie in Schleswig-Holstein.
Am 2. Pfingstfeiertag 1947 wurden wir ausgewiesen. Nach 10 tägigem Transport bei sehr großer Hitze und schlechter Verpflegung kamen wir in Rudolstadt in Thüringen an und machten die 14 tägige Quarantänezeit durch. Meine Mutter brach im Lager zusammen und mußte in ärztliche Behandlung kommen. Nach wochenlangem Warten in einem Sammellager wurde uns eine kleine Wohnung zugewiesen. Erfreulicherweise erhielten wir schon nach wenigen Wochen die Zuzugsgenehmigung nach Köln. Seit August 1947 wohnen wir nun in Köln-Ehrenfeld in einem Krankenhaus. Der Raum (1 Zimmer, 1 Kellerschlafraum) ist für eine achtköpfige Familie sehr beschränkt, zumal wir alle in der Berufsausbildung stehen. Ich war sofort entschlossen, die Reifeprüfung nachzumachen. Da der Sonderlehrgang schon zu weit vorgeschritten war, wurde ich in die Unterprima der Kaiserin Augusta Schule z. Zt. Köln-Ehrenfeld aufgenommen. Die Monate bis zur Versetzung waren mir eine gute Einführungszeit, denn das schreckliche Erleben der letzten 3 Jahre hat viel Wissen verwischt und zurückgedrängt. Ich habe mich gut in der Klasse eingelebt und fühle mich in Köln schon ein wenig heimisch.
Am 4. August dieses Jahres mußte meine Mutter sich einer schweren Operation unterziehen. Sie liegt bis jetzt im Krankenhaus, so daß ich mit meiner Schwester, die vor der 1. Lehrerinnenprüfung steht, den Haushalt neben der Schule versorgen muß. Doch ich will mir alle Mühe geben, die Reifeprüfung zu bestehen, damit ich zwar wohl nicht gleich meinem lang gehegten Wunsch, Philologie zu studieren, nachkommen, wohl aber meine Mutter unterstützen kann, um meinen jüngeren Geschwistern eine Ausbildungsmöglichkeit zu erleichtern.
(Drei Schwestern meines Vaters waren Lehrerinnen, ein Vetter ist Hauptlehrer bei Oberlahnstein, eine Base und ein Vetter mütterlicherseits sind Studienräte in Berlin.)
Da ich immer mehr Freude an der englischen Sprache hatte, bitte ich, im Englischen eine schriftliche Prüfungsarbeit machen zu dürfen.